„Kathinka Zitz-Halein“ – Versionsunterschied
| [gesichtete Version] | [ungesichtete Version] |
K Änderungen von 188.107.238.156 rückgängig gemacht und letzte Version von 217.224.251.245 wiederhergestellt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Kathinka Zitz.jpg|thumb|Kathinka Zitz-Halein]] |
[[Datei:Kathinka Zitz.jpg|thumb|Kathinka Zitz-Halein]]Kathinka Zitz geb. Halein – die Faktenlage |
||
'''Kathinka Therese Pauline Modesta Zitz''', geb. Halein, genannt '''Kathinka Zitz-Halein''' (* [[4. November]] [[1801]] in [[Mainz]]; † [[8. März]] [[1877]] ebenda) war eine deutsche Schriftstellerin. Zitz, die die meiste Zeit ihres Lebens in Mainz verbrachte und dort den Revolutionär [[Franz Heinrich Zitz]] heiratete, engagierte sich auch gesellschaftlich und gründete 1849 den „Humania-Verein für vaterländische Interessen“. |
|||
== Leben == |
|||
[[Datei:Mainz-Kirschgarten.jpg|thumb|Geburtshaus von Kathinka Zitz-Halein in der Mainzer Altstadt (Kirschgarten)]] |
|||
Kathinka Zitz wurde als Tochter des wohlhabenden Handelsmanns Anton Viktor Felix Halein im [[Kirschgarten (Mainz)|Kirschgarten]] zu [[Mainz]] geboren. Sie wurde in Pensionaten in Mainz und [[Straßburg]] ausgebildet und entdeckte ihr Talent für das Schreiben. Ihre ersten Arbeiten wurden im Alter von sechzehn Jahren veröffentlicht. |
|||
Kathinka Zitz, geb. Halein, auch Kathinka Zitz-Halein genannt (* 4. November 1801 in Mainz, † 8. März 1877 ebenda) war eine deutsche Schriftstellerin. Sie wurde als Tochter des wohlhabenden Handelsmanns Anton Halein in Mainz geboren. In Pensionaten zu Mainz und Straßburg ausgebildet, entdeckte sie früh ihr Talent zum Schreiben und schrieb lebenslang Prosa und Lyrik. |
|||
Nach dem Tod ihrer Mutter Anna Maria Kunigunde Halein geb. Makowitzka am 26. Mai 1825 und dem Bankrott des Vaters nahm sie in [[Darmstadt]] eine Stelle als Erzieherin an. 1827 übernahm sie die Leitung des Höheren Töchterinstituts in [[Kaiserslautern]]. Die Anstellung gab sie jedoch nach kurzer Zeit wieder auf, um sich um ihre kranke jüngere Schwester Julia Charlotte Barnabida Halein zu kümmern, die 25-jährig am 13. Juni 1833 starb. |
|||
Nach dem Tod ihrer Mutter am 26. Mai 1825 und Ruin des Vaters nahm sie in Darmstadt eine Stelle als Erzieherin an. 1827 arbeitete sie am Höheren Töchterinstitut in Kaiserslautern. Diese Anstellung gab sie bald wieder auf und widmete sich nur noch der Schriftstellerei. Ein über 10-jähriges Verlöbnis mit einem preußischen Offizier löste sie, weil der Heiratsantrag ausblieb. 1837 heiratete sie den Mainzer Anwalt Dr. Franz Zitz. |
|||
Kathinka Zitz löste das 10-jährige Verlöbnis mit einem preußischen Offizier Namens Wild auf, da der Heiratsantrag ausblieb. Jahre später, am 3. Juni 1837, heiratete sie den zwei Jahre jüngeren, vermögenden Advokaten und Politiker Dr. [[Franz Heinrich Zitz]] (1803–1877), nachdem sie ihm mit einer Selbstmorddrohung das Eheversprechen abgepresst hatte. Zitz war später einer der Führer der revolutionären Mainzer Bewegung und Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung in der Paulskirche. 1849 musste Franz Zitz aus politischen Gründen nach Amerika auswandern und begegnete Kathinka zeitlebens nicht mehr.<ref>Vgl. dazu [[Ludwig Bamberger]], ''Erinnerungen'', Berlin 1899; Fränkel, in: ADB, Bd. 45, S. 374.</ref> |
|||
K. Zitz gilt heute weithin als bemerkenswerte Schriftstellerin, Demokratin bzw. Revolutionärin im bürgerlichen Aufstand von 1848 und Vorkämpferin für Frauenrechte in Mainz. Dieses Bild ist an den festgestellten Tatsachen zu messen. |
|||
Im Januar 1844 denunzierte Kathinka Zitz den für die Mainzer ''Narrhalla'' verantwortlichen Redakteur [[Ludwig Kalisch]] mit zwei Briefen an den Großherzog in Darmstadt wegen „Beleidigung gekrönter Häupter … man gestattet jenem fremden Burschen … Könige und Bürger zu verunglimpfen und zu beleidigen“. Die ''Narrhalla'' war in Mainz die einzige Publikation, die unter dem Narrengewand und deshalb nur während der Karnevalskampagnen in jeweils mehreren Ausgaben mit Satire, Persiflage und Humor gegen Fürstentümelei und Kleinstaaterei, Zensur und Schnüffelei, aber für Demokratie und Pressefreiheit agierte. Infolge der Denunziation wurde das Blatt auf dem Höhepunkt der Kampagne im Februar 1844 verboten, ein anderes Forum für demokratische Aktivitäten gab es nicht.<ref>Vgl. ''Heim und Welt'', Unterhaltungsblatt zur ''[[Mainzer Tageszeitung]]'' von 1924, Nr. 13 sowie Ludwig Kalisch, in: ''Narrhalla'' v. Februar 1844, S. 81–83.</ref> Ihre Fürstenverehrung bekräftigte Kathinka Zitz im Jahr 1846 durch Übersendung „vaterländischer Gedichte“ an den Großherzog.<ref>Hausarchiv des großherzoglichen Kabinetts D 12 Nr. 50/65.</ref> |
|||
Im Nachfolgenden sind alle erreichbaren Daten berücksichtigt, soweit im recherchierten Kontext festellbar beziehungsweise im erforderlichen Maß bewiesen. Das gilt auch für die subjektiven Texte von K. Zitz, deren objektive Entsprechung anhand der Faktenlage zu untersuchen war. Die aus zugänglicher Literatur, unterschiedlichsten Presseveröffentlichungen, Nachlässen sowie in Bibliotheken und Archiven ermittelten Informationen sind mit den jeweiligen Fundstellen erfasst. |
|||
Eine irgendwie geartete Beteiligung an der revolutionären Entwicklung lässt sich für sie ebenso wenig wie eine Mitgliedschaft im bald nach den Märztagen gegründeten Demokratischen Verein feststellen. Die erst nach der Revolution verfassten Texte hierzu gehen über die gleichzeitigen und häufigen zeitgenössischen Reflexionen in Prosa und Lyrik anderer Bürger nicht hinaus. Im Wesentlichen sind ihre diesbezüglichen Texte erst ab 1850 zu fassen. |
|||
''' |
|||
Ab 1849 entstanden im Deutschen Bund viele Frauenhilfsvereine. Im Mai dieses Jahres wurde in Mainz die ''Humania'' |
|||
Vorbemerkung:''' |
|||
gegründet, wobei Kathinka Zitz und die Mutter Ludwig Bambergers federführend waren. Ziel war Unterstützung und Hilfe für verwundete und gefangene Freischarsoldaten, auch Zuwendungen für die Flucht politisch Verurteilter. In der Zeitschrift ''Der Demokrat'' berichtete sie hierüber. Anfang 1850 schied Kathinka Zitz aus dem Verein aus. |
|||
Die Schriftstellerin Kathinka Halein heiratete im Juni 1837 mit 36 Jahren den 2 Jahre jüngeren, wohlhabenden, erfolgreichen und attraktiven Mainzer Advokaten Dr. Franz Zitz. Nach übereinstimmender zeitgenössischer Auffassung und späterer Literatur war das Eheversprechen mit ihrem Selbstmordversuch erpreßt. Das durchschnittliche Heiratsalter bei Frauen lag 1850 zwischen 22 und 24 Jahren<ref>s. “Bürgerinnen und Bürger...”, Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 77, v. Ute Frevert, 1988, S. 95</ref>. Eine unverheiratete Frau ab 25 galt als alte Jungfer, eine 30-jährige war “verwelkt”, Heirat und damit Versorgung so gut wie aussichtslos. Als besonders anstößig bei einer Ehe galt ein – auch nur geringer – Altersvorsprung der Frau<ref>s. “Matrone, alte Jungfer, Tante – das Bild der alten Frau in der bürgerlichen Welt des 19. Jhdts” in: Archiv für Sozialgeschichte, Bd. XXX, 1990, S. 44/74</ref>. Ältere ledige Frauen waren „komische Figur...“<ref>Zeitschrift für Geschichtsdidaktik, Bd. 2004 zu “Hagestolze/alte Jungfern”, S. 73</ref>. K. Zitz war bis auf Hausrat vermögenslos<ref>Quelle: Ehevertrag v. 2. 6. 1837, LA Speyer Bestand K 55 Nr. 296</ref> |
|||
Im Laufe der nächsten Jahre schrieb sie umfangreiche Aufsätze, Novellen, Gedichte, Übersetzungen, Zeitungsartikel, Erzählungen und Romane, die sie unter ihren Geburtsnamen Kathinka Halein und verschiedenen Pseudonymen wie etwa ''Kathinka, Tina Halein, Emeline, August Enders, Johann Golder, Rosalba, Stephanie, Tina, Viola, Auguste, Emilie, Eugenie, Pauline'' usw. veröffentlichte. |
|||
Eine freiwillige Heirat des als Liebling der Damenwelt geltenden und dieser Rolle auch entsprechenden F. Zitz wäre unter diesen Umständen nur aus alles überwältigender Liebe zu erklären. Hierfür gibt es aber nicht den geringsten Hinweis - im Gegenteil: Hochzeitsreise fand ohne sie statt, er ging nach wie vor eigene Wege, folgte seinen Neigungen, suchte der Gemeinschaft mit ihr auszuweichen. Ehe bedurfte und wollte er nicht. Bald flüchtete er aus diesem Zwang und traf nie mehr mit K. Zitz zusammen, leistete lieber lebenslangen Unterhalt statt – wie von ihr erhofft – zurückzukehren<ref>s. im einzelnen Ludwig Bamberger in „Erinnerungen", Berlin 1899. Bamberger war exzellenter Kenner der Mainzer Gesellschaft, engster Berater Bismarcks in Finanzfragen, Abgeordneter für Mainz im Reichstag, in Reputation und Korrektheit über jeden Zweifel erhaben, seine Mutter war Vizepräsidentin der „Humania", s. dort</ref>-<ref>Fränkel in ADB „ Allgemeine Deutsche Biographie“ um 1900 zu K. Zitz</ref>-<ref>“Ein Tag in der Paulskirche”, Spamer Verlag Leipzig, 1848</ref>-<ref> Köhler in „Mainzer Zeitschrift" v. 1989/90, S. 167</ref>-<ref>Keim in Mainzer Vierteljahreshefte 1. Jahrgang, Heft 4, Jg. 81, S. 113 ff.</ref>-<ref>“Persönlichkeiten der Stadtgeschichte“, Bd. 2 v. W. Balzer, 1989, S. 66</ref>-<ref>Mainzer Wochenblatt Nr. 34 v. März 1848</ref>. Die subjektiven Schilderungen von K. Zitz als nachträgliche Umwertung der Umstände ihrer Heirat finden in den Fakten keine Stütze, bleiben beweislos<ref>“Einige Worte an das Publikum...“, s. mog. m. 3163, Stabi Mainz</ref>. Ihre Darstellung steht allein, die Zeitgenossen und spätere Quellen sehen das anders (s. obige Nachweise). |
|||
Von einem hessischen Orden wurde sie für ihre Samariterwirksamkeit im [[Deutsch-Französischer Krieg|Deutsch-Französischen Krieg]] 1870/71 geehrt. Am Grauen Star erkrankt, verbrachte sie seit 1873 ihre letzten Lebensjahre im St. Vinzenziuspensionat der Barmherzigen Schwestern in Mainz. |
|||
'''Schriftstellerin:''' |
|||
== Literarisches Werk == |
|||
Zitz-Halein hinterließ ein umfangreiches literarisches Werk. Schon in ihrer Jugendzeit veröffentlichte sie zahlreiche Werke in Zeitschriften und Zeitungen. Ihre Poesie war zunächst licht und fröhlich, zeigte aber schon nachdenkliche, melancholische Anwandlungen, die sich nach dem Scheitern der Ehe mit Franz Zitz verdichteten. Der im Jahr 1846 veröffentlichte Gedichtband ''Herbstrosen in Poesie und Prosa'' repräsentiert ihr lyrisches Schaffen vor diesem Bruch. In den Revolutionsjahren tat sie sich – etwa in ''Donner und Blitz'' (1850) und ''Dur- und Molltöne. Neuere Gedichte'' (1859) – mit freisinnig gefärbten Gedichten und Prosastücken hervor, die ihr gesellschaftliches Engagement widerspiegeln. In den Folgejahren kam sie jedoch mehr und mehr in finanzielle Schwierigkeiten, die sie durch eine gesteigerte Literaturproduktion zu bekämpfen versuchte. Der literarischen Qualität ihrer Werke kam dies jedoch nicht zugute: |
|||
Als Schriftstellerin war sie eine von mehreren tausend des 19. Jhdts. 1825 wurden etwa 500 gezählt, Ende des Jahrhunderts waren es - weit überproportional zur Gesamtbevölkerung angestiegen - über 5000<ref>Helmut Kiesel “Geschichte der lit. Moderne," S. 86, C.H. Beck-Verlag</ref>. Die Frauen fanden durch das Schreiben Fremd- und Selbstbestätigung sowie Honorar. Demzufolge hatten sie auch entsprechend hohen Anteil an der enormen Roman- und Novellenproduktion ab dem 2. Drittel des 19. Jhdts. |
|||
{{Zitat|Infolge ihrer vielschreiberischen Skrupellosigkeit bei der Stoffwahl maß man zuletzt ihrem Wirken keinen Werth mehr bei: ‚Donner und Blitz [s. o.] von Kathinka Zitz‘ ward in Mainz geläufige Redensart, flache Belletristik zu kennzeichnen.|Ludwig Fränkel<ref>Fränkel, in: ADB, Bd. 45, S. 377.</ref>}} |
|||
Im wesentlichen handelt es sich bei den Werken von K. Zitz um beliebige, auf breiten Publikums- und Zeitgeschmack zugeschnittene Konfektionsware, vergleichbar mit der heutigen anspruchslosen Trivialliteratur<ref>zur neueren Trivialliteratur s. J. Messerli in: Beobachter 19/96, Vvf02</ref>. In der „Allgemeinen Deutschen Biographie“ ist ihr bei der Stoffwahl vielschreiberische Skrupellosigkeit bescheinigt, so daß ihrem Wirken kein Wert mehr beigemessen wurde<ref>ADB, Fränkel zu K. Zitz, S. 377 oben</ref>. Arno Schmidt hat sie in der kleinen Erzählung “Tina oder über die Unsterblichkeit" sagen lassen, daß “schon 90 Prozent meiner Romane als Makulatur weg sind"<ref>Fischer-Verlag, 1966, 21 Seiten, S. 19</ref>. |
|||
Aus literarischen Gründen hätte es der Reanimation ihres vergessenen Werkes beim Aufkeimen der neuen deutschen Frauenbewegung im letzten Drittel des 20. Jhdts. nicht bedurft. Die von vielen Schriftstellerinnen und ganz besonders von ihr gepflegte Literatur über Menschen von Stand und feinem Gefühl<ref>s. Fränkel in ADB S. 373 unten</ref>hatte sich bereits im Vormärz überlebt. Ein Rezensent merkte bei Vorlage zweier neuer Frauenromane anderer Autorinnen in Anspielung auf einen Titel hiervon an: “„Erste Gesellschaft" im Jahr 1847 verheißt wenig Gutes. An aristokrätelndem Frauentheerotwelsch haben wir Überfluß in der Literatur"<ref>Mainzer Unterhaltungsblätter Nr. 244 vom 13. 9. 1847</ref>. Auf längere Sicht versuchte sie deshalb die Bedürfnisse des Bildungsbürgertums mit mehrbändigen Werken über herausragende Persönlichkeiten zu befriedigen - ohne anhaltenden Erfolg<ref>Goedeke „Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung", Bd. 17, S. 1837 f</ref>. |
|||
Ihre erhebliche Literaturproduktion, vorwiegend als Erwerbschriftstellerei dem jeweiligen Zeitgeschmack folgend, war bereits 15 Jahre nach ihrem Tod vergessen (Mainzer Nachrichten Nr. 1 v. 1893) |
|||
Bei den mit demokratischen Versatzstücken versehenen Erzählungen in der Sammlung „Donner und Blitz" v. 9/1850 ward der Titel in Mainz geläufige Redensart, um flache Belletristik zu kennzeichnen<ref>Fränkel in ADB, S. 377 oben</ref>. Die Texte entsprechen dem gewohnten Muster, es begegnen die bekannten Inhalte. Die unter ihren sehr zahlreichen Gedichten erst spät in der Öffentlichkeit auftauchenden zwei oder drei Reime mit demokratischem Zungenschlag sind allein für sich und lange nach den Bezugsereignissen ohne Aussagekraft. Ihr Klubistenroman „Horix" um 1858/59 folgt einem bereits lange vorher, in schwieriger Zeit erschienen Buch zu diesem Thema<ref>s. a. a. Ort zu „Demokratin“</ref>. |
|||
Am Ende ihres literarischen Schaffens stehen einige vielbändige Werke über berühmte Dichter. Namentlich entstand ein elfbändiges Werk über [[Johann Wolfgang von Goethe]] (''Der Roman eines Dichterlebens'', 1863), das sechsbändige ''Rahel, aber dreiunddreißig Jahre aus dem Leben einer edlen Frau'' (1864) über [[Rahel Varnhagen von Ense]], das ebenfalls sechsbändige ''Heinrich Heine der Liederdichter. Ein romantisches Lebensbild'' (über [[Heinrich Heine]], 1864) und das 1867 veröffentlichte Werk ''Lord Byron. Romantische Skizzen aus einem vielbewegten Leben'' in fünf Bänden, die [[George Gordon Byron]]s Leben zum Thema haben. |
|||
Mehrere Auffassungen zum Werk der K. Zitz referierend<ref>s. ADB S. 377</ref> kommt Fränkel zu dem Ergebnis, daß sie viel Fabrikware und Engrosarbeit geliefert hat<ref>ebenso Keim in Mainzer Vierteljahreshefte v. 81, Heft 4, S.114</ref> und an ihr ein vielseitiges Talent verloren gegangen sei. Von Literatur mit bleibendem Wert spricht er nicht<ref>s. ADB S. 378 oben</ref>. |
|||
== Rezeption == |
|||
Ihre immense Literaturproduktion, dem jeweiligen Zeitgeschmack folgend, war bereits bei ihrem Tod und erst recht danach ohne Nachfrage<ref>s. Mainzer Nachrichten, Nr. 1 v. 1893</ref>-<ref>Keim in Mainzer Vierteljahreshefte, JG. 1, Heft 4</ref>. Sie war schon zu Lebzeiten vergessen. Außer den kargen Personaldaten der standesamtlichen Todesmeldungen<ref>Auszug aus dem Standesregister der Stadt Mainz lt. Mainzer Journal Nr. 58/77 v. 10.3 1877 Gestorbene v. 8. 3. 1877: Katharina Theresia Halein, 75 Jahre, Ehefrau von Dr. Franz Zitz, Privatmann</ref>- sind weder in den Mainzer Zeitungen noch der von ihr als Veröffentlichungsorgan geschätzten Didiskalia Todesanzeigen oder Nachrufe feststellbar. Bei der Nachwelt fand sie bis zur politisch akzentuierten Wiederbelebung im letzten Drittel des 20. Jhdts. lediglich als Denunziantin der „Narrhalla“ öffentliches Interesse. |
|||
* Am 24. November 1998 benannte die Stadt Mainz auf Vorschlag der Autorin Marlene Hübel, Mainz, Mitglied von Soroptimist International, den Weg zwischen Weihergarten und Hollagäßchen zu Ehren der Schriftstellerin Kathinka-Zitz-Weg. |
|||
* Der deutsche Schriftsteller [[Arno Schmidt]] (1914–1979) machte sie zur Heldin seiner Erzählung ''[[Tina oder über die Unsterblichkeit]]'', in der der Ich-Erzähler die Möglichkeit zur Reise in ein Dichterelysium bekommt, in dem berühmte und weniger berühmte Schriftsteller darauf warten, in Vergessenheit zu geraten, um endlich ihre Ruhe finden zu können. |
|||
Nach den vorliegenden Verzeichnissen hat sie unzählige Gedichte und eine Menge Fortsetzungsromane - teils bis zu 40 Folgen - produziert, vorzugsweise veröffentlicht in Unterhaltungs-, Mode- und Literaturblättern<ref>s. Goedeke, Grundriß Geschichte Deutscher Dichtung, Bd. 17 zu K. Zitz</ref>. Hinzu viele Erzählungen, drei Sammelbände vorwiegend mit Lyrik und andere Werke (s. Anhang) sowie Jugendliteratur<ref>s. Goedeke wie oben</ref>. Demokratische Anklänge oder gar Agitation sind im Vormärz in ihren Texten nicht zu finden. |
|||
== Werke == |
|||
* ''Marion de Lorme'' (Drama, 1833) |
|||
* ''Triboulet'' (Drama, 1835) |
|||
* ''Cromwell'' (Roman, 1836) |
|||
* ''Sonderbare Geschichten aus den Feenländern''. Friedrich Campe, Nürnberg 1844. |
|||
* ''Herbstrosen in Poesie und Prosa'' (1846) |
|||
* ''Donner und Blitz'' (Erzählung, 1850) |
|||
* ''Schillers Laura'' (Erzählung, 1855) |
|||
* ''Kaiserin Josephine'' (Roman, 1855) |
|||
* ''Magdalene Horix oder Vor und während der Klubistenzeit. Ein Zeitbild''. 1858, 3-bändiger Roman. |
|||
* ''Dur- und Molltöne'' (Gedichte, 1859) |
|||
* ''Der Roman eines Dichterlebens'' (1863) |
|||
* ''Rahel'' (Roman, 1864) |
|||
* ''Heinrich Heine'' (Roman, 1864) |
|||
* ''Lord Byron'' (Roman, 1867) |
|||
* ''Weltpantheon'' (Charakteristiken, 1869) |
|||
* ''Wahre Freiheit''. Neuauflage von Dietmar Noering (Hrsg.), Bangert und Metzler, Frankfurt am Main 1987, ISBN 3-924147-21-3. |
|||
* ''Wenn ich ein König wäre'' (um 1850) |
|||
Daß die bemerkten Qualitätsmängel auf Produktionszwang aus finanzieller Not zurückzuführen seien<ref>s. O. Bock „Kathinka Zitz-Halein“, Igel Verlag</ref> unterschlägt wie manches andere, daß die regelmäßigen Zuwendungen von F. Zitz ab 1840 ihre Lebensführung absicherten: die diesbezüglichen Gelder überstiegen den Einkommensdurchschnitt bei weitem (s. auch unten zu „Vorkämpferin...“). |
|||
== Literatur == |
|||
* Johanna Kinkel, Gottfried Kinkel, Rupprecht Leppla: ''Johanna und Gottfried Kinkels Briefe an Kathinka Zitz 1849–1861''. Bonner Heimat- u. Geschichtsverein 1958. (Aus: ''Bonner Geschichtsblätter''. 12.1958). |
|||
* Stanley Zucker: ''Kathinka Zitz-Halein and female civic activism in mid-nineteenth-century Germany''. Southern Illinois University Press 1991, ISBN 0-8093-1674-9. |
|||
* Micaela Mecocci: ''Kathinka Zitz (1801–1877). Erinnerungen aus dem Leben der Mainzer Schriftstellerin und Patriotin''. Ed. Erasmus, Mainz 1998, ISBN 3-925131-47-7. |
|||
* Anton Maria Keim: ''Das Mädchen aus dem Kirschgarten. Kathinka Zitz''. In: ''Mainz. Vierteljahreshefte für Kultur, Politik, Wirtschaft, Geschichte''. Nummer 4. Jahrgang 1981. Verlag Dr. Hanns Krach Mainz, {{ISSN|0720-5945}}<!--der Vorlage und Autorisiert-->, S. 113–116. |
|||
* {{ADB|45|373|379|Zitz, Kath. und Franz|Ludwig Fränkel|ADB:Zitz, Katharina}} |
|||
Fazit: Die Qualität ihrer Werke steht in keinem Verhältnis zur Quantität. Wenn Literatur über K. Zitz aus ideologischen/historischen Gründen gelesen werden mag, so doch - vielleicht bis auf das eine oder andere Gedicht - nichts mehr von ihr. Sie war wie tausende ihrer Zeit Gebrauchsschriftstellerin ohne weitergehende Qualitätsstandards. Jede Zeit bedient die Nachfrage nach trivialer Kost gemäß den herrschenden Moden – damals wie heute. Insofern war K. Zitz typische Vertreterin ihrer Zeit. |
|||
== Weblinks == |
|||
* {{DNB-Portal|11900870X}} |
|||
* [http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/frauenarchiv/vormaerz/zitz/index.htm Biographie] im Frauen-Kultur-Archiv der [[Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf|Universität Düsseldorf]] |
|||
* [http://www.horn-hechtsheim.de/verschiedenes/kathinka_zitz-1.html Meine Ururururgroßtante Kathinka Zitz-Halein] |
|||
* [http://www.wortblume.de/dichterinnen/zitz_i.htm Gedichte online] |
|||
* [http://www.ohiou.edu/~Chastain/rz/zitz.htm Englischer Enzyklopädie-Artikel] |
|||
== Anmerkungen == |
|||
<references/> |
|||
{{Normdaten|PND=11900870X|LCCN=n/90/636270|VIAF=27872125}} |
|||
{{DEFAULTSORT:Zitz-Halein, Kathinka}} |
|||
[[Kategorie:Autor]] |
|||
[[Kategorie:Person (Mainz)]] |
|||
[[Kategorie:Deutscher]] |
|||
[[Kategorie:Geboren 1801]] |
|||
[[Kategorie:Gestorben 1877]] |
|||
[[Kategorie:Frau]] |
|||
{{Personendaten |
|||
|NAME=Zitz-Halein, Kathinka |
|||
|ALTERNATIVNAMEN= |
|||
|KURZBESCHREIBUNG=deutsche Schriftstellerin und Aktivistin |
|||
|GEBURTSDATUM=4. November 1801 |
|||
|GEBURTSORT=[[Mainz]] |
|||
|STERBEDATUM=8. März 1877 |
|||
|STERBEORT=Mainz |
|||
}} |
|||
[[en:Kathinka Zitz-Halein]] |
|||
Version vom 5. Juli 2010, 11:17 Uhr
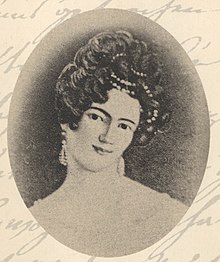
Kathinka Zitz geb. Halein – die Faktenlage
Kathinka Zitz, geb. Halein, auch Kathinka Zitz-Halein genannt (* 4. November 1801 in Mainz, † 8. März 1877 ebenda) war eine deutsche Schriftstellerin. Sie wurde als Tochter des wohlhabenden Handelsmanns Anton Halein in Mainz geboren. In Pensionaten zu Mainz und Straßburg ausgebildet, entdeckte sie früh ihr Talent zum Schreiben und schrieb lebenslang Prosa und Lyrik.
Nach dem Tod ihrer Mutter am 26. Mai 1825 und Ruin des Vaters nahm sie in Darmstadt eine Stelle als Erzieherin an. 1827 arbeitete sie am Höheren Töchterinstitut in Kaiserslautern. Diese Anstellung gab sie bald wieder auf und widmete sich nur noch der Schriftstellerei. Ein über 10-jähriges Verlöbnis mit einem preußischen Offizier löste sie, weil der Heiratsantrag ausblieb. 1837 heiratete sie den Mainzer Anwalt Dr. Franz Zitz.
K. Zitz gilt heute weithin als bemerkenswerte Schriftstellerin, Demokratin bzw. Revolutionärin im bürgerlichen Aufstand von 1848 und Vorkämpferin für Frauenrechte in Mainz. Dieses Bild ist an den festgestellten Tatsachen zu messen.
Im Nachfolgenden sind alle erreichbaren Daten berücksichtigt, soweit im recherchierten Kontext festellbar beziehungsweise im erforderlichen Maß bewiesen. Das gilt auch für die subjektiven Texte von K. Zitz, deren objektive Entsprechung anhand der Faktenlage zu untersuchen war. Die aus zugänglicher Literatur, unterschiedlichsten Presseveröffentlichungen, Nachlässen sowie in Bibliotheken und Archiven ermittelten Informationen sind mit den jeweiligen Fundstellen erfasst.
Vorbemerkung:
Die Schriftstellerin Kathinka Halein heiratete im Juni 1837 mit 36 Jahren den 2 Jahre jüngeren, wohlhabenden, erfolgreichen und attraktiven Mainzer Advokaten Dr. Franz Zitz. Nach übereinstimmender zeitgenössischer Auffassung und späterer Literatur war das Eheversprechen mit ihrem Selbstmordversuch erpreßt. Das durchschnittliche Heiratsalter bei Frauen lag 1850 zwischen 22 und 24 Jahren[1]. Eine unverheiratete Frau ab 25 galt als alte Jungfer, eine 30-jährige war “verwelkt”, Heirat und damit Versorgung so gut wie aussichtslos. Als besonders anstößig bei einer Ehe galt ein – auch nur geringer – Altersvorsprung der Frau[2]. Ältere ledige Frauen waren „komische Figur...“[3]. K. Zitz war bis auf Hausrat vermögenslos[4]
Eine freiwillige Heirat des als Liebling der Damenwelt geltenden und dieser Rolle auch entsprechenden F. Zitz wäre unter diesen Umständen nur aus alles überwältigender Liebe zu erklären. Hierfür gibt es aber nicht den geringsten Hinweis - im Gegenteil: Hochzeitsreise fand ohne sie statt, er ging nach wie vor eigene Wege, folgte seinen Neigungen, suchte der Gemeinschaft mit ihr auszuweichen. Ehe bedurfte und wollte er nicht. Bald flüchtete er aus diesem Zwang und traf nie mehr mit K. Zitz zusammen, leistete lieber lebenslangen Unterhalt statt – wie von ihr erhofft – zurückzukehren[5]-[6]-[7]-[8]-[9]-[10]-[11]. Die subjektiven Schilderungen von K. Zitz als nachträgliche Umwertung der Umstände ihrer Heirat finden in den Fakten keine Stütze, bleiben beweislos[12]. Ihre Darstellung steht allein, die Zeitgenossen und spätere Quellen sehen das anders (s. obige Nachweise).
Schriftstellerin:
Als Schriftstellerin war sie eine von mehreren tausend des 19. Jhdts. 1825 wurden etwa 500 gezählt, Ende des Jahrhunderts waren es - weit überproportional zur Gesamtbevölkerung angestiegen - über 5000[13]. Die Frauen fanden durch das Schreiben Fremd- und Selbstbestätigung sowie Honorar. Demzufolge hatten sie auch entsprechend hohen Anteil an der enormen Roman- und Novellenproduktion ab dem 2. Drittel des 19. Jhdts. Im wesentlichen handelt es sich bei den Werken von K. Zitz um beliebige, auf breiten Publikums- und Zeitgeschmack zugeschnittene Konfektionsware, vergleichbar mit der heutigen anspruchslosen Trivialliteratur[14]. In der „Allgemeinen Deutschen Biographie“ ist ihr bei der Stoffwahl vielschreiberische Skrupellosigkeit bescheinigt, so daß ihrem Wirken kein Wert mehr beigemessen wurde[15]. Arno Schmidt hat sie in der kleinen Erzählung “Tina oder über die Unsterblichkeit" sagen lassen, daß “schon 90 Prozent meiner Romane als Makulatur weg sind"[16].
Aus literarischen Gründen hätte es der Reanimation ihres vergessenen Werkes beim Aufkeimen der neuen deutschen Frauenbewegung im letzten Drittel des 20. Jhdts. nicht bedurft. Die von vielen Schriftstellerinnen und ganz besonders von ihr gepflegte Literatur über Menschen von Stand und feinem Gefühl[17]hatte sich bereits im Vormärz überlebt. Ein Rezensent merkte bei Vorlage zweier neuer Frauenromane anderer Autorinnen in Anspielung auf einen Titel hiervon an: “„Erste Gesellschaft" im Jahr 1847 verheißt wenig Gutes. An aristokrätelndem Frauentheerotwelsch haben wir Überfluß in der Literatur"[18]. Auf längere Sicht versuchte sie deshalb die Bedürfnisse des Bildungsbürgertums mit mehrbändigen Werken über herausragende Persönlichkeiten zu befriedigen - ohne anhaltenden Erfolg[19].
Bei den mit demokratischen Versatzstücken versehenen Erzählungen in der Sammlung „Donner und Blitz" v. 9/1850 ward der Titel in Mainz geläufige Redensart, um flache Belletristik zu kennzeichnen[20]. Die Texte entsprechen dem gewohnten Muster, es begegnen die bekannten Inhalte. Die unter ihren sehr zahlreichen Gedichten erst spät in der Öffentlichkeit auftauchenden zwei oder drei Reime mit demokratischem Zungenschlag sind allein für sich und lange nach den Bezugsereignissen ohne Aussagekraft. Ihr Klubistenroman „Horix" um 1858/59 folgt einem bereits lange vorher, in schwieriger Zeit erschienen Buch zu diesem Thema[21].
Mehrere Auffassungen zum Werk der K. Zitz referierend[22] kommt Fränkel zu dem Ergebnis, daß sie viel Fabrikware und Engrosarbeit geliefert hat[23] und an ihr ein vielseitiges Talent verloren gegangen sei. Von Literatur mit bleibendem Wert spricht er nicht[24]. Ihre immense Literaturproduktion, dem jeweiligen Zeitgeschmack folgend, war bereits bei ihrem Tod und erst recht danach ohne Nachfrage[25]-[26]. Sie war schon zu Lebzeiten vergessen. Außer den kargen Personaldaten der standesamtlichen Todesmeldungen[27]- sind weder in den Mainzer Zeitungen noch der von ihr als Veröffentlichungsorgan geschätzten Didiskalia Todesanzeigen oder Nachrufe feststellbar. Bei der Nachwelt fand sie bis zur politisch akzentuierten Wiederbelebung im letzten Drittel des 20. Jhdts. lediglich als Denunziantin der „Narrhalla“ öffentliches Interesse.
Nach den vorliegenden Verzeichnissen hat sie unzählige Gedichte und eine Menge Fortsetzungsromane - teils bis zu 40 Folgen - produziert, vorzugsweise veröffentlicht in Unterhaltungs-, Mode- und Literaturblättern[28]. Hinzu viele Erzählungen, drei Sammelbände vorwiegend mit Lyrik und andere Werke (s. Anhang) sowie Jugendliteratur[29]. Demokratische Anklänge oder gar Agitation sind im Vormärz in ihren Texten nicht zu finden.
Daß die bemerkten Qualitätsmängel auf Produktionszwang aus finanzieller Not zurückzuführen seien[30] unterschlägt wie manches andere, daß die regelmäßigen Zuwendungen von F. Zitz ab 1840 ihre Lebensführung absicherten: die diesbezüglichen Gelder überstiegen den Einkommensdurchschnitt bei weitem (s. auch unten zu „Vorkämpferin...“).
Fazit: Die Qualität ihrer Werke steht in keinem Verhältnis zur Quantität. Wenn Literatur über K. Zitz aus ideologischen/historischen Gründen gelesen werden mag, so doch - vielleicht bis auf das eine oder andere Gedicht - nichts mehr von ihr. Sie war wie tausende ihrer Zeit Gebrauchsschriftstellerin ohne weitergehende Qualitätsstandards. Jede Zeit bedient die Nachfrage nach trivialer Kost gemäß den herrschenden Moden – damals wie heute. Insofern war K. Zitz typische Vertreterin ihrer Zeit.
- ↑ s. “Bürgerinnen und Bürger...”, Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 77, v. Ute Frevert, 1988, S. 95
- ↑ s. “Matrone, alte Jungfer, Tante – das Bild der alten Frau in der bürgerlichen Welt des 19. Jhdts” in: Archiv für Sozialgeschichte, Bd. XXX, 1990, S. 44/74
- ↑ Zeitschrift für Geschichtsdidaktik, Bd. 2004 zu “Hagestolze/alte Jungfern”, S. 73
- ↑ Quelle: Ehevertrag v. 2. 6. 1837, LA Speyer Bestand K 55 Nr. 296
- ↑ s. im einzelnen Ludwig Bamberger in „Erinnerungen", Berlin 1899. Bamberger war exzellenter Kenner der Mainzer Gesellschaft, engster Berater Bismarcks in Finanzfragen, Abgeordneter für Mainz im Reichstag, in Reputation und Korrektheit über jeden Zweifel erhaben, seine Mutter war Vizepräsidentin der „Humania", s. dort
- ↑ Fränkel in ADB „ Allgemeine Deutsche Biographie“ um 1900 zu K. Zitz
- ↑ “Ein Tag in der Paulskirche”, Spamer Verlag Leipzig, 1848
- ↑ Köhler in „Mainzer Zeitschrift" v. 1989/90, S. 167
- ↑ Keim in Mainzer Vierteljahreshefte 1. Jahrgang, Heft 4, Jg. 81, S. 113 ff.
- ↑ “Persönlichkeiten der Stadtgeschichte“, Bd. 2 v. W. Balzer, 1989, S. 66
- ↑ Mainzer Wochenblatt Nr. 34 v. März 1848
- ↑ “Einige Worte an das Publikum...“, s. mog. m. 3163, Stabi Mainz
- ↑ Helmut Kiesel “Geschichte der lit. Moderne," S. 86, C.H. Beck-Verlag
- ↑ zur neueren Trivialliteratur s. J. Messerli in: Beobachter 19/96, Vvf02
- ↑ ADB, Fränkel zu K. Zitz, S. 377 oben
- ↑ Fischer-Verlag, 1966, 21 Seiten, S. 19
- ↑ s. Fränkel in ADB S. 373 unten
- ↑ Mainzer Unterhaltungsblätter Nr. 244 vom 13. 9. 1847
- ↑ Goedeke „Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung", Bd. 17, S. 1837 f
- ↑ Fränkel in ADB, S. 377 oben
- ↑ s. a. a. Ort zu „Demokratin“
- ↑ s. ADB S. 377
- ↑ ebenso Keim in Mainzer Vierteljahreshefte v. 81, Heft 4, S.114
- ↑ s. ADB S. 378 oben
- ↑ s. Mainzer Nachrichten, Nr. 1 v. 1893
- ↑ Keim in Mainzer Vierteljahreshefte, JG. 1, Heft 4
- ↑ Auszug aus dem Standesregister der Stadt Mainz lt. Mainzer Journal Nr. 58/77 v. 10.3 1877 Gestorbene v. 8. 3. 1877: Katharina Theresia Halein, 75 Jahre, Ehefrau von Dr. Franz Zitz, Privatmann
- ↑ s. Goedeke, Grundriß Geschichte Deutscher Dichtung, Bd. 17 zu K. Zitz
- ↑ s. Goedeke wie oben
- ↑ s. O. Bock „Kathinka Zitz-Halein“, Igel Verlag