Falknerei

Ein Falkner (oder Beizjäger) betreibt die Jagd mit Greifvögeln wie Falken, Sperbern, Habichten, Adlern auf Federwild (z.B. Rebhuhn) und kleines Haarwild (z.B. Kaninchen, Hasen). Zur Falknerei gehört auch das Abrichten und die Pflege der eingesetzten Greifvögel.
Entstehung
Die Beizjagd ist eine der ältesten Jagdformen der Menschheit. Sie entstand vermutlich vor etwa 3.500 Jahren in Zentral- und Mittelasien, da sie in der deckungslosen Steppe die zweckmäßigste Jagdform war. Sie wurde in einem Gebiet, das von der heutigen Türkei bis nach China reicht, intensiv gepflegt. Marco Polo, der sich im 13. Jahrhundert am Hof des Kublai Khan aufhielt, berichtete, dass dieser mit 10.000 Falknern aufbrach, um in den Ebenen seines Reiches auf Wolf, Fuchs und Hase zu jagen. Wenn diese Zahl auch wahrscheinlich übertrieben ist, so dürfte dem Hofstaat des Mongolenherrschers tatsächlich eine sehr große Zahl von Falknern angehört haben.
Beizjagd in Europa
Die Beizjagd als "edle" Jagdform
Ägypter, Griechen und Römer kannten die Beizjagd nicht. Sie fingen Vögel mit Wurfhölzern, Schlagnetzen oder Leimruten.
Vermutlich wurde die Beizjagd von Kreuzrittern nach Europa gebracht. Hier war die Jagd mit Vögeln ein Privileg des Adels, während die Jagd mit Hunden und Frettchen als Brauch des gemeinen Mannes galt. Die Falknerei ist eine besonders schwierige Form der Jagd, da Greifvögel nur sehr schwer an die Zusammenarbeit mit Menschen zu gewöhnen sind.
Siehe auch: Reiherpfahl
In Europa hatte diese prestigeträchtige Jagdform ihre Hochphase im Absolutismus. Sie ist kostspielig und erfordert eine große Anzahl an sehr gut geschultem Personal. Ein großes Falknerkorps war also eine Zeichen von Reichtum und Macht. Karl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach unterhielt mit 51 Mitarbeitern auf seinem Landsitz Triesdorf bei Ansbach eine der größten Falknereien in ganz Europa.
Das Falkenbuch Friedrichs II.
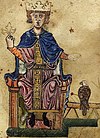
Die europäische Literatur zum Thema beginnt mit dem Falkenbuch (De arte venandi cum avibus, deutsch: "Über die Kunst, mit Vögeln zu jagen") des Kaisers Friedrich II., das der Kaiser für seinen Sohn Manfred verfasste. Für Friedrich II. war die Falknerei durch die dafür benötigte Kombination aus Willensstärke und Fürsorge eine ideale Vorübung für die Menschenführung. Der ideale Falkner war für ihn der ideale Herrscher. Seine Erkenntnisse hatte Friedrich II. in jahrzehntelanger Beobachtung von Tieren selbst gewonnen.


Die Beizjagd in der mittelalterlichen Kunst
In einigen mittelalterlichen Darstellungen hat der fürsorgliche Umgang mit Jagdfalken eine gewisse sexuelle Konnotation und wird zur Symbolisierung eines erotischen Verhältnisses eingesetzt.
Falknerei heute
Auch heute noch wird in Europa die Beizjagd betrieben. Eine gewisse wirtschaftlich-technische Bedeutung hat sie auf manchen Flughäfen, wo Falkner an der Vertreibung von Vogelschwärmen arbeiten, die für moderne Flugzeugtriebwerke eine Gefahr darstellen (Vogelschlag, engl. "bird strike").
Um die Falknerei heute in Deutschland legal zu betreiben, muss man zuerst eine reguläre Jägerprüfung absolvieren und danach einen Falknerjagdschein erwerben. Mittlerweile gibt es auch schon sehr viele Webseiten zum Thema Falknerei im Internet.
Als Krone dieser Jagdart gilt die Anwartefalknerei, bei der vornehmlich Wanderfalken eingesetzt werden, da nur diese und ihr ähnliche Arten wie Wüstenfalken, Präriefalken etc. beinahe ausschließlich aus dem Sturzflug heraus jagen. Bei anderen Falkenarten dauert die Ausbildung zur Anwartefalknerei länger und ist schwieriger, da sie nicht auf dem natürlichen Jagdverhalten dieser Greifvögel beruht. Man kann die Anwartefalknerei nur auf Flugwild und dabei auch nur auf solche Vögel betreiben, die sich am Boden, in Büschen oder im Wasser vor Feinden drücken, also bei Anblick von Falke oder Hund unbeweglich verharren. Zu diesen Wildarten zählen zum Beispiel Rebhuhn, Fasan, Wildente und Elster.
Bei der Beizjagd auf Rebhühner und Fasane ist ein guter Vorstehhund unverzichtbar, der das Wild sicher anzeigen muss. Wenn der Hund also vorsteht, wird dem Falken die Falkenhaube abgenommen und der Falke zum Steigen geworfen. Der Falke ist darauf trainiert, hoch in der Luft (je höher, je besser, in der Regel 100 bis 200Meter) genau über dem Falkner anzuwarten. Wenn er nun in eine passenden Position über dem Hund ist, erhält dieser den Befehl einzuspringen und damit das Wild hoch zu machen. Der Falke greift sofort an, geht in einen nahezu senkrechten Sturzflug über, beschleunigt noch und legt die Schwingen ganz an den Körper an, bis der Falke fast den Erdboden erreicht hat, dann öffnet er die Schwingen halb, schwingt sich mit unverminderter Geschwindigkeit in die Flugbahn des verfolgten Vogels ein und schlägt ihn mit den Klauen in der Luft. Ein solcher Stoß hat einen sehr hohen Impuls.
Falkner sind aufgrund des täglichen Umgangs und der Jagd mit dem eigenen Vogel auch Experten in der Pflege und Beurteilung verletzt aufgefundener Greifvögel. Sie können sehr gut einschätzen, ob ein solcher Greifvogel jemals wieder jagdtauglich sein wird und ob eine Chance auf Auswilderung besteht. Durch die falknerischen Techniken ist er auch in der Lage, einen gesundgepflegten Greifvogel erst einmal in der falknerischen Obhut "probefliegen" zu lassen, um zu testen, wie gut er sich erholt hat. Eine Freilassung ohne ausreichende Genesung könnte den Tod des Tieres bedeuten. Mittlerweile betreiben sehr viele Falkner (oder Falkner-Gruppen) Auswilderungsstationen, in denen verletzte Greifvögel gesund gepflegt werden, damit sie wieder in die Freiheit entlassen werden können.
Aufgrund ihrer Erfahrungen im Umgang mit Greifvögeln haben einige Falkner auch als erste angefangen, die Falken und andere Greifvögel zu züchten. So ist es auch den Falknern und ihren Auswilderungsprogrammen zu verdanken, dass der Wanderfalke wieder zahlreich in der Natur vorkommt. 2004 wurde beispielsweise der 1000ste Wanderfalke vom DFO ausgewildert und auch das erste seit 30 Jahren in Dänemark brütende Wanderfalkenpaar stammen aus Auswilderungen des DFO (Weibchen) bzw aus einem schwedischen Projekt (Männchen) welches eng mit dem DFO zusammenarbeitet.
Andererseits wird in unserer heutigen Zeit die Falknerei von einigen Seiten kritisiert. Gerade selbst ernannte Naturschutzverbände versuchen, die Falknerei zu verbieten oder zumindest immer weiter einzuschränken, so wird zum Beispiel von einer Vereinigung vorgetragen das 80.000 Greifvögel in Gefangenschaft von Privathaltern und Falkenhöfen gehalten würden, bei gleichzeitiger Angabe von etwa 1500 privaten Falknern, würde dies einen Greifvogelbestand von etwa 50 Greifen je Falkner bedeuten, dass solche Zahlen aus der Luft gegriffen sind kann sich jeder denken der über einen gesunden Menschenverstand verfügt und Kenntnis über die Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland hat. Lt. §3 BWschV ist eine maximale Anzahl von 2 Vögeln der Arten Habicht, Steinadler und Wanderfalke vorgegeben. Ausländische Greifvögel fallen nicht unter dieses Gesetz jedoch gilt für die von der Vereinigung kritisierte Anbindehaltung der Grundsatz dass nur solche Greifvögel angebunden gehalten werden dürfen die regelmäßigen Freiflug, sprich jeden zweiten Tag, genießen dürfen. Kein Mensch kann 50 Greifen regelmäßigen Freiflug geben, die Kontrolle dieser Verordnung wird von der zuständigen Behörde (i.d.R. das örtliche Veterinäramt streng überprüft).
Beizjagd in Zentralasien
Die Beize mit dem Steinadler (russisch Berkut) zu Pferde ist eine Jagdart zentralasiatischer Völker.
Da die Adlerweibchen größer und stärker sind als die Männchen, werden sie als Beizvögel bevorzugt. Kirgisische und kasachische Falkner bevorzugen Steinadler aus dem Südural, da sie wegen ihrer Größe auch zur Wolfsjagd verwendet werden können. Der Berkut (örtlicher Name für den dortigen Steinadler) packt die Wirbelsäule des Wolfes mit einem Fuß. Wenn der Wolf seinen Kopf wendet, um den Vogel zu beißen, schnappt der Adler mit dem anderen Fuß die Schnauze und kann so den Wolf bewegungsunfähig halten. Der Adler hält ihn solange nieder, bis der Jäger kommt und das Tier tötet. Risiko des Adlers: Der Wolf kann den Fuß schnappen.
Jeder Krallenfuß des Adlers kann mit einer gehörigen Kraft zupacken, die es dem Vogel ermöglicht, mit den Krallen durch die Schädeldecke in den Kopf zu greifen.
Berkutschi = Adlermann
Film: Geo-Reportage: Die Herren der Adler
Literatur
- Horst Schöneberg: Falknerei- Der Leitfaden für die Prüfung und Praxis. 2. Auflage. Peter N. Klüh, Darmstadt 2004, ISBN 3-933459-14-1 (nur zu bestellen unter Weblink:Falconaria [1])
- Heinz Brüll, Günther Trommer (Hrsg.): Die Beizjagd - Ein Leitfaden für die Falknerprüfung und für die Praxis. 4. Auflage. Paul Parey, Berlin 1997, ISBN 3-8263-8428-8
- Kurt Lindner: Beiträge zu Vogelfang und Falknerei im Altertum. Quellen und Studien zur Geschichte der Jagd, Band 12. de Gruyter, Berlin und New York 1973, ISBN 3-11-004560-5
- Kurt Lindner: Die deutsche Habichtslehre. Das Beizbüchlein und seine Quellen. Quellen und Studien zur Geschichte der Jagd, Band 2. 2., erweiterte Ausgabe. de Gruyter, Berlin 1964
- Arnold von Vietinghoff-Riesch, Max Pfeiffer: Falken über uns. Klüh, Darmstadt 1998, ISBN 3-933459-00-1 (Reprint der 1937 bei Reimer, Berlin, erschienenen Original-Ausgabe.)