„Methanosarcina barkeri“ – Versionsunterschied
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
K →Fundorte und Morphologie: Planungskommentar (Morphologie-Textaustausch), Anfang und Ende markiert |
→Fundorte und Morphologie: Textaustausch zwischen den Planungskommentaren (Morphologie-Textaustausch) |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
[[Datei:Methanogenesis acetate.svg|mini|links|Acetoclastische Methanbildung]] |
[[Datei:Methanogenesis acetate.svg|mini|links|Acetoclastische Methanbildung]] |
||
Der Fusaro-Stamm vom ''M. barkeri'' wurde in Schlammproben aus dem [[Lago Fusaro]], einem Süßwassersee in der Nähe von [[Neapel]] gefunden.<ref name="Genome" /> Er findet sich auch im [[Pansen]] von [[Rinder]]n, wo er [[Synergie|synergetisch]] mit anderen Mikroorganismen an der Verdauung von biogenen Polymeren wie [[Cellulose]] arbeitet.<ref name="Genome" /> Man findet ihn auch in Abwässern, Deponien und anderen Süßwassersystemen.<ref name="Genome" /> <!-- Planungskommentar (Morphologie-Textaustausch): Anfang |
Der Fusaro-Stamm vom ''M. barkeri'' wurde in Schlammproben aus dem [[Lago Fusaro]], einem Süßwassersee in der Nähe von [[Neapel]] gefunden.<ref name="Genome" /> Er findet sich auch im [[Pansen]] von [[Rinder]]n, wo er [[Synergie|synergetisch]] mit anderen Mikroorganismen an der Verdauung von biogenen Polymeren wie [[Cellulose]] arbeitet.<ref name="Genome" /> Man findet ihn auch in Abwässern, Deponien und anderen Süßwassersystemen.<ref name="Genome" /> <!-- Planungskommentar (Morphologie-Textaustausch): Anfang |
||
--><!-- Austauschkommentar: Der alte Text hat nicht zwischen zwei verschiedenen morphologischen Zuständen unterschieden und nicht angepasste Fakten verbunden (bildet dicke Zellwände die aus Membranen ... bestehen), war stilistisch schwierig (Regelmäßig ... zu unorganisierten ...) und verwendete unübliche Formulierungen (gelappte Kokken). Der neue Text differenziert stärker, zitiert mehr und wird länger. Zwei Angaben wurden weggelassen: Sichtbarkeit mit bloßem Auge und Gram-positive Färbung, da bisher keine Quelle gefunden wurde. --> |
|||
-->''M. barkeri'' besteht aus gelappten [[Kokken]].<ref name="PMID16980466">D. L. Maeder, I. Anderson, T. S. Brettin, D. C. Bruce, P. Gilna, C. S. Han, A. Lapidus, W. W. Metcalf, E. Saunders, R. Tapia, K. R. Sowers: ''The Methanosarcina barkeri genome: comparative analysis with Methanosarcina acetivorans and Methanosarcina mazei reveals extensive rearrangement within methanosarcinal genomes.'' In: ''Journal of bacteriology.'' Band 188, Nummer 22, November 2006, S. 7922–7931, {{DOI|10.1128/JB.00810-06}}, PMID 16980466, {{PMC|1636319}}.</ref> Regelmäßig wächst er zu unorganisierten Clustern, die so groß werden können, dass man sie mit dem bloßen Auge sehen kann.<ref name="PMID16980466" /> Die Zellen wachsen auch kugelförmig und groß die Gram-positiv färbbar sind.<ref name="PMID16980466" /> ''M. barkeri'' bildet dicke Zellwände die aus Membranen mit kurzkettigen [[Lipide]]n bestehen, ähnlich zu den Strukturen der meisten anderen Methanogenen.<ref name="PMID16980466" /><!-- Planungskommentar (Morphologie-Textaustausch): Ende --> ''M. barkeri'' str. ''fusaro'' hat kein [[Flagellum]], kann sich aber möglicherweise durch die Bildung von gasgefüllten [[Vesikel (Biologie)|Vesikeln]] bewegen.<ref name="PMID16980466" /> Diese Vesikel bilden sich aber nur in Gegenwart von Wasserstoff und Kohlendioxid, wahrscheinlich als Antwort auf einen [[Konzentrationsgefälle|Wasserstoffgradienten]].<ref name="PMID16980466" /> Das [[Genom]], das aus einem ringförmigen [[Chromosom]] und einem zusätzlichen, ebenfalls ringförmigen, extrachromosomalen Element besteht, bietet die bemerkenswerte Fähigkeit, eine breite Vielfalt an Molekülen zu [[Stoffwechsel|metabolisieren]].<ref name="PMID16980466" /> Das bringt der Mikrobe wahrscheinlich den Vorteil, sich trotz ihrer Unbeweglichkeit oder eingeschränkten Beweglichkeit an die Umwelt anpassen zu können, je nachdem, welche Energiequelle zur Verfügung steht. Das Genom von ''M. barkeri'' weist 3680 [[Offener Leserahmen|offene Leserahmen]] auf, die vermutlich [[Gen]]e darstellen.<ref name="PMID16980466" /> |
|||
''M. barkeri'' zeigt eine [[Dichotomie|dichotome]] [[Morphologie]]: wenn diese Mikroben in Süßwassermedium gezüchtet werden, wachsen sie zu großen, vielzelligen Aggregaten heran, die in einer Matrix aus sogenannten Methanochondroitin eingebettet sind, während sie in einem marinen Milieu als einzelne, unregelmäßige [[Kokken]] wachsen,<ref name="PMID16349092">K. R. Sowers, J. E. Boone, R. P. Gunsalus: ''Disaggregation of Methanosarcina spp. and Growth as Single Cells at Elevated Osmolarity.'' In: ''Applied and Environmental Microbiology.'' Band 59, Nummer 11, November 1993, S. 3832–3839, PMID 16349092, {{PMC|182538}}.</ref> die nur von einer Proteinschicht ([[S-Layer|S-Schicht]]), aber nicht vom Methanochondroitin umgeben sind.<ref name="PMID169804662" /> ''M. barkeri'' hat zwar [[Offener Leserahmen|offene Leserahmen]] (ORFs) für die [[N-Acetylmuraminsäure]]-Synthese,<ref name="PMID169804662" /> es wurde aber kein [[Murein]] in der [[Zellwand]] vorgefunden.<ref name="PMID889387">O. Kandler, H. Hippe: ''Lack of peptidoglycan in the cell walls of Methanosarcina barkeri.'' In: ''Archives of microbiology.'' Band 113, Nummer 1–2, Mai 1977, S. 57–60, PMID 889387.</ref> Während eine einzelne Zelle von ''M. barkeri'' lediglich die [[S-Layer|S-Schicht]] aufweist, die bei Archaeen sozusagen die „Standardausstattung“ der Zellwand ist, haben viele Archaeen zusätzliche Schichten, wobei die Ablagerung von Methanochondroitin über der S-Schicht eine Besonderheit von ''Methanosarcina''-Zellaggregate ist.<ref name="PMID25505452">A. Klingl: ''S-layer and cytoplasmic membrane - exceptions from the typical archaeal cell wall with a focus on double membranes.'' In: ''Frontiers in Microbiology.'' Band 5, 2014, S. 624, {{DOI|10.3389/fmicb.2014.00624}}, PMID 25505452, {{PMC|4243693}} (Review).</ref> Methanochondroitin ist ein heterogenes Polysaccharid auf der Basis von [[N-Acetylgalactosamin|N-Acetyl-D-Galactosamin]] und [[Glucuronsäure|D-Glucuronsäure]]<ref name="DOI10.1016/S0723-2020(86)80022-4">Peter Kreisl, Otto Kandler: ''Chemical structure of the cell wall polymer of methanosarcina.'' In: ''Systematic and Applied Microbiology.'' 7, 1986, S. 293, {{DOI|10.1016/S0723-2020(86)80022-4}}.</ref> und ähnelt in einigen Punkten dem [[Chondroitin]] im [[Bindegewebe]] von Wirbeltieren.<ref name="PMID1883201">L. Kjellén, U. Lindahl: ''Proteoglycans: structures and interactions.'' In: ''Annual review of biochemistry.'' Band 60, 1991, S. 443–475, {{DOI|10.1146/annurev.bi.60.070191.002303}}, PMID 1883201 (Review).</ref><ref name="PMID21572458">S. V. Albers, B. H. Meyer: ''The archaeal cell envelope.'' In: ''Nature reviews. Microbiology.'' Band 9, Nummer 6, Juni 2011, S. 414–426, {{DOI|10.1038/nrmicro2576}}, PMID 21572458 (Review).</ref><!-- Planungskommentar (Morphologie-Textaustausch): Ende --> ''M. barkeri'' str. ''fusaro'' hat kein [[Flagellum]], kann sich aber möglicherweise durch die Bildung von gasgefüllten [[Vesikel (Biologie)|Vesikeln]] bewegen.<ref name="PMID16980466">D. L. Maeder, I. Anderson, T. S. Brettin, D. C. Bruce, P. Gilna, C. S. Han, A. Lapidus, W. W. Metcalf, E. Saunders, R. Tapia, K. R. Sowers: ''The Methanosarcina barkeri genome: comparative analysis with Methanosarcina acetivorans and Methanosarcina mazei reveals extensive rearrangement within methanosarcinal genomes.'' In: ''Journal of bacteriology.'' Band 188, Nummer 22, November 2006, S. 7922–7931, {{DOI|10.1128/JB.00810-06}}, PMID 16980466, {{PMC|1636319}}.</ref> Diese Vesikel bilden sich aber nur in Gegenwart von Wasserstoff und Kohlendioxid, wahrscheinlich als Antwort auf einen [[Konzentrationsgefälle|Wasserstoffgradienten]].<ref name="PMID16980466" /> Das [[Genom]], das aus einem ringförmigen [[Chromosom]] und einem zusätzlichen, ebenfalls ringförmigen, extrachromosomalen Element besteht, bietet die bemerkenswerte Fähigkeit, eine breite Vielfalt an Molekülen zu [[Stoffwechsel|metabolisieren]].<ref name="PMID16980466" /> Das bringt der Mikrobe wahrscheinlich den Vorteil, sich trotz ihrer Unbeweglichkeit oder eingeschränkten Beweglichkeit an die Umwelt anpassen zu können, je nachdem, welche Energiequelle zur Verfügung steht. Das Genom von ''M. barkeri'' weist 3680 [[Offener Leserahmen|offene Leserahmen]] auf, die vermutlich [[Gen]]e darstellen.<ref name="PMID16980466" /> |
|||
== Anwendungen und Bedeutung == |
== Anwendungen und Bedeutung == |
||
Version vom 5. März 2019, 15:33 Uhr
| Methanosarcina barkeri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
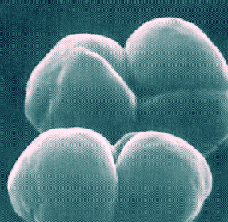
| ||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||
| Methanosarcina barkeri | ||||||||||||
| Schnellen 1947 |
Methanosarcina barkeri ist eine Art der Gattung Methanosarcina, es ist die Typusart der Gattung.[1] M. barkeri kann auf verschiedenen Stoffwechselwegen Methan produzieren und verschiedene Substrate zur Produktion von ATP nutzen wie Methanol, Acetat, Methylamin, sowie Wasserstoff und Kohlendioxid.[2] Obwohl er sich nur langsam entwickelt und empfindlich gegen Änderungen der Umweltbedingungen ist, kann er auf einer großen Breite verschiedener Substrate gedeihen.[3] M. barkeri war zudem der erste Organismus, in dem die Aminosäure Pyrrolysin gefunden wurde.[4] Außerdem wurden zwei Stämme von M. barkeri gefunden (M. b. Fusaro und M. b. MS), die gleichzeitig DNA-Sequenzen für unterschiedliche ATP-Synthase-Typen enthalten, die einerseits für Bakterien, Mitochondrien und Chloroplasten typisch sind (F-Typ) und die andererseits für Archaeen typisch sind (A-Typ), zu denen Methanosarcina gehört.[5]
Fundorte und Morphologie

Der Fusaro-Stamm vom M. barkeri wurde in Schlammproben aus dem Lago Fusaro, einem Süßwassersee in der Nähe von Neapel gefunden.[3] Er findet sich auch im Pansen von Rindern, wo er synergetisch mit anderen Mikroorganismen an der Verdauung von biogenen Polymeren wie Cellulose arbeitet.[3] Man findet ihn auch in Abwässern, Deponien und anderen Süßwassersystemen.[3]
M. barkeri zeigt eine dichotome Morphologie: wenn diese Mikroben in Süßwassermedium gezüchtet werden, wachsen sie zu großen, vielzelligen Aggregaten heran, die in einer Matrix aus sogenannten Methanochondroitin eingebettet sind, während sie in einem marinen Milieu als einzelne, unregelmäßige Kokken wachsen,[6] die nur von einer Proteinschicht (S-Schicht), aber nicht vom Methanochondroitin umgeben sind.[7] M. barkeri hat zwar offene Leserahmen (ORFs) für die N-Acetylmuraminsäure-Synthese,[7] es wurde aber kein Murein in der Zellwand vorgefunden.[8] Während eine einzelne Zelle von M. barkeri lediglich die S-Schicht aufweist, die bei Archaeen sozusagen die „Standardausstattung“ der Zellwand ist, haben viele Archaeen zusätzliche Schichten, wobei die Ablagerung von Methanochondroitin über der S-Schicht eine Besonderheit von Methanosarcina-Zellaggregate ist.[9] Methanochondroitin ist ein heterogenes Polysaccharid auf der Basis von N-Acetyl-D-Galactosamin und D-Glucuronsäure[10] und ähnelt in einigen Punkten dem Chondroitin im Bindegewebe von Wirbeltieren.[11][12] M. barkeri str. fusaro hat kein Flagellum, kann sich aber möglicherweise durch die Bildung von gasgefüllten Vesikeln bewegen.[13] Diese Vesikel bilden sich aber nur in Gegenwart von Wasserstoff und Kohlendioxid, wahrscheinlich als Antwort auf einen Wasserstoffgradienten.[13] Das Genom, das aus einem ringförmigen Chromosom und einem zusätzlichen, ebenfalls ringförmigen, extrachromosomalen Element besteht, bietet die bemerkenswerte Fähigkeit, eine breite Vielfalt an Molekülen zu metabolisieren.[13] Das bringt der Mikrobe wahrscheinlich den Vorteil, sich trotz ihrer Unbeweglichkeit oder eingeschränkten Beweglichkeit an die Umwelt anpassen zu können, je nachdem, welche Energiequelle zur Verfügung steht. Das Genom von M. barkeri weist 3680 offene Leserahmen auf, die vermutlich Gene darstellen.[13]
Anwendungen und Bedeutung
Methanosarcina barkeris einzigartige Fähigkeiten so viele Verbindungen umsetzen zu können kann viele potentielle Anwendungen ermöglichen.[2] M. barkeri wird an Orten mit extrem niedrigen Sauerstoffkonzentrationen wie dem Pansen von Rindern gefunden und als extremer Anaerobier eingestuft.[14] Das dort produzierte Methan bildet einen nennenswerten Beitrag zum Treibhauseffekt.[14] Bei kontrolliertem Auffangen lässt sich dieses Methan zur Energiegewinnung nutzen, ein Nebeneffekt ist beispielsweise die Reinigung von Abwasser.[15] Da M. barkeri unter extremen Bedingungen überleben kann, ist es möglich, ihn in Umgebungen mit sehr niedrigem pH-Wert einzusetzen, um sie effektiv zu neutralisieren und die Bedingungen für andere Methanbildner tolerabel zu gestalten.[14]
Einzelnachweise
- ↑ Lawrence G.Wayne: Actions of the Judicial Commission of the International Committee on Systematic Bacteriology on Requests for Opinions Published in 1983 and 1984. In: International Journal of systematic Bacteriology. vol. 36, no. 2, 1986, S. 357–358.
- ↑ a b W. E. Balch: Methanogens:reevaluation of a unique biological group. In: Microbiology and Molecular Biology Reviews. Band 43, Nr. 2, 1979, S. 260–296, PMID 390357, PMC 281474 (freier Volltext) – (asm.org [PDF]).
- ↑ a b c d Jessica Brill: Methanosarcina barkeri Fusaro, DSM 804. Abgerufen am 2. Juni 2014.
- ↑ John Atkins, Ray Gesteland: The 22nd Amino Acid. In: Science Magazine. Band 296. American Association for the Advancement of Science, 24. Mai 2002, doi:10.1126/science.1073339 (sciencemag.org [PDF; abgerufen am 1. Juni 2014]).
- ↑ Regina Saum u. a.: The F1FO ATP synthase genes in Methanosarcina acetivorans are dispensable for growth and ATP synthesis. In: FEMS Microbiology Letters. Vol. 300, Issue 2, November 2009, S. 230–236. doi:10.1111/j.1574-6968.2009.01785.x
- ↑ K. R. Sowers, J. E. Boone, R. P. Gunsalus: Disaggregation of Methanosarcina spp. and Growth as Single Cells at Elevated Osmolarity. In: Applied and Environmental Microbiology. Band 59, Nummer 11, November 1993, S. 3832–3839, PMID 16349092, PMC 182538 (freier Volltext).
- ↑ a b Referenzfehler: Ungültiges
<ref>-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen PMID169804662. - ↑ O. Kandler, H. Hippe: Lack of peptidoglycan in the cell walls of Methanosarcina barkeri. In: Archives of microbiology. Band 113, Nummer 1–2, Mai 1977, S. 57–60, PMID 889387.
- ↑ A. Klingl: S-layer and cytoplasmic membrane - exceptions from the typical archaeal cell wall with a focus on double membranes. In: Frontiers in Microbiology. Band 5, 2014, S. 624, doi:10.3389/fmicb.2014.00624, PMID 25505452, PMC 4243693 (freier Volltext) (Review).
- ↑ Peter Kreisl, Otto Kandler: Chemical structure of the cell wall polymer of methanosarcina. In: Systematic and Applied Microbiology. 7, 1986, S. 293, doi:10.1016/S0723-2020(86)80022-4.
- ↑ L. Kjellén, U. Lindahl: Proteoglycans: structures and interactions. In: Annual review of biochemistry. Band 60, 1991, S. 443–475, doi:10.1146/annurev.bi.60.070191.002303, PMID 1883201 (Review).
- ↑ S. V. Albers, B. H. Meyer: The archaeal cell envelope. In: Nature reviews. Microbiology. Band 9, Nummer 6, Juni 2011, S. 414–426, doi:10.1038/nrmicro2576, PMID 21572458 (Review).
- ↑ a b c d D. L. Maeder, I. Anderson, T. S. Brettin, D. C. Bruce, P. Gilna, C. S. Han, A. Lapidus, W. W. Metcalf, E. Saunders, R. Tapia, K. R. Sowers: The Methanosarcina barkeri genome: comparative analysis with Methanosarcina acetivorans and Methanosarcina mazei reveals extensive rearrangement within methanosarcinal genomes. In: Journal of bacteriology. Band 188, Nummer 22, November 2006, S. 7922–7931, doi:10.1128/JB.00810-06, PMID 16980466, PMC 1636319 (freier Volltext).
- ↑ a b c Sarah Hook, Brian McBride: Methanogens: Methane Producers of the Rumen and Mitigation Strategies. In: Archea. Band 2010. Hindawi, Dezember 2010, S. 11 (hindawi.com [abgerufen am 3. Juni 2014]).
- ↑ Alexander Aivasidis, Christian Wandrey Entwicklung und praktische Umsetzung eines Biogas-Hochleistungsverfahrens zur Reinigung organisch stark belasteter Abwässer. In: Chemie Ingenieur Technik. 61, 06/1989, S. 484–487. doi:10.1002/cite.330610613
Siehe auch
- Amelia-Elena Rotaru, Pravin Malla Shrestha, Fanghua Liu, Beatrice Markovaite, Shanshan Chen, Kelly P. Nevin, Derek R. Lovley: Direct Interspecies Electron Transfer between Geobacter metallireducens and Methanosarcina barkeri. In: Applied and Environmental Microbiology. Band 80, Nr. 15, 16. Mai 2014, S. 4599–4605, doi:10.1128/AEM.00895-14.