Tilly Wedekind

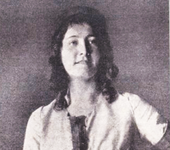
Tilly Wedekind, gebürtige Tilly Newes (* 11. April 1886 in Graz, Österreich-Ungarn; † 20. April 1970 in München, Deutschland), war eine deutsche Schauspielerin.
Leben
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Tilly Wedekind heiratete 1906, ein Jahr nachdem sie ihn beruflich kennengelernt hatte, den 22 Jahre älteren Dramatiker Frank Wedekind. Sie hatte mit ihm die Töchter Pamela und Kadidja. 1907 zog das Paar von Wien nach München, wo sie um 1910 auch mit ihm im Zwiegesang[1] auf der Bühne stand.
Bekannt wurde sie durch ihre Hauptrollen in den Stücken ihres Mannes, wo sie sein Frauenbild verkörperte. Umstritten war etwa Die Büchse der Pandora, wo sie in der Rolle der Lulu auftrat. Frank Wedekind starb am 9. März 1918 im Alter von 54 Jahren, und Tilly Wedekind trat nun auch wieder in klassischen Bühnenrollen auf, unter anderem in der Rolle der Maria Stuart. Nach dem Tod ihres Mannes hatte sie eine langjährige Beziehung mit dem Dichter Gottfried Benn. Sie pflegte auch zu dem Flieger Ernst Udet eine Freundschaft.
Nach Frank Wedekinds Tod übernahm sie die Verwaltung seines Nachlasses.[2]

Tilly Wedekind wurde auf dem Waldfriedhof in München (Alter Teil / Grab Nr. 17-W-88) beigesetzt.

Ehrungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1966: Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland am Bande[2]
- 1970: Schwabinger Kunstpreis der Stadt München (Ehrenpreis)
Filmografie
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1919: König Nicolo
- 1936: Reisebekanntschaften (Kurzfilm)
- 1936: Schlußakkord
- 1938: Fahrendes Volk
Werke
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Tilly Wedekind: Lulu – die Rolle meines Lebens. Autobiografie. Scherz, 1969.
Briefe
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Gottfried Benn. Briefe an Tilly Wedekind 1930–1955 (= Gottfried Benn. Briefe Band IV). Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Marguerite Valerie Schlüter. Stuttgart 1986.
- Frank und Tilly Wedekind: Briefwechsel 1905-1918. Herausgegeben von Hartmut Vinçon. Wallstein Verlag, Göttingen 2018, ISBN 978-3-8353-3171-6
Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Anatol Regnier: Du auf deinem höchsten Dach: Tilly Wedekind und ihre Töchter, Eine Familienbiographie. Knaus, München 2003, ISBN 3-8135-0223-6.
- Tilly Wedekind: Ich spiele zum ersten Mal die Lulu und begegne Frank Wedekind. In: Renate Seydel (Hrsg.): … gelebt für alle Zeiten. Schauspieler über sich und andere. Henschelverlag, Berlin 1978
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Literatur von und über Tilly Wedekind im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Tilly Wedekind bei IMDb
- Tilly Wedekind bei filmportal.de
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Josef Zuth: Handbuch der Laute und Gitarre. Verlag der Zeitschrift für die Gitarre (Anton Goll), Wien 1926 (1928), S. 286.
- ↑ a b Das Deutsche Ordensbuch. Die Träger des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Friedrich W. Borchert, Düsseldorf 1967, OCLC 951111658, S. 107.
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Wedekind, Tilly |
| ALTERNATIVNAMEN | Newes, Tilly |
| KURZBESCHREIBUNG | deutsche Schauspielerin |
| GEBURTSDATUM | 11. April 1886 |
| GEBURTSORT | Graz, Österreich-Ungarn |
| STERBEDATUM | 20. April 1970 |
| STERBEORT | München, Deutschland |