„AB Doradus“ – Versionsunterschied
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Hhdw1 (Diskussion | Beiträge) K →Physikalische Eigenschaften: Ebene3 eingeblendet, da sonst Ebene4 ungültig |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 161: | Zeile 161: | ||
=== Entfernung === |
=== Entfernung === |
||
Die Entfernung von AB Doradus kann aufgrund seiner hohen Eigenbewegung und der verhältnismäßig großen [[Parallaxe]] relativ genau auf 49 Lichtjahre bestimmt werden.<ref group="A">Umrechnung der Parallaxe in Lichtjahre <math> \frac{1}{66.92} = 14,94 pc |
Die Entfernung von AB Doradus kann aufgrund seiner hohen Eigenbewegung und der verhältnismäßig großen [[Parallaxe]] relativ genau auf 49 Lichtjahre bestimmt werden.<ref group="A">Umrechnung der Parallaxe in Lichtjahre: <math> \frac{1}{66.92} = 14,94 pc \cdot \frac{8154.1749}{2500} = 48,74 ly</math></ref> |
||
Da die 500 sonnennächsten Sterne sich bei korrekter Parallaxe in einer Umgebung von 33,017 Lichtjahren befinden, lässt sich daraus mithilfe des Kugelvolumens bei konstanter „Sternendichte“ berechnen, dass AB Doradus zu den 1.600 bis 1.700 sonnennächsten Sternen gehört.<ref group="A">π und 4/3 kürzen sich weg: <math>\frac{(48,74 ly)^3}{(33,017 ly)^3} |
Da die 500 sonnennächsten Sterne sich bei korrekter Parallaxe in einer Umgebung von 33,017 Lichtjahren befinden, lässt sich daraus mithilfe des Kugelvolumens bei konstanter „Sternendichte“ berechnen, dass AB Doradus zu den 1.600 bis 1.700 sonnennächsten Sternen gehört.<ref group="A">π und 4/3 kürzen sich weg: <math>\frac{(48,74 ly)^3}{(33,017 ly)^3} \cdot 500 = 1608 </math></ref> |
||
Scheinbar wirkt AB Doradus als Teil der am Nachthimmel neben ihm stehenden Große Magellanschen Wolke, die allerdings selbst mit knapp 160.000 Lichtjahren mehr als 3.000-mal von der Sonne aus weiter entfernt ist. |
Scheinbar wirkt AB Doradus als Teil der am Nachthimmel neben ihm stehenden Große Magellanschen Wolke, die allerdings selbst mit knapp 160.000 Lichtjahren mehr als 3.000-mal von der Sonne aus weiter entfernt ist. |
||
| Zeile 249: | Zeile 249: | ||
| align="center" | {{0}}4,83 |
| align="center" | {{0}}4,83 |
||
|} |
|} |
||
=== AB Doradus A-C === |
=== AB Doradus A-C === |
||
==== AB Doradus A ==== |
==== AB Doradus A ==== |
||
===== Eigenschaften ===== |
|||
AB Doradus A, der orange leuchtende Hauptstern, ist ein sonnenähnlicher [[Oranger Zwerg]] vom [[Spektralklasse|Spektraltyp]] K2 Vk. Die numerische Bezeichnung reicht von 0 (heißester) bis 9 (kühlster) Stern innerhalb der Spektralklasse K; mit K2 gehört AB Doradus A somit, wie [[Alpha Centauri|α Centauri B]] oder [[Epsilon Eridani|ε Eridani]], zu den heißeren K-Sternen. Die [[Leuchtkraftklasse]] V gibt an, dass er zu den [[Hauptreihe|Hauptreihensternen]] gehört. Das Suffix „k“ steht für interstellare Absoprtionslinien. |
AB Doradus A, der orange leuchtende Hauptstern, ist ein sonnenähnlicher [[Oranger Zwerg]] vom [[Spektralklasse|Spektraltyp]] K2 Vk. Die numerische Bezeichnung reicht von 0 (heißester) bis 9 (kühlster) Stern innerhalb der Spektralklasse K; mit K2 gehört AB Doradus A somit, wie [[Alpha Centauri|α Centauri B]] oder [[Epsilon Eridani|ε Eridani]], zu den heißeren K-Sternen. Die [[Leuchtkraftklasse]] V gibt an, dass er zu den [[Hauptreihe|Hauptreihensternen]] gehört. Das Suffix „k“ steht für interstellare Absoprtionslinien. |
||
| Zeile 256: | Zeile 260: | ||
Die Masse von AB Doradus A beträgt drei Viertel der Sonne. Damit ist er die mit Abstand schwerste Komponente des Vierfachsternsystems. Als früher Oranger Zwerg weist er eine Oberflächentemperatur von 4900 K auf und ist damit nur um weniger als 900 K kühler als die Sonne. Doch allein dieser niedrige Unterschied der Effektivtemperatur macht einen großen Unterschied in Bezug auf die Leuchtkraft aus. Obwohl AB Doradus A mit dem 0,9-fachen Sonnendurchmesser eine verhältnismäßig große Oberfläche besitzt, resultiert daraus nur knapp mehr als ein Drittel der [[Sonnenleuchtkraft]], mit der AB Doradus A strahlt. Dazu kommt, dass die Sonne aufgrund ihrer Oberflächentemperatur von ca. 5800 K nahezu komplett im [[Sichtbares Licht|sichtbaren Licht]] strahlt, während bei AB Doradus A der Anteil der [[Infrarotstrahlung]] wesentlich höher ist. Somit entfallen nur etwa 85% der Gesamtleuchtkraft von AB Doradus A auf sichtbares Licht. Diese schwächere visuelle Leuchtkraft ist die Ursache, dass, obwohl AB Doradus A der Hauptstern des Systems ist, der Orange Zwerg mit bloßem Auge trotz der verhältnismäßig geringen Entfernung von knapp fünfzig Lichtjahren mit einer scheinbaren Helligkeit von 6,93 mag mit bloßem Auge nicht mehr erkennbar ist. |
Die Masse von AB Doradus A beträgt drei Viertel der Sonne. Damit ist er die mit Abstand schwerste Komponente des Vierfachsternsystems. Als früher Oranger Zwerg weist er eine Oberflächentemperatur von 4900 K auf und ist damit nur um weniger als 900 K kühler als die Sonne. Doch allein dieser niedrige Unterschied der Effektivtemperatur macht einen großen Unterschied in Bezug auf die Leuchtkraft aus. Obwohl AB Doradus A mit dem 0,9-fachen Sonnendurchmesser eine verhältnismäßig große Oberfläche besitzt, resultiert daraus nur knapp mehr als ein Drittel der [[Sonnenleuchtkraft]], mit der AB Doradus A strahlt. Dazu kommt, dass die Sonne aufgrund ihrer Oberflächentemperatur von ca. 5800 K nahezu komplett im [[Sichtbares Licht|sichtbaren Licht]] strahlt, während bei AB Doradus A der Anteil der [[Infrarotstrahlung]] wesentlich höher ist. Somit entfallen nur etwa 85% der Gesamtleuchtkraft von AB Doradus A auf sichtbares Licht. Diese schwächere visuelle Leuchtkraft ist die Ursache, dass, obwohl AB Doradus A der Hauptstern des Systems ist, der Orange Zwerg mit bloßem Auge trotz der verhältnismäßig geringen Entfernung von knapp fünfzig Lichtjahren mit einer scheinbaren Helligkeit von 6,93 mag mit bloßem Auge nicht mehr erkennbar ist. |
||
[[Datei:Altair PR image6 (orange).jpg|thumb|AB Doradus A rotiert sehr schnell.]] |
[[Datei:Altair PR image6 (orange).jpg|thumb|AB Doradus A rotiert sehr schnell.]] |
||
[[Datei:Solarflares.jpg|thumb|right|Aufgeheizte [[Plasma (Physik)|Plasma]]-Magnetfeldbögen (Flares) auf der Sonnenoberfläche]] |
|||
===== Rotation ===== |
|||
In den neunziger Jahren<ref name="Donati & Cameron"> |
In den neunziger Jahren<ref name="Donati & Cameron"> |
||
| Zeile 286: | Zeile 293: | ||
Zusätzlich wurden auf der Oberfläche von AB Doradus A Eruptionen nachgewiesen, die auf eine veränderliche Rotation hindeuten. Dabei wird das schwache Wasserstoffplasma auf bis zu fünfzehn Millionen Grad erhitzt und in den Magnetfeldern, die sich sphärisch über die Sternenoberfläche wölben, eingeschlossen. Dieses Plasma glüht in [[Röntgenstrahlung|Röntgenstrahlen]]. Äquatoriale Ausbrüche rotieren wesentlich schneller, als jene an den Polen, jedoch war der Unterschied in den Jahren 1988 und 1996 nur halb so groß als von 1992 bis 1995. In diesen Jahren erschien der Stern stark abgeplattet. |
Zusätzlich wurden auf der Oberfläche von AB Doradus A Eruptionen nachgewiesen, die auf eine veränderliche Rotation hindeuten. Dabei wird das schwache Wasserstoffplasma auf bis zu fünfzehn Millionen Grad erhitzt und in den Magnetfeldern, die sich sphärisch über die Sternenoberfläche wölben, eingeschlossen. Dieses Plasma glüht in [[Röntgenstrahlung|Röntgenstrahlen]]. Äquatoriale Ausbrüche rotieren wesentlich schneller, als jene an den Polen, jedoch war der Unterschied in den Jahren 1988 und 1996 nur halb so groß als von 1992 bis 1995. In diesen Jahren erschien der Stern stark abgeplattet. |
||
===== Weitere Entwicklung ===== |
|||
Momentan steht AB Doradus A noch am Anfang seines Lebens. Wie in allen sonnenähnlichen Sternen findet die [[Kernfusion|Fusion]] im Kern von [[Wasserstoff]] zu [[Helium]] vor allem über die [[Proton-Proton-Reaktion|Proton-Proton-Kette]] statt, welche keinen steilen Temperaturgradient erzeugt. Somit dominiert die Wärmestrahlung im Innern von sonnenähnlichen Sternen. Im äußeren Teil herrscht dagegen die Konvektion vor, da hier der Stern kühl genug ist, damit der Wasserstoff neutral ist und somit undurchlässig für ultraviolette Photonen wird. |
|||
Weil sich nicht fusionsfähige Helium-Asche im Kern ansammelt, führt die Verminderung des Wasserstoffs pro Masseeinheit zu einer allmählichen Senkung der Rate der Kernfusion innerhalb dieser Masse. Zum Ausgleich erhöhen sich die Kerntemperatur und Druck langsam, welches eine Erhöhung der Gesamt-Fusionsrate bewirkt. Dies führt zu einer stetigen Zunahme der Leuchtkraft und des Radius von AB Doradus A im Laufe der Zeit.<ref name=Clayton>{{cite book |
|||
| first=Donald D. | last=Clayton | year=1983 |
|||
| language=Englisch |
|||
| title=Principles of Stellar Evolution and Nucleosynthesis |
|||
| publisher=University of Chicago Press |
|||
| id=ISBN 0-226-10953-4 }} |
|||
</ref> So war zum Beispiel die Leuchtkraft der jungen Sonne nur bei ca. 70 % ihres heutigen Wertes<ref>{{cite journal |
|||
| last=Gough | first=D. O. |
|||
| language=Englisch |
|||
| title=Solar interior structure and luminosity variations |
|||
| journal=Solar Physics | year=1981 | volume=74 | pages=21–34 |
|||
| url=http://adsabs.harvard.edu/abs/1981SoPh...74...21G |
|||
| accessdate=2007-12-06 |
|||
| doi=10.1007/BF00151270 }} |
|||
</ref> Der Leuchtkraftzuwachs ändert somit allmählich im Laufe der Zeit die Position des Sterns im [[Hertzsprung-Russell-Diagramm]]. |
|||
In etwa 22 Milliarden Jahren wird der Wasserstoffvorrat im Kern von AB Doradus A erschöpft sein.<ref group="A">Die Lebensdauer eines Sterns auf der Hauptreihe kann geschätzt werden: <math>\begin{smallmatrix} \tau_{ms}\ \sim \ 10^{10} \text{Jahre} \cdot \left[ \frac{M}{M_{\bigodot}} \right] \cdot \left[ \frac{L_{\bigodot}}{L} \right]\ =\ 10^{10} \text{Jahre} \cdot \left[ \frac{M_{\bigodot}}{M} \right]^{2.5} \end{smallmatrix}</math></ref> Dann wird durch den Verlust der Energieerzeugung der gravitative Kollaps wieder aufgenommen. Der den Kern umgebenden Wasserstoff erreicht die notwendige Temperatur und den Druck, um zu fusionieren. Dadurch bildet sich eine wasserstoffbrennende Schale um den Heliumkern. |
|||
Als Folge dieser Änderungen dehnt sich die äußere Hülle aus, die Temperatur sinkt und der Stern verwandelt sich in einen [[Roter Riese|Roten Riesen]]. |
|||
Ab diesem Punkt verlässt der Stern die Hauptreihe und erreicht den Riesenast. Der Heliumkern des Sterns zieht sich weiterhin zusammen, bis er durch den sogenannten degenerierten Elektronendruck aufgehalten wird – einem quantenmechanischen Effekt, welcher einschränkt, in wie weit Materie verdichtet werden kann. |
|||
Da AB Doradus A ein Stern mit mehr als einer halben Sonnenmasse ist<ref>{{cite journal |
|||
| language=Englisch |
|||
| author= Fynbo, Hans O. U. ''et al'' |
|||
| title=Revised rates for the stellar triple-α process from measurement of 12C nuclear resonances |
|||
| journal=Nature | year=2004 | volume=433 | pages=136–139 |
|||
| doi=10.1038/nature03219 }} |
|||
</ref> kann der Kern eine Temperatur erreichen, bei der es möglich wird, dass Kohlenstoff aus Helium über den [[Drei-Alpha-Prozess]] erzeugt wird.<ref>{{cite web |
|||
| language=Englisch |
|||
| last=Sitko | first=Michael L. |
|||
| date=[[24. März]], [[2000]] |
|||
| url=http://www.physics.uc.edu/~sitko/Spring00/4-Starevol/starevol.html |
|||
| title=Stellar Structure and Evolution |
|||
| publisher=University of Cincinnati |
|||
| accessdate=2007-12-05 }}</ref><ref>{{cite web |
|||
| author=Staff | date=[[12. Oktober]], [[2006]] |
|||
| url=http://outreach.atnf.csiro.au/education/senior/astrophysics/stellarevolution_postmain.html |
|||
| title=Post-Main Sequence Stars |
|||
| publisher=Australia Telescope Outreach and Education |
|||
| accessdate=2008-01-08 }} |
|||
</ref> Am Ende dieses Prozesses wird AB Doradus A seine äußeren Hüllen abstoßen und [[Planetarischer Nebel|Planetarische Nebel]] bilden. Zurück bleibt der erloschene Kern in Form eines [[Weißer Zwerg|weißen Zwerges]]. |
|||
=== AB Doradus C === |
=== AB Doradus C === |
||
Version vom 11. März 2009, 20:34 Uhr
| Doppelstern AB Doradus | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||
| Position von AB Doradus am Nachthimmel | ||||||||||||||
| Modul Vorlage:Sternkarte: Sternbildkarte nicht gefunden. Parameter Sternbild = "schwertfisch" | ||||||||||||||
| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | ||||||||||||||
| AladinLite | ||||||||||||||
| Sternbild | Kürzel fehlt oder falsch! | |||||||||||||
| Astrometrie | ||||||||||||||
| Radialgeschwindigkeit | +28 km/s[1] | |||||||||||||
| Parallaxe | 66,92 mas | |||||||||||||
| Entfernung [1] | 48,74 Lj (14,94 pc) | |||||||||||||
| Absolute visuelle Helligkeit Mvis | 6,055 mag | |||||||||||||
| Absolute bolometrische Helligkeit Mbol | 5,88 mag | |||||||||||||
| Eigenbewegung: | ||||||||||||||
| Rek.-Anteil: | 32,14 mas/a | |||||||||||||
| Dekl.-Anteil: | 150,97 mas/a | |||||||||||||
| Orbit | ||||||||||||||
| Periode | C zu A: 11,75 a Bb zu Ba: 0,375 a B zu AC: 1568,56 a | |||||||||||||
| Große Halbachse | C zu A: 2,3 AE Bb zu Ba: 0,52 AE B zu AC: 135 AE | |||||||||||||
| Einzeldaten | ||||||||||||||
| Namen | A / C; Ba / Bb | |||||||||||||
| Beobachtungsdaten: | ||||||||||||||
| Rektaszension[2] | A / C | 5h 28m 44,828s | ||||||||||||
| Ba / Bb | ||||||||||||||
| Deklination[2] | A / C | −65° 26′ 54.853″ | ||||||||||||
| Ba / Bb | ||||||||||||||
| Scheinbare Helligkeit [2] | A / C | 6,93 mag / 17,35 mag | ||||||||||||
| Ba / Bb | 13,75 mag / 13,75 mag | |||||||||||||
| Typisierung: | ||||||||||||||
| Spektralklasse[2] | A / C | K2 Vk / M8 | ||||||||||||
| Ba / Bb | M3.5 Ve / M3.5 Ve | |||||||||||||
| B−V-Farbindex[1] | A / C | +0.83 | ||||||||||||
| U−B-Farbindex[1] | A / C | +0.37 | ||||||||||||
| Physikalische Eigenschaften: | ||||||||||||||
| Absolute vis. Helligkeit Mvis[1] |
A / C | 6,06 mag / 16,48 mag | ||||||||||||
| Ba / Bb | 12,88 mag / 12,88 mag | |||||||||||||
| Absolute bol. Helligkeit Mbol[1] |
A / C | 5,89 mag / 14,03 mag | ||||||||||||
| Ba / Bb | 11,76 mag / 11,76 mag | |||||||||||||
| Masse[3] | A / C | 0,76 M☉ / 0,089 M☉ | ||||||||||||
| Ba / Bb | 0,16 M☉ / 0,16 M☉ | |||||||||||||
| Radius | A / C | 0,9 R☉ / 0,14 R☉ | ||||||||||||
| Ba / Bb | 0,18 R☉ / 0,18 R☉ | |||||||||||||
| Leuchtkraft | A / C | 0,377 L☉ / 0,00021 L☉ | ||||||||||||
| Ba / Bb | 0,00169 L☉ / 0,00169 L☉ | |||||||||||||
| Effektive Temperatur[3] | A / C | 4900 K/ 2640 K | ||||||||||||
| Ba / Bb | 3420 K / 3420 K | |||||||||||||
| Rotationsdauer | A / C | 0,508 d / 0,4 d | ||||||||||||
| Ba / Bb | 6,8 d / 6,8 d | |||||||||||||
| Alter | ca. 50 Millionen Jahre[3] | |||||||||||||
| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
AB Doradus (abgekürzt AB Dor) ist ein etwa 49 Lichtjahre entferntes Vierfachsternsystem im Sternbild Schwertfisch (lat.: Dorado), das sich am südlichen Sternhimmel befindet. Es beinhaltet einen schnell rotierenden orangen Hauptreienstern, sowie drei rote Zwergsterne, darunter einer von ihnen, AB Doradus C der leichteste bekannte Stern ist, nur knapp oberhalb der Grenze zum braunen Zwerg. AB Doradus ist nur 50 Millionen Jahre alt.
Name
Der erste Namensteil „AB“ folgt den Regeln zur Benennung veränderlicher Sterne und besagt, dass AB Doradus der sechsundfünfzigste veränderliche Stern ist, der im Sternbild Schwertfisch entdeckt wurde. Der zweite Namensteil „Doradus“ entspricht dem Genitiv des lateinischen Namens des Sternbildes Dorado.
Position und Entfernung
Auffinden am Nachthimmel
AB Doradus befindet sich im Sternbild Schwertfisch (lat. Dorado), das von der südlichen Halbkugel aus nahezu ganzjährig zu sehen. Für einen Beobachter ist er jedoch selbst unter klaren Bedingungen aufgrund seiner schwachen scheinbaren Helligkeit nicht mit bloßem Auge erkennbar. Nahe AB Doradus befinden sich die Großen Magellansche Wolke, der größten „Satellitengalaxie“ der Milchstraße, sowie die Sternbilder Netz (Reticulum) und Tafelberg (Mensa). Im Gegensatz zu Canopus, erscheint der Stern, selbst von den südlichsten Teilen Europas aus, nie am Nachthimmel.
Der Himmelssüdpol wandert aufgrund der Präzession in 25.800 Jahren einmal um den Südpol der Ekliptik, der im Sternbild Schwertfisch liegt. Der Himmelssüdpol bleibt somit immer in der Nähe dieses Sternbildes, weil er es im Laufe der Jahrtausende umkreist. Deshalb wird der vollständige Dorado im Gegensatz zu vielen anderen Südsternbildern, wie dem Kreuz des Südens, Tukan oder Pfau auch in Jahrtausenden nicht in Europa aufgehen.
Entfernung
Die Entfernung von AB Doradus kann aufgrund seiner hohen Eigenbewegung und der verhältnismäßig großen Parallaxe relativ genau auf 49 Lichtjahre bestimmt werden.[A 1]
Da die 500 sonnennächsten Sterne sich bei korrekter Parallaxe in einer Umgebung von 33,017 Lichtjahren befinden, lässt sich daraus mithilfe des Kugelvolumens bei konstanter „Sternendichte“ berechnen, dass AB Doradus zu den 1.600 bis 1.700 sonnennächsten Sternen gehört.[A 2]
Scheinbar wirkt AB Doradus als Teil der am Nachthimmel neben ihm stehenden Große Magellanschen Wolke, die allerdings selbst mit knapp 160.000 Lichtjahren mehr als 3.000-mal von der Sonne aus weiter entfernt ist.
Umgebung des Systems
Das nur 50 Millionen Jahre alte Sternsystem AB Doradus ist Namensgeber eines jungen Bewegungshaufens, einer lockeren Gruppe von Sternen, die nicht durch eine räumliche Konzentration um ein Haufenzentrum, sondern durch eine gemeinsame Bewegungsrichtung auf einen entfernt liegenden Konvergenz- oder Fluchtpunkt hin charakterisiert sind.
| U | V | W |
| −8 km/s | −27 km/s | −14 km/s |
Er beinhaltet dreißig junge Sterne, die Ähnlichkeiten in Bezug auf ihr geschätztes Alter von 50 bis 119 Millionen Jahren,[4] ihrer Metallizität, sowie ihrer gemeinsame Eigenbewegung aufweisen. Der AB Doradus-Bewegungshaufen ist etwa zwanzig Parsec entfernt und damit die sonnennächste Bewegungsgruppe von mehreren Sternen. Mit neun Sternen im Umkreis von zehn Parsec, also etwas mehr als dreißig Lichtjahren, bildet AB Doradus die Kernregion des Bewegungshaufens.[5] Seine kleineren Komponenten sind größtenteils späte K-Sterne. Viele von ihnen könnten sich noch weiter aufheizen oder sind noch von Staub umgeben. Um den etwas älteren, acht Lichtjahre entfernten Nachbarn von AB Doradus, HD 40307, wurden bereits drei Exoplaneten nachgewiesen. Das System ist jedoch nicht Teil der Bewegungsgruppe.
Aufgrund seines jungen Alter und seiner geringen Entfernung eignet sich der AB-Doradus-Bewegungshaufen neben den Regionen um TW Hydrae und β Pictoris ideal für die Suche nach extrasolaren Planeten, sowie der Erforschung der Bildung von Planetensystemen und ihrer Entwicklung um junge Sterne. Mit den neusesten Techniken dürfte es möglich sein, eventuelle Komponenten sogar bildhaft festhalten zu können.[6]
Aufbau des Systems

AB Doradus ist ein Mehrfachsternsystem, das sich aus zwei Doppelsternsystemen zusammensetzt, die sich in einem Abstand von etwa 135 Astronomische Einheiten, das entspricht dem 135-fachen Abstand der Erde zur Sonne, gegenseitig um ein gemeinsames Baryzentrum umkreisen. Gemäß den Keplerschen Gesetzen dauert eine gemeinsame Umdrehung fast 1570 Jahre.
Das schwerere Doppelsternsystem heißt AB Doradus A-C, weil es die Komponenten A und C beinhaltet, die sich in einem Abstand von 2,3 AE alle 11,75 Jahre umlaufen. Das masseärmere, AB Doradus B, besteht aus zwei 1,04 AE voneinander entfernten roten Zwergen, Ba und Bb, die sich mit einer Periode von etwa 135 Tagen umrunden.[7] Aufgrund der geringeren Masse von AB Doradus B, ist der Abstand zum Baryzentrum AB Doradus mit knapp 100 AE größer als der des schwereren Systems AB Doradus A-C, das das Baryzentrum in einem Abstand von etwa 37 AE umläuft.
Physikalische Eigenschaften
Vergleich wichtiger Sternparameter Name Masse
[M☉]Leuchtkraft
[L☉]Abs. vis.
Helligkeit [mag]AB Doradus A-C 0,849 0,378 6,06 AB Doradus B 0,323 0,00338 11,01 Sonne 1,0 1,0 4,83
AB Doradus A-C
AB Doradus A
Eigenschaften
AB Doradus A, der orange leuchtende Hauptstern, ist ein sonnenähnlicher Oranger Zwerg vom Spektraltyp K2 Vk. Die numerische Bezeichnung reicht von 0 (heißester) bis 9 (kühlster) Stern innerhalb der Spektralklasse K; mit K2 gehört AB Doradus A somit, wie α Centauri B oder ε Eridani, zu den heißeren K-Sternen. Die Leuchtkraftklasse V gibt an, dass er zu den Hauptreihensternen gehört. Das Suffix „k“ steht für interstellare Absoprtionslinien.
Die Masse von AB Doradus A beträgt drei Viertel der Sonne. Damit ist er die mit Abstand schwerste Komponente des Vierfachsternsystems. Als früher Oranger Zwerg weist er eine Oberflächentemperatur von 4900 K auf und ist damit nur um weniger als 900 K kühler als die Sonne. Doch allein dieser niedrige Unterschied der Effektivtemperatur macht einen großen Unterschied in Bezug auf die Leuchtkraft aus. Obwohl AB Doradus A mit dem 0,9-fachen Sonnendurchmesser eine verhältnismäßig große Oberfläche besitzt, resultiert daraus nur knapp mehr als ein Drittel der Sonnenleuchtkraft, mit der AB Doradus A strahlt. Dazu kommt, dass die Sonne aufgrund ihrer Oberflächentemperatur von ca. 5800 K nahezu komplett im sichtbaren Licht strahlt, während bei AB Doradus A der Anteil der Infrarotstrahlung wesentlich höher ist. Somit entfallen nur etwa 85% der Gesamtleuchtkraft von AB Doradus A auf sichtbares Licht. Diese schwächere visuelle Leuchtkraft ist die Ursache, dass, obwohl AB Doradus A der Hauptstern des Systems ist, der Orange Zwerg mit bloßem Auge trotz der verhältnismäßig geringen Entfernung von knapp fünfzig Lichtjahren mit einer scheinbaren Helligkeit von 6,93 mag mit bloßem Auge nicht mehr erkennbar ist.

Rotation
In den neunziger Jahren[8] konnte durch Messungen der Breite seiner Spektrallinien festgestellt werden, dass sich AB Doradus A sehr schnell um seine eigene Achse dreht, was Ausbuchtungen am Äquator, ein wesentlich komplexeres Magnetfeld und Temperaturschwankungen auf der Oberfläche zu Folge hat.[9] Dies ist der Grund, warum AB Doradus A anderen Spektraltypen zugewiesen wurde.
Es wurde festgelegt, dass eine volle Achsendrehung am Äquator in etwa zwölf Stunden erfolgt, das entspricht der fünfzigfachen Rotationsgeschwindigkeit der Sonne,[10] welche 25 Tage für eine volle Drehung benötigt. Damit ist die Rotation von AB Doradus A eine der kürzesten aller bekannten Sterne. Allerdings ist er noch weit davon entfernt, aufgrund seiner Rotationsgeschwindigkeit auseinanderzubrechen. Diese Grenze würde vermutlich ab 450 km/s überschritten werden.
Zusätzlich wurden auf der Oberfläche von AB Doradus A Eruptionen nachgewiesen, die auf eine veränderliche Rotation hindeuten. Dabei wird das schwache Wasserstoffplasma auf bis zu fünfzehn Millionen Grad erhitzt und in den Magnetfeldern, die sich sphärisch über die Sternenoberfläche wölben, eingeschlossen. Dieses Plasma glüht in Röntgenstrahlen. Äquatoriale Ausbrüche rotieren wesentlich schneller, als jene an den Polen, jedoch war der Unterschied in den Jahren 1988 und 1996 nur halb so groß als von 1992 bis 1995. In diesen Jahren erschien der Stern stark abgeplattet.
Weitere Entwicklung
Momentan steht AB Doradus A noch am Anfang seines Lebens. Wie in allen sonnenähnlichen Sternen findet die Fusion im Kern von Wasserstoff zu Helium vor allem über die Proton-Proton-Kette statt, welche keinen steilen Temperaturgradient erzeugt. Somit dominiert die Wärmestrahlung im Innern von sonnenähnlichen Sternen. Im äußeren Teil herrscht dagegen die Konvektion vor, da hier der Stern kühl genug ist, damit der Wasserstoff neutral ist und somit undurchlässig für ultraviolette Photonen wird.
Weil sich nicht fusionsfähige Helium-Asche im Kern ansammelt, führt die Verminderung des Wasserstoffs pro Masseeinheit zu einer allmählichen Senkung der Rate der Kernfusion innerhalb dieser Masse. Zum Ausgleich erhöhen sich die Kerntemperatur und Druck langsam, welches eine Erhöhung der Gesamt-Fusionsrate bewirkt. Dies führt zu einer stetigen Zunahme der Leuchtkraft und des Radius von AB Doradus A im Laufe der Zeit.[11] So war zum Beispiel die Leuchtkraft der jungen Sonne nur bei ca. 70 % ihres heutigen Wertes[12] Der Leuchtkraftzuwachs ändert somit allmählich im Laufe der Zeit die Position des Sterns im Hertzsprung-Russell-Diagramm.
In etwa 22 Milliarden Jahren wird der Wasserstoffvorrat im Kern von AB Doradus A erschöpft sein.[A 3] Dann wird durch den Verlust der Energieerzeugung der gravitative Kollaps wieder aufgenommen. Der den Kern umgebenden Wasserstoff erreicht die notwendige Temperatur und den Druck, um zu fusionieren. Dadurch bildet sich eine wasserstoffbrennende Schale um den Heliumkern. Als Folge dieser Änderungen dehnt sich die äußere Hülle aus, die Temperatur sinkt und der Stern verwandelt sich in einen Roten Riesen.
Ab diesem Punkt verlässt der Stern die Hauptreihe und erreicht den Riesenast. Der Heliumkern des Sterns zieht sich weiterhin zusammen, bis er durch den sogenannten degenerierten Elektronendruck aufgehalten wird – einem quantenmechanischen Effekt, welcher einschränkt, in wie weit Materie verdichtet werden kann.
Da AB Doradus A ein Stern mit mehr als einer halben Sonnenmasse ist[13] kann der Kern eine Temperatur erreichen, bei der es möglich wird, dass Kohlenstoff aus Helium über den Drei-Alpha-Prozess erzeugt wird.[14][15] Am Ende dieses Prozesses wird AB Doradus A seine äußeren Hüllen abstoßen und Planetarische Nebel bilden. Zurück bleibt der erloschene Kern in Form eines weißen Zwerges.
AB Doradus C
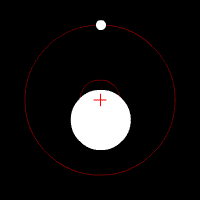
Da AB Doradus C 120-mal schwächer leuchtet als AB Doradus A, konnte er bis 2004 nur indirekt aufgrund seiner Gravitationswirkung durch ein „Wackeln“ des umkreisten AB Doradus A nachgewiesen werden. Erst 2005 wurde er mit dem Instrument NACO SDI des Very Large Telescope der europäischen Südsternwarte optisch erfasst. Dabei wurde festgestellt, dass er mit 2600 K ca. 400 K kühler war als erwartet. Dies stellt bisherige Modelle zur Berechnung von Sternmassen aus Leuchtstärken für kleine Himmelsobjekte insofern in Frage, als sie für kleine Sterne angepasst werden müssen, um das Beobachtungsergebnis zu erklären.
Siehe auch
Weblinks
- Neues Verfahren macht Begleiter sichtbar – Nachricht vom VERY LARGE TELESCOPE auf astronwes.com
- Eine Waage für untergewichtige Sterne – ESO News auf astronomie.de
- Das System AB Doradus
- The AB Dor Picture Gallery – The starspots and corona of AB Dor
- [5] – Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts für Astronomie vom 20. Januar 2005
Anmerkungen
- ↑ Umrechnung der Parallaxe in Lichtjahre:
- ↑ π und 4/3 kürzen sich weg:
- ↑ Die Lebensdauer eines Sterns auf der Hauptreihe kann geschätzt werden:
Einzelnachweise
- ↑ a b c d e Perryman, M.A.C. et al.: The Hipparcos Catalogue. European Space Agency, abgerufen am 3. Februar 2009 (englisch, ‚25647‘ in Feld ‚Hipparcos Identifier‘ eintippen und auf ‚Retrieve‘ klicken).
- ↑ a b c SIMBAD Query Result: V* AB Dor -- Rotationally variable Star. Centre de Données astronomiques de Strasbourg, abgerufen am 3. Februar 2009 (englisch).
- ↑ a b c Jürgen Kummer: Besondere Sterne: AB Doradus. Internetservice Kummer + Oster GbR, abgerufen am 3. Februar 2009 (deutsch).
- ↑ V. G. Ortega, E. Jilinski, R. de la Reza, B. Bazzanella: On the common origin of the AB Doradus moving group and the Pleiades cluster. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, abgerufen am 9. März 2009 (englisch).
- ↑ B. Zuckerman, Inseok Song: The AB Doradus Moving Group. The Astrophysical Journal, abgerufen am 9. März 2009 (englisch).
- ↑ F. Hormuth, W. Brandner, S. Hippler; M. Janson, T. Henning: Direct imaging of the young spectroscopic binary HD 160934. Astronomy and astrophysics, abgerufen am 9. März 2009 (englisch).
- ↑ Extrasolar Visions: AB Doradus A – Orange Main Sequence Star. Abgerufen am 24. Februar 2009 (englisch).
- ↑ J.-F. Donati, A. Collier Cameron, M. Semel, B. D. Carter, D. E. Rees: Spectropolarimetric observations of active stars. The Royal Astronomical Society, abgerufen am 10. März 2009 (englisch).
- ↑ J.-F. Donati, A. Collier Cameron, M. Semel, G. A. J. Hussain: Magnetic topology and prominence patterns on AB Doradus. The Royal Astronomical Society, abgerufen am 10. März 2009 (englisch).
- ↑ K. M. Hiremath: Internal Rotation of AB Doradus. Indian Space Institute of Astrophysics, abgerufen am 10. März 2009 (englisch).
- ↑ Donald D. Clayton: Principles of Stellar Evolution and Nucleosynthesis. University of Chicago Press, 1983, ISBN 0-226-10953-4 (englisch).
- ↑ D. O. Gough: Solar interior structure and luminosity variations. In: Solar Physics. 74. Jahrgang, 1981, S. 21–34, doi:10.1007/BF00151270 (englisch, harvard.edu [abgerufen am 6. Dezember 2007]).
- ↑ Fynbo, Hans O. U. et al: Revised rates for the stellar triple-α process from measurement of 12C nuclear resonances. In: Nature. 433. Jahrgang, 2004, S. 136–139, doi:10.1038/nature03219 (englisch).
- ↑ Michael L. Sitko: Stellar Structure and Evolution. University of Cincinnati, abgerufen am 5. Dezember 2007 (englisch).
- ↑ Staff: Post-Main Sequence Stars. Australia Telescope Outreach and Education, abgerufen am 8. Januar 2008.


![{\displaystyle {\begin{smallmatrix}\tau _{ms}\ \sim \ 10^{10}{\text{Jahre}}\cdot \left[{\frac {M}{M_{\bigodot }}}\right]\cdot \left[{\frac {L_{\bigodot }}{L}}\right]\ =\ 10^{10}{\text{Jahre}}\cdot \left[{\frac {M_{\bigodot }}{M}}\right]^{2.5}\end{smallmatrix}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/5711acb79859689e0879e43951a43180224a4e2b)