Pedanios Dioskurides

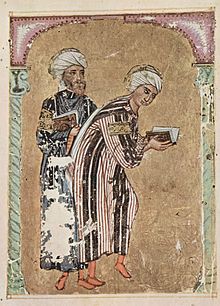
Pedanios Dioskurides (altgriechisch Πεδάνιος Διοσκουρίδης Pedánios Dioskurídēs, lateinisch Pedanius Dioscurides und Pedianus Anazarbeus Dioscorides) aus Anazarbos bei Tarsos in der römischen Provinz Kilikien (heute Landschaft in Kleinasien), kurz meist Dioskurides, war ein griechischer Arzt im Römischen Reich, der im 1. Jahrhundert in der Epoche des Kaisers Nero (54–68) lebte. Dioskurides ist einer der bekanntesten Ärzte der Antike und gilt mit seinem Werk Über Arzneistoffe als Pionier der Pharmakologie.
Leben und Werk[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Zur Person und zum Leben des Dioskurides (lateinisch auch Pedanius Dioscurides Anazarbeus) ist nur wenig bekannt.[1] Hinweise darauf ergeben sich aus seinem Vorwort zu seiner Materia medica („Über Arzneistoffe“[2]),[3] einer Abhandlung über Arzneimittel. Ausgebildet (von dem Arzt Lekanios Areios von Tarsos[4][5]) wohl in Tarsos, dem bedeutendsten Zentrum botanisch-pharmakologischer Forschung im Römischen Reich, und weitgereist (bzw. ein „soldatenähnliches“ Leben[6] geführt habend), verfasste Dioskurides aufgrund von Autopsie und unter Heranziehung umfangreicher älterer Literatur in griechischer Sprache sein Hauptwerk Περὶ ὕλης ἰατρικῆς Perí hýlēs iatrikḗs, lateinisch De materia medica „Über Heilmittel“. Diese Arzneimittellehre liegt seit dem 6. Jahrhundert (etwa übertragen durch Cassiodor) auch in lateinischen Ausgaben, spätestens um 540 mit dem sogenannten Dioscorides longobardus (auch Dioscurides langobardus genannt), dessen erste erhaltene Abschrift[7] im 9. Jahrhundert angefertigt wurde.[8][9] Das Werk ist unterteilt in fünf Bücher, die bereits Galenos (129–199) nach Vollständigkeit und Gründlichkeit als maßgebliches Handbuch anerkannte.
Daneben ist unter dem Namen Dioskurides noch das Werk Περὶ ἁπλῶν φαρμάκων Perí haplṓn pharmákōn (lateinisch Simplicia „Über einfache Heilmittel“) überliefert. Es wird in der modernen Forschung häufig tatsächlich als sein Werk eingestuft, wohingegen John G. Fitch in seiner Ausgabe dieser Schrift 2022 zu dem Ergebnis kam, dass Dioskurides vermutlich nicht der Verfasser des Textes war.[10] Es gibt noch weitere Texte, die unter Dioskurides’ Namen überliefert sind, aber noch nicht genauer auf ihre Echtheit bzw. auf die Identität ihres Autors geprüft worden sind.
De materia medica[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die dem Areios von Tarsos gewidmete „Materia Medica“ (griechisch ὑλικά) des Dioskurides umfasst ca. 1000 Arzneimittel (813 pflanzlichen, 101 tierischen und 102 mineralischen Ursprungs) und bietet 4740 medizinische Anwendungen. De materia medica („Über Arzneistoffe“[11]) gliedert sich in fünf Hauptteile („Bücher“):
- Aromatische Kräuter oder Gewürze, Öle, Salben; Pflanzensäfte, Gummis, Harze und Früchte von Bäumen und Sträuchern
- Tiere, Teile von Tieren, tierische Produkte (darunter Honig, Milch und Fett), Getreide, Topfkräuter und Gemüse sowie „mit einer Schärfe begabte“ Kräuter
- Wurzeln, Säfte, Kräuter und Samen, „die sowohl dem gewöhnlichen als auch dem arzneilichen Gebrauch dienen“
- vorher nicht genannte Wurzeln und Kräuter, Schwämme und Pilze
- Weinsorten, Mineralien und andere anorganische Substanzen wie Erze, Steine und Erden.[12][13]
Anders als die zuvor übliche alphabetisch oder nach äußerlichen Merkmalen geordnete Behandlung des gesamten Arzneistoffs verwendet Dioskurides erstmals eine Systematik nach der qualitativen Verwandtschaft, der medizinischen Wirksamkeit bzw. pharmakologischen Wirkung der einzelnen Arzneimittel, wobei auch tiermedizinische, (distanzierend zitiert) magische und nichtmedizinische (vor allem den Haushalts- und Kosmetikbereich betreffende) Verwendungen nicht fehlen.[14] Vorbildcharakter für spätere Kräuterbücher (etwa das von Rufinus[15]) bis in die frühe Neuzeit hatte mehr noch Dioskurides’ Methode der Pflanzenbeschreibung: der Name der Pflanze und Synonyme, Herkunft, botanische Beschreibung, medizinische Eigenschaften, (noch im 20. Jahrhundert gültige[16]) Zeitpunkte der Ernte, Zubereitung und Anwendung, gegebenenfalls auch Hinweise auf Lagerung, Aufdeckung von Verfälschungen usw. Bereits die älteste und zugleich wichtigste überlieferte Dioskurides-Handschrift, der prachtvoll illustrierte „Wiener Dioskurides“ (Cod. med. gr. 1, ÖNB) von 512/3 n. Chr., bietet zudem (ebenso wie spätere Handschriften) kunsthistorisch wichtige Abbildungen der besprochenen Heilpflanzen. Strittig ist aber, ob Dioskurides selbst seinem Werk schon Illustrationen beigab, ein Verfahren, das auf Krateuas (ca. 100 v. Chr.) – neben Sextius Niger (ca. 30 n. Chr.), Hauptquelle von Dioskurides – zurückgeht und den Erfolg des Dioskurides in Mittelalter[17] und Renaissance entscheidend mitbestimmte. Unabhängig davon wirft die moderne Identifikation der von Dioskurides beschriebenen Pflanzen erhebliche Probleme auf.
Die Arzneimittelkunde des Dioskurides (in alten, unter anderem italienischen,[18] Texten auch Diascorides oder Dyascorides geschrieben[19]), in zahllosen, immer wieder neuen Bearbeitungen, Paraphrasen und Übersetzungen (lateinisch, syrisch, arabisch, englisch, hebräisch, türkisch und mehr) verbreitet, behauptete für über 1600 Jahre uneingeschränkt ihre autoritative Geltung in Abendland und Orient auf dem Gebiet der Pharmazie, der Pflanzen- und Drogenkunde und ist als eines der einflussreichsten Werke in der Geschichte der Medizin und Pharmakologie überhaupt zu betrachten. Der Aufstieg der organischen Chemie im 19. Jahrhundert verdrängte seine Nutzung auch aus der Alltagspraxis von Kräuterkunde, pharmazeutischer Herstellung und Anwendung.
Ehrungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Charles Plumier benannte ihm zu Ehren die Gattung Dioscorea[20] der Pflanzenfamilie der Yamswurzelgewächse (Dioscoreaceae). Carl von Linné übernahm später diesen Namen.[21] Auch die Pflanzengattungen Discoreophyllum Engl. und Dioscoreopsis Kuntze aus der Familie der Mondsamengewächse (Menispermaceae) und Dioscoridea Bronner aus der Familie der Weinrebengewächse (Vitaceae) wurde ihm zu Ehren benannt.[22]
Ausgaben und Übersetzungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Editionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Max Wellmann: Pedanii Dioscuridis Anazarbei De materia medica libri quinque. 3 Bände. Weidmann, Berlin 1906(1907)–1914; Nachdruck ebenda 1958.
- Kurt Sprengel: Pedanii Dioscoridis Anazarbei De Materia Medica libri quinque, Teil 1.–2. Cnobloch, Leipzig 1829/30 (Griechischer Text).
Faksimile/Kommentar[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Dioscurides: Codex Vindobonensis med. Gr. 1 der Österreichischen Nationalbibliothek (= Codices selecti. Bd. 12). Kommentiert von Hans Gerstinger. 2 Bände. Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz 1970.
- Otto Mazal: Pflanzen – Wurzeln – Säfte – Samen. Antike Heilkunst in Miniaturen des Wiener Dioskurides. Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz 1981, ISBN 3-201-01169-X.
- De materia medica. Codex Neapolitanus, Napoli, Biblioteca nazionale, Ms. Ex. Vindob. Gr. 1. Kommentiert von Carlo Bertelli, Salvatore Lilla, Guglielmo Cavallo. 2 Bände. Salerno Editrice, Rom / Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz 1988/1992.
Übersetzungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Dioscoridis De materiali Medicina. Übersetzt (ins Lateinische) von Hermolaus Barbarus. Gregorius, Venedig 1516 (Digitalisat)
- Des Pedanios Dioskurides aus Anazarbos Arzneimittellehre in fünf Büchern. Übersetzt und mit Erklärungen versehen von Julius Berendes. Ferdinand Enke, Stuttgart 1902 (Volltext; Digitalisat Digitalisat); Nachdrucke: München 1970; Sändig, Wiesbaden 1970; Sändig, Schaan 1983; Sändig, Vaduz 1987; Sändig, Vaduz 2005.
- Kräuterbuch deß […] Pedacii Dioscoridis Anazarbaei […]: In siben sonderbare Bücher underschieden. Ins Deutsche übersetzt von Johann Dantz. Petrus Uffenbach, Frankfurt am Main 1610 (Digitalisat)
- Neudruck Grünwald bei München 1964.
- Jutta Kollesch, Diethard Nickel: Antike Heilkunst. Ausgewählte Texte. Philipp Reclam jun., Leipzig 1979; Stuttgart 1994, ISBN 978-3-15-009305-4. Nur Teilübersetzungen: Über Arzneistoffe, Buch I (aus dem Vorwort) und Buch II (Kap. 126).
- Robert T. Gunther (Hrsg.): The greek herbal of Dioscorides, illustrated by a byzantine A.D. 512, englished by John Goodyer A.D. 1655. Robert T. Gunther, New York 1934; Neudruck ebenda 1959.
- Des Pedanios Dioskurides aus Anazarbos Arzneimittellehre. Fünf Bücher über die Heilkunde. Aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzt von Max Aufmesser. Hildesheim 2002 (= Altertumswissenschaftliche Texte und Studien. Band 37).
- Pedanius Dioscorides of Anazarbus, De materia medica. Übersetzt ins Englische von Lily Y. Beck, mit einer Einführung von John Scarborough (= Altertumswissenschaftliche Texte und Studien. Band 38). Olms-Weidmann, Hildesheim 2005, ISBN 3-487-12881-0.
Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Christina Becela-Deller: Ruta graveolens L. Eine Heilpflanze in kunst- und kulturhistorischer Bedeutung. (Mathematisch-naturwissenschaftliche Dissertation Würzburg 1994) Königshausen & Neumann, Würzburg 1998 (= Würzburger medizinhistorische Forschungen. Band 65). ISBN 3-8260-1667-X, S. 33–72 und 219 f.
- Franz Daxecker: Heilpflanzen bei Augenerkrankungen im Wiener Dioskurides (Codex Constantinopolitanus, Codex Julianae Anikiae). In: Mitteilungen der Julius-Hirschberg-Gesellschaft zur Geschichte der Augenheilkunde, Bd. 5, 2003, S. 9–17 (2006).
- Franz Daxecker: Medicinal Herbs in the Viennese Dioscurides. In: Klin Mbl Augenheilkunde 224, 2007, S. 611 f.
- Franz Daxecker: Heilpflanzen der Augenheilkunde in der Handschrift Macer floridus und ein Vergleich mit De Materia medica des Dioskurides, Codex medicina antiqua und Wiener Dioskurides. In: Klin Mbl Augenheilkunde 225, 2008, S. 308–311.
- C. E. Dubler: La 'Materia Medica' de Dioscórides. Transmisión medieval y renacentista. 6 Bände, 1952/59.
- Emmanuel J. Emmanuel: Etude comparative sur les plantes dessinées dans le Codex Constantinopolitanus de Dioscoride. In: Schweizerische Wochenschrift für Chemie und Pharmazie. (Zürich) Band 50, Heft 4, 27. Januar 1912, S. 45–50, und Heft 5, 3. Februar 1912, S. 64–71.
- Otto Mazal: Pflanzen, Wurzeln, Säfte, Samen. Antike Heilkunst in Miniaturen des Wiener Dioskurides. Akademische Druck- und Verlags-Anstalt, Graz 1981, ISBN 3-201-01169-X, hier: S. 16–19 (Dioskurides Pedanios und sein Werk).
- John Marion Riddle: Dioscurides. In: F.E. Kranz (Hrsg.): Catalogus Translationum et Commentariorum 4, Washington 1980, S. 1–143.
- John Marion Riddle: Dioscorides on Pharmacy and Medicine. Mit einem Vorwort von John Scarborough, Austin (Texas) 1985 (= History of science series. Band 3).
- M. M. Sadek: The Arabic Materia Medica of Dioscorides. 1983.
- John Scarborough, Vivian Nutton: The preface of Dioscorides’ De materia medica: Introduction, translation, commentary. In: Transactions and studies of the College of Physicians of Philadelphia. Band 4, Nr. 3, 1982, S. 187–227.
- Ulrich Stoll: Dioskurides, Pedanios, 1. Jh. n. Chr. In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil, Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. De Gruyter, Berlin/ New York 2005, ISBN 3-11-015714-4, S. 308–315.
- Alain Touwaide: Pedanios Dioskurides. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 9, Metzler, Stuttgart 2000, ISBN 3-476-01479-7, Sp. 462–465.
- Alain Touwaide: L’identification des plantes du Traité de matière médicale de Dioscoride: un bilan méthodologique. In: Klaus Döring, Georg Wöhrle (Hrsg.): Antike Naturwissenschaft und ihre Rezeption. I–II, Bamberg 1992, S. 253–274.
- Max Wellmann: Die Pflanzennamen des Dioskurides. In: Hermes. Band 33, Nummer 3, 1898, S. 360–422, JSTOR:4472649.
- Max Wellmann: Dioskurides 12. In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band V,1, Stuttgart 1903, Sp. 1131–1142.
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Literatur von und über Pedanios Dioskurides im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Verzeichnis digitalisierter Ausgaben bei BIUM Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine, Paris
- Veröffentlichungen zu Dioskurides im Opac der Regesta Imperii
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Christina Becela-Deller: Ruta graveolens L. Eine Heilpflanze in kunst- und kulturhistorischer Bedeutung. (Mathematisch-naturwissenschaftliche Dissertation Würzburg 1994) Königshausen & Neumann, Würzburg 1998 (= Würzburger medizinhistorische Forschungen. Band 65). ISBN 3-8260-1667-X, S. 34 f.
- ↑ Jutta Kollesch, Diethard Nickel: Antike Heilkunst. Ausgewählte Texte aus dem medizinischen Schrifttum der Griechen und Römer. Philipp Reclam jun., Leipzig 1979 (= Reclams Universal-Bibliothek. Band 771); 6. Auflage ebenda 1989, ISBN 3-379-00411-1, S. 158–160 und S. 162 f.
- ↑ John Scarborough, Vivian Nutton: The preface of Dioscorides’ De materia medica: Introduction, translation, commentary. In: Transactions and studies of the College of Physicians of Philadelphia. Band 4, 1982, Nr. 3, S. 187–227.
- ↑ Max Wellmann: Areios 13. In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band II,1, Stuttgart 1895, Sp. 626.; John Marion Riddle: Dioscorides on Pharmacy and Medicine. 1985, S. 7.
- ↑ Jutta Kollesch, Diethard Nickel: Antike Heilkunst. Ausgewählte Texte […]. 1989, S. 202.
- ↑ John Marion Riddle: Dioscorides on Pharmacy and Medicine. 1985, S. 2–4.
- ↑ Hermann Stadler: Der lateinische Dioscorides der Münchener Hof- und Staatsbibliothek und die Bedeutung dieser Übersetzung für einen Teil der mittelalterlichen Medizin. In: Janus. Band 4, 1899, S. 548–550.
- ↑ Hermann Stadler (Hrsg.): Dioscorides Longobardus. (Cod. Lat. Monacensis 337). Der longobardische Dioskorides des Marcellus Virgilius. Aus T. M. Aurachers Nachlass herausgegeben von Konrad Hofmann und ergänzt von Hermann Stadler. In: Romanische Forschungen. Band 1 (Buch 1), 1883, S. 49–105 und 413 f. (von Hermann Rönsch); Band 10, 1899, S. 181–247 (Buch 2) und 369–446 (Buch 3); Band 11, 1901, S. 1–121 (Buch 4); Band 13, 1902, S. 161–243 (Buch 5); und Band 14 (Indexband), 1903, S. 601–636 (Vgl. auch worldcat.org.)
- ↑ Christina Becela-Deller: Ruta graveolens L. Eine Heilpflanze in kunst- und kulturhistorischer Bedeutung. 1998, S. 81–85.
- ↑ John G. Fitch: On Simples, attributed to Dioscorides (= Studies in ancient medicine. Band 57). Brill, Leiden/Boston 2022, ISBN 978-90-04-51371-6.
- ↑ Jutta Kollesch, Diethard Nickel: Antike Heilkunst. Ausgewählte Texte aus den medizinischen Schriften der Griechen und Römer. Philipp Reclam jun., Leipzig 1979 (= Reclams Universal-Bibliothek. Band 771); 6. Auflage ebenda 1989, ISBN 3-379-00411-1, S. 11 und 202 f.
- ↑ Christina Becela-Deller: Ruta graveolens L. Eine Heilpflanze in kunst- und kulturhistorischer Bedeutung. (Mathematisch-naturwissenschaftliche Dissertation Würzburg 1994) Königshausen & Neumann, Würzburg 1998 (= Würzburger medizinhistorische Forschungen. Band 65). ISBN 3-8260-1667-X, S. 39.
- ↑ Ulrich Stoll: Dioskurides, Pedanios, 1. Jh. n. Chr. 2005, S. 309–312 (‚De materia medica‘ – Inhalt und Aufbau).
- ↑ Christina Becela-Deller: Ruta graveolens L. Eine Heilpflanze in kunst- und kulturhistorischer Bedeutung. S. 38–51.
- ↑ Lynn Thorndike, Francis S. Benjamin Jr. (Hrsg.): The herbal of Rufinus [= Liber De virtutibus herbarum …], edited from the unique manuscript. Chicago 1945; anastatische Nachdrucke ebenda 1946 und 1949 (= [nur die Nachdrucke] Corpus of mediaeval scientific texts. Band 1).
- ↑ Varro E. Tyler, L.R. Brady, J.E. Robbers: Pharmacognosy. 8. Auflage. Philadelphia 1981.
- ↑ Vgl. auch John M. Riddle: Dioskurides im Mittelalter. In: Lexikon des Mittelalters. Band 3, 1986, Sp. 1095–1097.
- ↑ Vgl. Gustav Ineichen: El libro Agregà de Serapiom. Volgarizzamento di frater Jacobus Philippus de Padua. Edito per la prima volta (= Civiltà veneziana. Fonti e testi. Ser. 3: Lettere, musica e teatro. Band 1, ZDB-ID 419603-x). 2 Bände (Teil 1: Testo, Teil 2: Illustrationi Libguistiche). Istituto per la collaborazione culturale, Venedig/Rom 1962–1966. Zugleich Habilitationsschrift Zürich 1963, passim.
- ↑ Vgl. etwa Johannes Gottfried Mayer: Das ›Leipziger Drogenkompendium‹ (Leipzig, Universitätsbibliothek, Cod. 1224) und seine Quellen ›Circa instans‹, ›Aggregator‹ (Pseudo-Serapion), ›Macer floridus‹ (bzw. ›Älterer deutscher Macer‹), ›Liber graduum‹ (Constantin) und ›Liber iste‹. In: Johannes Gottfried Mayer, Konrad Goehl (Hrsg.): Editionen und Studien zur lateinischen und deutschen Fachprosa des Mittelalters. Festgabe für Gundolf Keil zum 65. Geburtstag (= Texte und Wissen. Band 3). Königshausen & Neumann, Würzburg 2000, ISBN 3-8260-1851-6, S. 207–263, hier: S. 225–261, passim.
- ↑ Charles Plumier: Nova Plantarum Americanarum Genera. Leiden 1703, S. 9.
- ↑ Carl von Linné: Genera Plantarum. Leiden 1742, S. 479.
- ↑ Lotte Burkhardt: Verzeichnis eponymischer Pflanzennamen – Erweiterte Edition. Teil I und II. Freie Universität Berlin, Berlin 2018, ISBN 978-3-946292-26-5, doi:10.3372/epolist2018.
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Dioskurides, Pedanios |
| KURZBESCHREIBUNG | griechischer Arzt |
| GEBURTSDATUM | 1. Jahrhundert |
| GEBURTSORT | unsicher: Anazarbos |
| STERBEDATUM | 1. Jahrhundert |