„Mycoplasma genitalium“ – Versionsunterschied
| [ungesichtete Version] | [ungesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
== Eigenschaften == |
== Eigenschaften == |
||
''Mycoplasma pneumoniae'' ist ein [[Zellwand|zellwandloses]] Bakterium und im Vergleich zu anderen Bakterien sehr klein (ca. 10 % des Volumens von ''[[Escherichia coli]]''). |
''Mycoplasma pneumoniae'' ist ein [[Zellwand|zellwandloses]] Bakterium und im Vergleich zu anderen Bakterien sehr klein (ca. 10 % des Volumens von ''[[Escherichia coli]]''). Die [[Zellmembran]] von Mykoplasmen enthält [[Cholesterin]], das sonst nur bei Eukaryoten gefunden wird und das nicht selbst produziert wird, sondern aus der Wirtszelle aufgenommen werden muss. Es kann sich mit speziellen Oberflächenmolekülen an das Genital- und Respirationsepithel anheften<ref>{{Literatur |Autor=Maria C. Fookes, James Hadfield, Simon Harris, Surendra Parmar, Magnus Unemo |Titel=Mycoplasma genitalium: whole genome sequence analysis, recombination and population structure |Sammelwerk=BMC Genomics |Band=18 |Datum=2017-12-28 |ISSN=1471-2164 |DOI=10.1186/s12864-017-4399-6 |PMC=PMCPMC5745988 |PMID=29281972 |Online=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5745988/ |Abruf=2019-03-25}}</ref>. |
||
== Erkrankungen == |
== Erkrankungen == |
||
Version vom 25. März 2019, 15:32 Uhr
Diese Baustelle befindet sich fälschlicherweise im Artikelnamensraum. Bitte verschiebe die Seite oder entferne den Baustein {{Baustelle}}.
|
| Mycoplasma genitalium | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
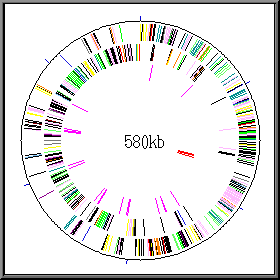
Mycoplasma genitalium | ||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||
| Mycoplasma genitalium | ||||||||||||
| Tully et al, 1983[1] |
Mycoplasma genitalium (Genitales Mycoplasma) ist ein Bakterium, das Hautzellen des Urogenitaltraktes befällt[2], sexuell übertragbar ist und Harnröhrenentzündungen sowie bei Frauen Gebärmutterhalsentzündung und andere Unterleibsentzündungen verursachen kann[3]. Es wurde erstmals 1981 isoliert[4] und 1983 als neue Art der Mykoplasmen identifiziert[1]. xoxo.
Eigenschaften
Mycoplasma pneumoniae ist ein zellwandloses Bakterium und im Vergleich zu anderen Bakterien sehr klein (ca. 10 % des Volumens von Escherichia coli). Die Zellmembran von Mykoplasmen enthält Cholesterin, das sonst nur bei Eukaryoten gefunden wird und das nicht selbst produziert wird, sondern aus der Wirtszelle aufgenommen werden muss. Es kann sich mit speziellen Oberflächenmolekülen an das Genital- und Respirationsepithel anheften[5].
Erkrankungen
Mycoplasma pneumoniae kommt beim gesunden Menschen nicht vor, ist aber hochansteckend. Es ist ein wichtiger Erreger der atypischen Lungenentzündung. Gefährdet sind vor allem Kinder. In Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen oder Militärbasen sind Epidemien berichtet worden. Weiter durch Mycoplasma pneumoniae verursachte Erkrankungen sind Pharyngitis, Tracheobronchitis, eine hämolytische Anämie, die allerdings meist subklinisch bleibt, ein makulopapilläres Erythem, Muskelschmerzen und verschiedene, teils schwerwiegende neurologische Erkrankungen.[6] Weiterhin wird ein Zusammenhang zwischen einer Infektion mit M. pneumoniae und der Entstehung von Asthma vermutet.[7]
Nachweis
Häufig werden Infektionen mit Mycoplasma pneumoniae detektiert, indem die DNA mit einer Polymerase-Kettenreaktion vervielfältigt und sichtbar gemacht wird. Schnelltests, die auf dem Prinzip des Enzymimmunoassays basieren, sind kommerziell erhältlich. Weil es 6 Wochen dauert, um Mykoplasmen zu kultivieren, spielt diese Methode für den Erregernachweis bei klinischen Fragestellungen eine untergeordnete Rolle.[8] Weiterhin ist es möglich, Antikörper über eine Komplementbindungsreaktion nachzuweisen.[9]
Eine klinische Methode, um einen Verdacht auf eine Mykoplasmeninfektion innerhalb von wenigen Minuten zu erhärten, ist das Abkühlen von EDTA-Vollblut durch ein Eisbad für 3 Minuten. Bei 30 – 90 % der Infizierten treten Kälteagglutinine auf, die zu einer sichtbaren (reversiblen) Verklumpung der Erythrozyten unter Kälteeinwirkung führen.
Es können auch zwei Blutsenkungsröhrchen befüllt und dabei eines bei Zimmertemperatur sowie das andere im Kühlschrank belassen werden. Durch die Kälteagglutinine ist die Blutsenkungsgeschwindigkeit im Kühlschrank im Vergleich zur Blutsenkungsgeschwindigkeit bei Zimmertemperatur deutlich erhöht.
Therapie
Da Mykoplasmen keine Zellwand besitzen, sind Antibiotika, die in die Biosynthese der bakteriellen Zellwand eingreifen (z. B. β-Lactam-Antibiotika wie Penicillin oder Cephalosporine), wirkungslos. Stattdessen werden Tetracycline (z. B. Doxycyclin), Makrolide (z. B. Azithromycin und Clarithromycin) oder Fluorchinolone wie Moxifloxacin oder Levofloxacin[10] gegeben. Eine besondere Prophylaxe ist nicht bekannt.
Geschichte
Bei ihren Untersuchungen der atypischen Lungenentzündung war den Forschern zunächst nicht klar, dass Mycoplasma pneumoniae zu den Bakterien gehört. Mykoplasmen waren zu klein, um sie mit den damaligen Mikroskopen sichtbar zu machen. Auch ließen sie sich nicht durch Bakterienfilter zurückhalten. Deshalb wurde der Erreger einfach Eaton's agent genannt.[8]
Einzelnachweise
- ↑ a b J. G. Tully, D. Taylor-Robinson, D. L. Rose, R. M. Cole, J. M. Bove: Mycoplasma genitalium, a New Species from the Human Urogenital Tract. In: International Journal of Systematic Bacteriology. Band 33, Nr. 2, 1. April 1983, ISSN 0020-7713, S. 387–396, doi:10.1099/00207713-33-2-387 (microbiologyresearch.org [abgerufen am 25. März 2019]).
- ↑ Scott A Weinstein, Bradley G Stiles: Recent perspectives in the diagnosis and evidence-based treatment of Mycoplasma genitalium. In: Expert Review of Anti-infective Therapy. Band 10, Nr. 4, 2012-1, ISSN 1478-7210, S. 487–499, doi:10.1586/eri.12.20 (tandfonline.com [abgerufen am 25. März 2019]).
- ↑ Harold C Wiesenfeld, Lisa E Manhart: Mycoplasma genitalium in Women: Current Knowledge and Research Priorities for This Recently Emerged Pathogen. In: The Journal of Infectious Diseases. Band 216, suppl_2, 15. Juli 2017, ISSN 0022-1899, S. S389–S395, doi:10.1093/infdis/jix198, PMID 28838078, PMC 5853983 (freier Volltext) – (oup.com [abgerufen am 25. März 2019]).
- ↑ JosephG. Tully, RogerM. Cole, David Taylor-Robinson, DavidL. Rose: A NEWLY DISCOVERED MYCOPLASMA IN THE HUMAN UROGENITAL TRACT. In: The Lancet. Band 317, Nr. 8233, 1981-6, S. 1288–1291, doi:10.1016/S0140-6736(81)92461-2 (elsevier.com [abgerufen am 25. März 2019]).
- ↑ Maria C. Fookes, James Hadfield, Simon Harris, Surendra Parmar, Magnus Unemo: Mycoplasma genitalium: whole genome sequence analysis, recombination and population structure. In: BMC Genomics. Band 18, 28. Dezember 2017, ISSN 1471-2164, doi:10.1186/s12864-017-4399-6, PMID 29281972, PMC PMCPMC5745988 (nih.gov [abgerufen am 25. März 2019]).
- ↑ LA. Vervloet, C. Marguet, PA. Camargos: Infection by Mycoplasma pneumoniae and its importance as an etiological agent in childhood community-acquired pneumonias. In: Braz J Infect Dis. 11. Jahrgang, Nr. 5, Oktober 2007, S. 507–514, PMID 17962878.
- ↑ N. Nisar, R. Guleria, S. Kumar, T. Chand Chawla, N. Ranjan Biswas: Mycoplasma pneumoniae and its role in asthma. In: Postgrad Med J. 83. Jahrgang, Nr. 976, Februar 2007, S. 100–104, doi:10.1136/pgmj.2006.049023, PMID 17308212.
- ↑ a b Dajani AS, Clyde WA, Denny FW: Experimental Infection with Mycoplasma Pneumoniae (Eatons's Agent). In: J Exp Med. 121. Jahrgang, 1965, S. 1071–1086, PMID 14319403, PMC 2138014 (freier Volltext) – (nih.gov).
- ↑ Rüdiger Dörris: Medizinische Mikrobiologie. Thieme Georg Verlag, Stuttgart 2005, ISBN 3-13-125313-4, S. 453 - 454.
- ↑ Marianne Abele-Horn: Antimikrobielle Therapie. Entscheidungshilfen zur Behandlung und Prophylaxe von Infektionskrankheiten. Unter Mitarbeit von Werner Heinz, Hartwig Klinker, Johann Schurz und August Stich, 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Peter Wiehl, Marburg 2009, ISBN 978-3-927219-14-4, S. 219 f.