„Armut“ – Versionsunterschied
| [ungesichtete Version] | [ungesichtete Version] |
| Zeile 333: | Zeile 333: | ||
Sie hat einzelne ethnische und soziale Gruppen ausfindig gemacht, die es trotz Armut zu etwas bringen. So erbrachten etwas die Kinder vietnameischer [[Boat People]] in den USA bessere Leistungen als Kinder der amerikanischen Mittelschicht <ref>Nathan Caplan et al.: The Boat People and Archievement in America: A study of family life, hard work, and cultural values. University of Michigan Press (1989)ISBN-0-472-09397-5 und David W. Haines (Hrsg.): Refugees as immigrants: Cambodians, Laotians and Vietnamese in America. Rowman&Littlefield Publishers (1989) ISBN: 084767553X, Nathan Caplan et al. (1992): Indochinese Refugee Families and Academic Archievement, In: Scientific American, Ausgabe Februar 1992; S. 18-24</ref>. Die jüdische Minderheit wurde innerhalb von zwei Generationen von einer äußerst armen zu einer äußerst reichen ethnischen Gruppe. |
Sie hat einzelne ethnische und soziale Gruppen ausfindig gemacht, die es trotz Armut zu etwas bringen. So erbrachten etwas die Kinder vietnameischer [[Boat People]] in den USA bessere Leistungen als Kinder der amerikanischen Mittelschicht <ref>Nathan Caplan et al.: The Boat People and Archievement in America: A study of family life, hard work, and cultural values. University of Michigan Press (1989)ISBN-0-472-09397-5 und David W. Haines (Hrsg.): Refugees as immigrants: Cambodians, Laotians and Vietnamese in America. Rowman&Littlefield Publishers (1989) ISBN: 084767553X, Nathan Caplan et al. (1992): Indochinese Refugee Families and Academic Archievement, In: Scientific American, Ausgabe Februar 1992; S. 18-24</ref>. Die jüdische Minderheit wurde innerhalb von zwei Generationen von einer äußerst armen zu einer äußerst reichen ethnischen Gruppe. |
||
Kinder aus amerikanischen Mittelschichtsfamilien, die durch die [[große Depression]] verarmt waren, wuchsen zu leistungsstarken und gesetzestreuen Bürgern heran <ref>Elder, Glen H. (1974): Children of the Great Depression.Chicago: University of Chicago Press S. 160</ref>. |
Kinder aus amerikanischen Mittelschichtsfamilien, die durch die [[große Depression]] verarmt waren, wuchsen zu leistungsstarken und gesetzestreuen Bürgern heran <ref>Elder, Glen H. (1974): Children of the Great Depression.Chicago: University of Chicago Press S. 160</ref>. |
||
In Deutschland machen vor allem die Kinder der vietnamesischen Vertragsarbeiter trotz Armut mit guten Schulleistungen auf sich aufmerksam. Die griechische Minderheit hat innerhalb von zwei Generationen ihren Weg aus der Armut in die Mitte der Gesellschaft gefunden. Ebenso sieht es mit der spanischen Minderheit aus. |
In Deutschland machen vor allem die Kinder der vietnamesischen Vertragsarbeiter trotz Armut mit guten Schulleistungen auf sich aufmerksam<ref>http://www.taz.de/dx/2005/12/06/a0080.1/text</ref><sup>,</sup><ref>Weiss, Karin & Dennis, Mike (Hrsg.) (2005): Erfolg in der Nische? Vietnamesen in der DDR und in Ostdeutschland. Münster: LIT Verlag</ref><sup>,</sup><ref>Weiss, K. & Kindelberger, H. (im Druck): Zuwanderung und Integration in den neuen Bundesländern – zwischen Transferexistenz und Bildungserfolg - Freiburg: Lambertus.</ref>. Die griechische Minderheit hat innerhalb von zwei Generationen ihren Weg aus der Armut in die Mitte der Gesellschaft gefunden. Ebenso sieht es mit der spanischen Minderheit aus. |
||
''Weiterführende Informationen zur [[Resilienz (Psychologie und verwandte Disziplinen)|Resilienzforschung]] sind auf [[Resilienz (Psychologie und verwandte Disziplinen)|entsprechender Seite]] zu finden. |
''Weiterführende Informationen zur [[Resilienz (Psychologie und verwandte Disziplinen)|Resilienzforschung]] sind auf [[Resilienz (Psychologie und verwandte Disziplinen)|entsprechender Seite]] zu finden. |
||
Version vom 22. November 2007, 12:54 Uhr
Armut bezeichnet (im engeren Sinne) eine materielle Mangelsituation, die häufig mit Machtlosigkeit und geringem gesellschaftlichem Status einhergeht. Das Armutsverständnis wird wesentlich zwischen relativer Armut und absoluter Armut differenziert, wobei Armut grundsätzlich aufgezwungen oder (seltener) freiwillig gewählt, sowie vorübergehend oder dauerhaft sein kann. Des Weiteren gibt es auch die Unterscheidung zwischen materieller und geistiger Armut.
Auf der Grundlage von modernen sozioökonomischen Konzepten kann Armut im weiteren Sinne als Mangelversorgung mit materiellen Gütern wie Dienstleistungen verstanden werden. Soziokulturelle Konzepte, die auch nichtmaterielle Bedürfnisse thematisieren, sprechen im Hinblick auf die ungleiche Verteilung von Bildungstiteln und Bildungskompetenzen von absoluter und relativer Bildungsarmut.
Unterscheidungen von Armut
Absolute Armut

Um einen Überblick über die Probleme der Entwicklungsländer zu ermöglichen, hat der ehemalige Präsident der Weltbank, Robert Strange McNamara, den Begriff der absoluten Armut eingeführt. Er definierte absolute Armut wie folgt:
- „Armut auf absolutem Niveau ist Leben am äußersten Rand der Existenz. Die absolut Armen sind Menschen, die unter schlimmen Entbehrungen und in einem Zustand von Verwahrlosung und Entwürdigung ums Überleben kämpfen, der unsere durch intellektuelle Phantasie und privilegierte Verhältnisse geprägte Vorstellungskraft übersteigt.“[1]
Die absolute Armutsgrenze ist bestimmt als Einkommens- oder Ausgabenniveau, unter dem sich die Menschen eine erforderliche Ernährung und lebenswichtige Bedarfsartikel des täglichen Lebens nicht mehr leisten können. Die Weltbank sieht Menschen, die weniger als 1 PPP-US-Dollar pro Tag zur Verfügung haben, als arm an. [2] Hunger(tot) geht somit unmittelbar mit dem Begriff der absoluten Armut einher. (näheres hierzu im Artikel Welthunger)
Indikatoren der absoluten Armut nach International Development Agency (IDA)
- Pro-Kopf-Einkommen (PKE) < 150 US-$/Jahr
- Kalorienverbrauch je nach Land < 2160-2670/Tag
- Durchschnittliche Lebenserwartung < 55 Jahren
- Kindersterblichkeit > 33/1000
- Geburtenrate > 25/1000
Armut exestiert zwar auch in Wohlstandsgesellschaften wie Deutschland, allerdings entsprechen die Lebensbedingungen der Menschen dort in der Regel nicht den Kriterien der absoluten Armut, da der Staat hier in der Regel durch soziale Leistungen interveniert und kein Mensch im Sinne der absoluten Armut von weniger als einem PPP-US-Dollar pro Tag leben muss. Dies schließt selbstverständlich nicht aus, dass dennoch Menschen durch das System fallen und absolute Armut somit praktisch nie komplett ausgemerzt werden kann.
Relative Armut
Relative Armut meint Armut im Bezug zum jeweiligen geografischen Umfeld eines Menschen. Somit kann relative Armut als Unterversorgung mit materiellen und immateriellen Ressourcen von Menschen bestimmter sozialer Schichten im Verhältnis zum Wohlstand der jeweiligen Gesellschaft bezeichnet werden. In diesem Zusammenhang bezieht sich relative Armut auf verschiedene statistische Maßzahlen für eine Gesellschaft (zum Beispiel Durchschnitt oder Median des Einkommens). So definiert die WHO die Armutsgrenze anhand des Verhältnisses des individuellen Einkommens zum Durchschnittseinkommen im Heimatland einer Person. Danach sei arm, wer monatlich weniger als die Hälfte des aus der Einkommensverteilung seines Landes berechneten Medians zur Verfügung hätte. Für die OECD Länder ist die Armutsschwelle in gleicher Weise definiert (vgl. OECD-Skala). Eine in Politik und Öffentlichkeit benutzte Angabe der relativen Armutsgrenze ist dabei 50 % oder 60 % des Durchschnittseinkommens. So wird seit 2001 in den Mitgliedsländern der EU derjenige als arm bezeichnet, der weniger als 60 % des Medians hat.
Von Kritikern dieser Festlegung der relativen Armut wird argumentiert, dass sie wenig über den tatsächlichen Lebensstandard der Menschen aussage. Vielmehr ergäben sich Widersprüche bei Anwendung dieser Maßzahl. Wer jetzt weniger als 50 % vom Durchschnittseinkommen zu Verfügung habe, würde auch dann, wenn sich alle Einkommen verzehnfachten, weniger als 50 % vom Durchschnitt haben. Er bliebe also weiterhin relativ arm. Kritisiert wird, dass relative Armutsgrenzen die Armutsproblematik mit der Verteilungsproblematik vermischten. Gelegentlich wird auch kritisiert, dass der Wegzug oder Vermögensverlust eines Reichen den Durchschnitt senken und daher die relative Armut in einem Land verringern würde, und es umgekehrt zu einer Erhöhung der relativen Armut komme, wenn ohne Veränderungen bei anderen Einkommensbeziehern ein Nicht-Armer sein Einkommen steigern kann. Dieser Kritikpunkt trifft aber hauptsächlich bei der Berechnung der Armutsgrenze mittels des arithmetischen Mittels (Durchschnitt im engeren Sinne) zu, und deutlich weniger, wenn, wie bei der Methode der EU, der Median verwendet wird, da der Median auf extreme Ausreißer nicht so sensibel reagiert wie das arithmetische Mittel.
Relative Armut macht sich auch durch eine sozio-kulturelle Verarmung bemerkbar, welche den Mangel an Teilhabe an der Gesellschaft als Folge des finanziellen Mangel meint (wie z.B. Kino, Klassenfahrten, Gesundheit). Soziologen sehen dies teilweise als gravierende gesellschaftliche Herausforderung.
Da eine scharfe Trennung zwischen arm und reich praktisch nicht vorkommt, ist für die relative Armutsgrenze auch der Begriff der Armutsrisikogrenze gebräuchlich.
Sowohl absolute wie auch relative Armutsgrenzen sind nicht ohne normative Vorgaben umzusetzen. Weder die Wahl eines bestimmten Prozentsatzes vom Durchschnittseinkommen zur Bestimmung relativer Armut noch die Bestimmung eines Warenkorbes sind wertfrei begründbar. Darum wird über sie in politischen Prozessen entschieden.
Transitorische und strukturelle Armut
Armut kann zeitweise, oder dauerhaft vorhanden sein. Transitorische (vorübergehende) Armut gleicht sich für den Betroffenen im Verlauf der Zeit wieder aus. Dies ist der Fall, wenn zu bestimmten Zeiten die Grundbedürfnisse befriedigt werden können, aber zu anderen Zeiten nicht. Dies kann durch zyklische Schwankungen, wie Zeiten kurz vor der Ernte, oder auch azyklisch, zum Beispiel durch Katastrophen, auftreten.
Dem entgegen steht der Begriff der strukturellen Armut. Die liegt vor, wenn eine Person einer gesellschaftlichen Randgruppe angehört, deren Mitglieder alle unter die Armutsgrenze fallen, ohne große Chancen, in ihrem Leben aus dieser Randgruppe auszubrechen. Ein Beispiel ist die Bevölkerung von Elendsvierteln. In Verbindung damit wird oft von einem „Teufelskreis der Armut“ oder „Armutskreislauf“ gesprochen: die Nachkommen der in struktureller Armut lebenden Menschen werden ebenfalls ihr Leben lang arm sein (zum Beispiel mangelnde sexuelle Aufklärung, die zu frühen Schwangerschaften führt und eine Ausbildung unmöglich macht, aber auch beispielsweise Diskriminierung wegen der Wohnsituation etc.).
Bekämpfte und verdeckte Armut
„Bekämpfte Armut“ meint verschiedene Maßnahmen insbesondere in den westlichen Industrienationen, in denen versucht wird, die Konsequenzen der Armut abzumildern. Dazu zählen neben der „klassischen“ Bekämpfung durch Sozialleistungen, die kompensatorische Erziehung und die Einrichtung von Suppenküchen, Tafeln, Kleiderkammern und Notunterkünften. Zu dieser so genannten „bekämpften Armut“ kommt noch die „verdeckte Armut“ von Personen, die einen Anspruch auf eine Grundsicherungsleistung hätten, diesen aber nicht geltend machen (siehe auch Dunkelziffer der Armut).
Freiwillig gewählte Armut
Religiöse Gründe für freiwillig gewählte Armut
Ordensleute der römisch-katholischen Kirche legen in der Regel ein Armutsgelübde ab. Das verpflichtet sie, auf persönliche Einkünfte und ein eigenes Vermögen zu verzichten. Dieses Gelübde stellt einen der drei evangelischen Räte dar.
Jesus von Nazaret lebte in freiwillig gewählter Armut. Armut wird im Nadelöhr-Gleichnis zeitweise als zwingende Heilsvoraussetzung interpretiert: Wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen! [...] Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. (Mk 10,17-30). Der heilige Franziskus von Assisi kam aus einem reichen Elternhaus, lebte freiwillig als Bettler und gründete einen Bettelorden. Dessen Mitglieder baten von Haus zu Haus um etwas Geld für Arme.
Armut soll jedoch auch einen tieferen Zugang zu anderen Armen ermöglichen: Während von Reicheren automatisch eine Erleichterung der eigenen materiellen Armut erhofft wird, kann sich der Arme ganz auf das Erleichtern der seelischen Armut bzw. des Verkünden des seelischen Heils konzentrieren.
Philosophische Gründe für freiwillig gewählte Armut
Der Kynismus (griech. κυνισμός, kynismós wörtlich „die Hundigkeit“ im Sinne von „Bissigkeit“, von κύων, kyon „der Hund“) ist eine philosophische Richtung der griechischen Antike und wurden von Antisthenes im 5. Jahrhundert vor Christus begründet. Kernpunkt der Lehre ist die Bedürfnislosigkeit bei gleichzeitiger Ablehnung materieller Güter. Vorurteile sowie Scham vor als natürlich empfundenen Gegebenheiten (z. B. Nacktheit) werden ebenfalls verworfen. Diese Einstellung zeigten sie kompromisslos. Oft lebten Kyniker von Almosen.
Als Stoa (griech. Vorlage:Polytonisch) wird eines der wirkungsmächtigsten philosophischen Lehrgebäude in der abendländischen Geschichte bezeichnet. Tatsächlich geht der Name (griechisch Vorlage:Polytonisch – „bemalte Vorhalle“) auf eine Säulenhalle auf der Agora, dem Marktplatz von Athen, zurück, in der Zenon von Kition um 300 v. Chr. seine Lehrtätigkeit aufnahm. Ein besonderes Merkmal der stoischen Philosophie ist die kosmologische, auf Ganzheitlichkeit der Welterfassung gerichtete Betrachtungsweise, aus der sich ein in allen Naturerscheinungen und natürlichen Zusammenhängen waltendes göttliches Prinzip ergibt. Für den Stoiker als Individuum gilt es, seinen Platz in dieser Ordnung zu erkennen und auszufüllen, indem er durch die Einübung emotionaler Selbstbeherrschung sein Los zu akzeptieren lernt und mit Hilfe von Gelassenheit und Seelenruhe zur Weisheit strebt. Stoiker lehnen materiellen Besitz ab und preisen die Bedürfnislosigkeit.
Armut im geschichtlichen Wandel
Materielle Armut war je nach Zeit und Gesellschaftsform unterschiedlich geprägt. Das Verständnis der Armut und der Umgang mit dieser wird im Folgenden in drei Zeitepochen betrachtet werden:
- Die archaischen Gemeinschaften und die Gabe.
- Das Mittelalter und das Almosen.
- Der Frühkapitalisumus und die Hilfe durch Organisationen.
Archaische Gemeinschaften (ca. 700 v. Chr. – ca. 500 v. Chr)
Die Menschen in diesen Gemeinschaften waren ständig mit Armut konfrontiert, da sie existentiell von der Natur und ihren Früchten abhängig war. Somit war es wichtig, in Gemeinschaften zusammenzuleben um sich gegenseitig helfen zu können. Es wurde ohne Pflichten oder Gegenleistungen einander geholfen, da die eigene Lebenslage auch umkehrbar war und somit die Notwendigkeit der gegenseitigen Hilfe bestand. Die Gabe war demnach ein Austausch unter gleichrangigen Personen und stärkte die sozialen Beziehungen. Eine wechselseitige Austauschbeziehung herrschte folglich vor und das Geben der Gaben war nicht einseitig. Die eigenen Interessen standen hinter dem Wohl und der Verantwortung der Gemeinschaft. Der Reichtum wurde verteilt auf die Gemeinschaft. Hilfeleistungen waren selbstverständlich und nicht fremdmotiviert.
Mittelalter (ca. 600 n. Chr - ca. 1500 n. Chr)
Durch den Feudalismus wurde die Gleichrangigkeit der Personen aufgehoben. Das Almosen war nicht mehr ein wechselseitiges Geben und Nehmen auf gleicher Augenhöhe. Die Gesellschaft wurde hierarchische gegliedert im Lehnswesen. Im Mittelalter galt die Person als arm, welche seine Existenz nicht sichern konnte und weder über Schutz noch Macht verfügen konnte. Die Armut wurde im Verhältnis zur Abhängigkeit gesehen. Hilfe für die Armen wurde anfangs durch die Familie übernommen, später in den Städten durch Zünfte, religiösen Bruderschaften und dergleichen. Durch die Mitgliedschaft wurde eine Unterstützung gewährleistet. Die Kirchen leisteten die größte Hilfe, motiviert aus ihrem Auftrag der Nächstenliebe. Das Almosen wurde von den Besitzenden auch als Mittel zur Buße von Sünde gesehen. Durch die Armen konnten sich die Reichen ihr Seelenheil gewissermaßen erkaufen. Somit war in gewisser Weise doch eine Interdependenz vorhanden jedoch ohne jegliche Gegenleistung. Des Weiteren war das Almosen religiös und freiwillig motiviert. Allerdings wurden die Armen so lediglich als Objekte gesehen, welche keinerlei Beziehungen zueinander hatten. Die Ständeordnung im Mittelalter war als von Gott gegeben angesehen. Somit war die Folge der Ausbeutung kein soziales Problem für die Menschen. Neu war in der Lebenslage Armut nun, dass sie nicht mehr reversibel war. Die Armen waren allerdings in die Gesellschaft integriert.
Frühkapitalismus (Anfang 19. Jahrhundert)
Die Situation für die Armen änderte sich rasch mit dem Aufkommen des Kapitalismus. Bevölkerungsentwicklung und Produktionsentfaltung gingen immer weiter auseinander, was Massenelend zur Folge hatte. Die Hilfeleistungen des Mittelalters, vor allem durch die Kirchen und das Almosen, reichte nun nicht mehr aus, diesem neuen Phänomen entgegen zu wirken und die nachbarschaftliche Hilfe konnte nur gewährt werden, solange die Not noch überschaubar war. Die wechselseitigen Beziehungen zwischen Arm und Reich waren nun völlig von der Bildfläche verschwunden. Der Feudalismus wurde aufgelöst und neue gesellschaftliche Gruppen bündelten die politische und wirtschaftliche Macht. Durch einen noch höheren Ausbeutungsdruck auf die Bauern begann eine Massenflucht in die Städte. Die Situation in den Städten war für diese Personenschicht allerdings alles andere als besser. Neben dem Geld wurde nun auch die Arbeit als neuer Wertmaßstab gesetzt, da die Kapitalbesitzenden auf die Arbeitskraft der kapitalarmen Personen angewiesen waren. Es entstanden immer weitere Unterschiede in ökonomischer und rechtlicher Weise. Breite Bevölkerungsteile wurden unterprivilegiert und an den Rand gestellt, wodurch auch die Beziehungen der Menschen untereinander immer anonymer wurden. Es entstand eine Armut in noch unbekanntem Maße. Vier Armutsgruppen entstanden:
- Die freiwilligen Armen, die anerkannt waren und in religiösen Vereinigungen lebten.
- Die ständischen Armen, die ihre Existenzgrundlage durch Unfälle, Tod des Ernährers, Krankheiten, Katastrophen verloren hatten, aber als ehrbare Menschen galten.
- Die abhängig Dienenden, die keinen Besitz und kein Eigentum hatten und auf Lohnarbeit bzw. Bettelei angewiesen waren.
- Die Standlosen von Geburt, die keine Standeszugehörigkeit hatten.
Die abhängig Dienenden und die Standlosen gehörten zu den diskriminierten Armen. Vor allem Frauen waren von Armut betroffen, da sie nicht erwerbstätig waren bzw. sein durften. Sie waren somit komplett von den reichen Männern der Stadt abhängig. Zu Beginn des 19. Jh. wurden Arme als Parasiten (Schmarotzer) gesehen und die Armut als eine Geißel der Gesellschaft. Armut wurde als Nicht-Arbeit gesehen, weswegen die Armen als arbeitsunwillig, arbeitsscheu und Müßiggänger deklariert wurden. Die Armut wurde demnach verurteilt und als selbst verschuldet, durch eine unmoralische Haltung und ein unsittliches, faules Verhalten bezeichnet. Eine klare Abwertung der Armut und der Armen war die Folge. Somit schwand auch die Verantwortung für die Armen bei den Reichen, da der Zusammenhang von Barmherzigkeit, Armut und Seelenheil verloren gegangen war. Das Almosen wurde dadurch entwertet. Somit wuchs auch die Anonymität, weil die Bevölkerung nichts mehr mit den Armen zu tun hatte und Vorurteile gegenüber den Armen entstanden. Das neue Mittel gegen die Armut war die Arbeit und die Erziehung zur Arbeit. Diese Entwicklung fand in vier Stufen statt:
- Kommunalisierung. Die Armenfürsorge übernahm nun der städtische Rat und die Almosenvergabe unterlag strengen Reglementierungen.
- Rationalisierung. In diesem Schritt wurden Kriterien festgelegt, nach welchen die Armen Unterstützung erhielten. Die Vergabe sollte fortan objektiv bemessen werden.
- Bürokratisierung. Es entstanden Institutionen, welche die Überprüfung der Bedürftigkeit übernahmen. In diesen Institutionen arbeiteten immer mehr hauptberufliche. Das Armutsproblem wurde verwaltet.
- Pädagogisierung. Aus der Sicht der Arbeitenden hatten die Armen ein Defizit, das der Arbeit. Folglich mussten die Armen erzogen werden hin zur Arbeit. Die Armen wurden zum besserungswürdigen Erziehungsobjekt. Hierfür dienten Arbeitshäuser. Nun befand sich die Bekämpfung und der Umgang mit Armut ganz auf der Seite des Staates, was zur Folge hatte, dass sich die Bevölkerung aus der Verantwortung, der Selbstverpflichtung zur Hilfe und Solidarität entzog. Die Schuldfrage nach Armut wurde individualisiert. Eine Hierarchisierung und Distanzierung zwischen Arm und Reich wurde immer stärker und aus dem christlich motiviertem Liebesakt wurde ein nüchterner Verwaltungsakt.
Ursachen
Als Hauptursachen für Armut werden genannt:
- Kriege und Bürgerkriege,
- politische Strukturen (zum Beispiel Diktatur, ungerechte internationale Handelsregeln),
- ökonomische Strukturen (ungleiche Einkommensverteilung, Korruption, Überschuldung, Ineffizienz, Mangel an bezahlbarer Energie),
- Staatsversagen,
- technologische Rückständigkeit,
- Bildungsrückstand,
- Kinder [3][4][5],
- Naturkatastrophen,
- Epidemien und
- zu starkes Bevölkerungswachstum.
Hauptrisikofaktoren von relativer Armut sind Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung, auch als Folge fehlender Betreuungsmöglichkeiten für Kleinkinder. Alleinerziehende hatten in Deutschland im Jahr 2003 mit 35,4% das zweithöchste Armutsrisiko. Als Risikofaktoren gelten weiterhin stark ungleiche Einkommensverteilung, Bildungsmangel und chronische Erkrankungen. Bis ins 19. Jahrhundert hinein wurde Armut überwiegend nicht als gesellschaftlich verursacht, sondern als individuell verschuldet oder „gottgewollt“ betrachtet.
In Europa setzte sich im Zuge der Industrialisierung und der Auseinandersetzung um die Soziale Frage die Auffassung durch, dass Armut durch staatliche Maßnahmen verringert werden kann. Armutsbekämpfung stand etwa im Vereinigten Königreich am Ausgangspunkt der modernen Sozialpolitik. Inzwischen wird die Wirksamkeit sozialpolitischer Armutsbekämpfung aber in vielen Industrieländern durch neue Erscheinungsformen von Armut in Frage gestellt. Insbesondere hat sich gezeigt, dass auch eine zu hohe Staatsquote zu hoher Arbeitslosigkeit führen kann (insbesondere in Westeuropa).
Nach der Philosophie der Lebendigen Ethik (östliche Bezeichnung: Agni Yoga) ist Ursache der Armut, dass die Menschen nicht teilen wollen: In einer Ordnung, in der die Schätze der Natur und die Erzeugnisse der menschlichen Arbeit gerecht verteilt werden, kann es keine Armut geben.
Konzepte zur Bekämpfung der Armut
Der Friedensnobelpreisträger und Ökonom Muhammad Yunus schlägt vor, neben rein Profit maximierenden Unternehmen auch soziale Unternehmen einzuführen, deren Ziel es nicht ist, Profit zu erwirtschaften, sondern die Welt positiv zu verändern. Investoren in diese Firmen bekämen später ihr Geld zurück, jedoch ohne Dividende. Stiftungsaktivitäten von bestehenden Firmen könnten so in diese Richtung gelenkt werden. Nach Ansicht von Yunus wäre dies eine Lösung im Kampf gegen Armut. Armut hält Yunus als Bedrohung für den Weltfrieden. [6]
(Absolute) Armut weltweit

Nach Angaben der Weltbank hatten im Jahr 2001 weltweit ca. 1,1 Mrd. Menschen (entspricht 21% der Weltbevölkerung) weniger als 1 US-Dollar in lokaler Kaufkraft pro Tag zur Verfügung und galten damit als extrem arm. (Zum Vergleich: 1981 waren es noch 1,5 Mrd. Menschen, damals 40 % der Weltbevölkerung; 1987 1,227 Mrd. Menschen entsprechend 30 %; 1993 1,314 Mrd. Menschen entsprechend 29 %).
Die größte Zahl dieser Menschen lebt in Asien; in Afrika ist allerdings der Anteil der Armen an der Bevölkerung noch höher. Die Mitglieder der UN haben sich beim Millenniumsgipfel im Jahr 2000 auf das Ziel geeinigt, bis zum Jahr 2015 die Zahl derer, die weniger als 1 US-Dollar am Tag haben, zu halbieren (Punkt 1 der Millenniums-Entwicklungsziele). Nach Angaben der Weltbank vom April 2004 kann dies gelingen, allerdings nicht in allen Ländern. Während durch einen wirtschaftlichen Aufschwung in Teilen Asiens der Anteil der Armen deutlich zurück ging (in Ostasien von 58 auf 16 Prozent), hat sich in Afrika die Zahl der Ärmsten erhöht (in Afrika südlich der Sahara von 1981 bis 2001 fast verdoppelt). In Osteuropa und Zentralasien wurde eine Zunahme der extremen Armut auf 6 Prozent der Bevölkerung errechnet. Zieht man die Armutsgrenze bei zwei US-Dollar pro Tag, gelten insgesamt 2,7 Milliarden Menschen und damit fast die Hälfte der Weltbevölkerung als arm.
(Relative) Armut in Deutschland
Das vom Statistischen Bundesamt errechnete monatliche Nettoäquivalenzeinkommen betrug 2002 in den westdeutschen Ländern 1217 Euro, in den ostdeutschen Ländern 1008 Euro. Nach den EU-Kriterien für die Armutsgrenze (60 %) liegen die Armutsgrenzen demnach bei 730,20 Euro für den Westen und 604,80 Euro für den Osten. In der Regel liegt das sozio-kulturelle Existenzminimum, das auf der Basis von Verbraucherbefragungen des Statistischen Bundesamtes durch die Bundesregierung festgelegt wird, noch unter dieser Grenze.
Nach Zahlen aus dem „Zweiten Armuts- und Reichtumsbericht“, den die Bundesregierung im März 2005 vorgelegt hat, galten im Jahr 2003 13,5 Prozent der Bevölkerung als in relativer Armut lebend. 2002 waren es nach diesen Angaben noch 12,7 Prozent, 1998 12,1 Prozent. Mehr als ein Drittel der in relativer Armut lebenden sind allein Erziehende und ihre Kinder. 19 Prozent sind Paare mit mehr als drei Kindern.

Eine weitere Gruppe, die von (relativer) Armut betroffen sein kann, sind Studenten. Da Studenten keine Sozialleistungen beziehen können, leben viele von ihnen unterhalb der offiziell festgelegten Armutsgrenze.[7] In Wohngemeinschaften lebende Studenten werden jeweils als Einpersonenhaushalt gezählt, solange jeder für sich selbst wirtschaftet. Dieser Umstand, wie auch die Zahl allein lebender Studenten, treibt den Anteil der von Armut betroffenen Einpersonenhaushalte in die Höhe (siehe Abbildung). Man geht davon aus, dass ohne Einbezug der Studenten die Zahl armer Einpersonenhaushalte sehr gering wäre.
Kinder und Jugendliche haben in Deutschland ein hohes Risiko in relativer Armut zu leben. 15 Prozent der Kinder unter 15 Jahren und 19,1 Prozent der Jugendlichen zwischen 16 und 24 Jahren sind betroffen. Die meisten dieser armen Kinder leben bei alleinerziehenden Müttern. Die Zahl der Kinder in Deutschland, die von Sozialhilfe leben, stieg 2003 um 64.000 auf 1,08 Millionen und hat 2004/2005 1,45 Millionen erreicht. Im Jahre 2006 verdoppelte sich die gemessene Zahl von Kindern, die auf Sozialhilfeniveau leben, gegenüber 2004 nach Angaben des Kinderschutzbundes mit Berufung auf eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit auf 2,5 Millionen von 15 Millionen, also eines von sechs in Deutschland lebenden Kindern bis 18 Jahren. Dieser Zahl liegen genauere Daten als früheren Schätzungen zugrunde.[8]
Nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef wächst die Armut von Kindern in Deutschland stärker als in den meisten anderen Industrieländern. Dabei sind starke regionale Unterschiede festzustellen. So sind nach Forschungen der Ruhr-Uni Bochum im reichen Bayern nur 6,6% der Kinder als arm zu bezeichnen, in Berlin hingegen 30,7% (als Indikator für Armut galt der Bezug von Sozialgeld).[9]
Regionale Verteilung von Armut in den verschiedenen Bundesländern
Die Armutsquoten sind in den verschiedenen Bundesländern höchst unterschiedlich. In den nördlichen und östlichen Bundesländern sind die Armutsquoten am höchsten.
(Anmerkung zur Tabelle: Unter Wissenschaftlern herrscht ein Streit darüber, ob der Bezug von Sozialleistungen ein guter Armutsindikator ist. Einige argumentieren, dass wer Soziallleistungen beziehe nicht mehr arm sei, da die Sozialleistungen das kulturelle Existenzminimum sichern würden. Die meisten Wissenschaftler schließen sich dieser Meinung nicht an)
| Bundesland | Anteil Kinder, die Sozialleistungen beziehen (Sozialgeld) | Anteil Armer an der Gesamtbevölkerung (gemessen am Bezug von Sozialleistungen ALGII und Sozialgeld) |
|---|---|---|
| Bayern | 6,6% | 3,9% |
| Baden-Württemberg | 7,2% | 4,1% |
| Rheinland-Pfalz | 9,9% | 5,5% |
| Hessen | 12,0% | 6,5% |
| Niedersachen | 13,5% | 7,6% |
| Nordrhein-Westfalen | 14,0% | 8,1% |
| Saarland | 14,0% | 7,4% |
| Schleswig-Holstein | 14,4% | 8,2% |
| Hamburg | 20,8% | 10,6% |
| Thüringen | 20,8% | 10,4% |
| Brandenburg | 21,5% | 12,0% |
| Sachsen | 22,8% | 11,8% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 27,8% | 14,9% |
| Sachsen-Anhalt | 27,9% | 14,2% |
| Bremen | 28,1% | 13,8% |
| Berlin | 30,7% | 15,2% |
Gesundheitliche Konsequenzen
Armut hat in der BRD Konsequenzen für den Gesundheitszustand.[12] Nach Angaben von Prof. Dr. Klaus Peter Strohmeier, Professor an der Ruhr-Uni Bochum, sind 80% der Jugendlichen in den bürgerlichen Vierteln Bochums gesund. In den Großsiedlungen sind es nur 10 bis 15 Prozent. Als Krankheiten, die mit Kinderarmut einhergehen, nennt er vor allem Übergewicht und motorische Störungen.[13] Winkler stellt fest, dass auch bei den Erwachsenen Arme häufiger unter Übergewicht leiden, sie rauchen häufiger und treiben weniger Sport. Die Folge sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen.[14] Winkler und Stolzenberg konnten nachweisen, dass Arme häufiger von Lungenkrebs, Bluthochdruck, Herzinfarkt, Durchblutungstörungen im Gehirn, Durchblutungsstörungen in den Beinen, Diabetes Typ II, Bandscheibenschäden und Hepatitis betroffen waren als Nichtarme.[15] Ein Grund hierfür wird in der Gratifikationskrise gesehen.
Kinderarmut
Bei der Kinderarmut[16] in Deutschland können laut AWO-Studie[17] neun Dimensionen unterschieden werden:
- Materielle Armut, ein Teil davon ist die finanzielle Armut, anteilig am jeweiligen Haushaltseinkommen (siehe oben Armutsdefinitionen)
- Bildungsbenachteiligung
- Geistige/kulturelle Armut
- Soziale Armut
- Fehlende Werte
- Seelische/emotionale/psychische Armut
- Vernachlässigung
- Falsche Versorgung
- Ausländerspezifische Benachteiligung
Seit dreißig Jahren lässt sich in Deutschland ein Anstieg der Kinderarmut beobachten.
Die Studie Kinderreport 2007 des Deutschen Kinderhilfswerks zurfolge ist inzwischen jedes 6. Kind in Deutschland auf Sozialhilfe angewiesen. Der Trend sei dramatisch, da sich jedes 10. Jahr die Zahl von Kindern in Armut in Deutschland verdoppele. 1965 war jedes 75. Kind unter sieben Jahren auf Sozialhilfe angewiesen, 2007 sei es jedes 6. Kind. Besonders betroffen seien Kinder aus Einwanderfamilien[18]
Psychosoziale Auswirkungen von Armut auf Kinder
In relativer Armut aufzuwachsen hat in Deutschland einen erheblichen Einfluss auf die Bildungschancen, was unter anderem die jüngste AWO-Studie nachwies. In einigen armen Stadtteilen verlässt jeder dritte die Schule ohne Abschluss.[19]
Aus einer Studie, die vom Kinderhilfswerk World Vision finanziert wurde und für die 1.600 Kinder befragt wurden, geht hervor, dass sich Kinder aus sozial schwachen Elternhäusern sich schon im Alter von 8 bis 11 Jahren für den Rest ihres Lebens benachteiligt fühlen. Es handelt sich um die erste umfassenden Milieustudie von Kindern dieser Altersgruppe. Der Sozialwissenschaftler Klaus Hurrelmann kommentierte: Die schlechten Startchancen "prägen alle Lebensbereiche und wirken wie ein Teufelskreis. Wie ein 'roter Faden' zieht sich eine Stigmatisierung und Benachteiligung dieser Kinder durch das ganze Leben hindurch". Des Weiteren belegte die Studie, dass Kinder aus sozial schwachen Schichten häufig auf sich allein gestellt seien. Da der Rückhalt, Anregungen oder gezielte förderung fehle, sei der Alltag dieser Kinder häufig einseig aus Medienkonsum ausgerichtet. Die Mitautorin der Studie, Sabine Andresen, stellte zudem heraus, dass die Klassengesellschaft keine neue Entwicklung sei. (Anm.: siehe hierzu auch Punkt 2: "Armut im geschichtlichen Wandel") Erschreckend sei aber, wie sich in einem reichen Land wie Deutschland die Armut von Kindern «eklatant» auf ihre Biografien auswirke. Die Forscher stellten fest, dass viele Eltern mit der Erziehung überfordert seien. Deswegen müssten alle Bereiche der Gesellschaft helfen, die Kinder stark zu machen. [20]
Altersarmut
Im Gegensatz zur Entwicklung der Kinderarmut ist die Altersarmut in Deutschland rückläufig: von 13,3 Prozent 1998 auf 11,4 Prozent im Jahr 2003. Längerfristig wird hier ein Wiederanstieg erwartet, weil die derzeit vielen Arbeitslosen, Teilzeitbeschäftigten, Minijobber und Geringverdienenden geringere Renten bekommen werden und allgemein das Rentenniveau aller zukünftigen Rentner (und aller heutigen Arbeitnehmer) im Zuge der Rentenreform gesenkt wurde. Einer Studie zufolge, die das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA) 2005 vorlegte, droht nahezu jedem dritten Bürger Verarmung im Alter. Grund sei neben der steigenden Lebenserwartung, die Reformen von 2001 und 2004, die das gesetzliche Rentenniveau um rund 18 Prozent sinken ließen und die fehlende Bereitschaft zu privater Altersvorsorge, die viele Bürger nicht zahlen wollen oder können (etwa 60%). Der Sozialexperte des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Deutschland Ulrich Schneider äußerte im November 2006 seine Befürchtung: „Die Altersarmut wird deutlich zunehmen“. [21]
Diskurs: Vermeidung des Armutsbegriffs in der BRD
Obschon die Armut in Deutschland steigt, wird sie selten als Armut benannt. In den letzten Jahren wird stellvertretend der Begriff sozial schwach benutzt, zunehmend auch in der substantivierten Form Sozialschwache. Der Begriff ist schillernd und lässt sich interpretieren sowohl als Hinweis auf die schwache gesellschaftliche Stellung als auch auf einen Mangel an sozialer Kompetenz; im letzteren Fall - so eine Kritik - setzt dieser Begriff euphemistisch die Zuschreibung „asozial“ fort. Die Arbeiterwohlfahrt lehnt die Verwendung der Bezeichnung „sozial schwach“ ab, da es ihrer Auffassung nach einen Mangel an sozialer Kompetenz vortäusche. „Diese ‚sozial Schwachen‘“, so ihr Bundesvorsitzender Wilhelm Schmidt, „sind alles andere als sozial schwach. Von den meisten [finanzschwachen] Eltern wird eine nur schwer vorstellbare Stärke verlangt, ihre Situation täglich zu bewältigen und für ihre Kinder zu sorgen.“ In der Armuts- und Bildungsforschung wird dieser Begriff ebenfalls vermieden.
Ähnlich umstritten ist der Begriff Unterschicht oder Neue Unterschicht. Eine demoskopische Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung löste im Oktober 2006 eine starke Debatte aus, da festgestellt worden ist, dass 8% der Bevölkerung zum „abgehängten Prekariat“ zu zählen sind. Diese Debatten wurde die „Unterschichten-Debatte“ genannt, obschon der Begriff „Unterschicht“ in der Studie vermieden wurde. Im gleichen Zeitraum kam eine vergleichende Studie der Hans-Böckler-Stiftung zum Resultat, dass Deutschland unter 24 europäischen Staaten den Platz 21 auf der Sozial-Rangliste einnahm. In diese Studie flossen die Kriterien Einkommensverteilung und soziale Absicherung, Arbeitsmarkt, Bildungs- und Ausbildungschancen, Geschlechtergleichstellung und Generationenverhältnis ein.
Armut als bröckelndes Tabuthema
Seit der Umsetzung der Hartz-IV Reform wird öffentlich über das Thema, vor allem sog. Kinderarmut diskutiert. Gleichzeitig sind betroffene "Hartz-IV-Familien" immer wieder Thema in Printmedien und TV. Dies führte zu kontroversen Diskussionen in der Öffentlichkeit: frühere Tabuthemen, wie Arbeitslosigkeit und Armut sind in gewisser Hinsicht gesellschaftsfähig geworden. Das Bild des sich versteckenden, arbeitslosen Familienvaters (der vielleicht noch zur Täuschung der Nachbarn in der Früh das Haus verlässt) wird zusehends seltener. Vielmehr bekennt man sich zu seinen Problemen.
Armut in anderen Ländern
Armut in der Schweiz
Trotz wirtschaftlichen Wachstums gibt es auch in der Schweiz Armut. 2005 waren rund 237’000 Personen auf staatliche Unterstützung angewiesen. Die Sozialhilfequote lag somit bei 3,3 Prozent. Auf dem Land war die Sozialhilfequote niedriger als in der Stadt. Das Sozialhilferisiko ist stark von der Familienform abhängig. Besonders gefährdet sind Kinder und Jugendliche, die mit einem Elternteil oder in kinderreichen Familien aufwachsen. Kinder und Jugendliche sind besonders häufig arm. Sie sind unter den Sozialhilfe beziehenden Personen mit einem Anteil von 31 Prozent deutlich übervertreten. Ihr Anteil an der Bevölkerung beträgt nur 21 Prozent. Überdurchschnittlich oft geraten allein Erziehende in Armut: Fast 17 Prozent der Haushalte mit nur einem Elternteil bezog 2005 Sozialhilfe.[22]
Armut in Österreich

Nach Angaben des Sozialministeriums („Bericht über die soziale Lage 2003-2004“) waren 2003 in Österreich über eine Million Menschen (13,2 Prozent der Bevölkerung) armutsgefährdet, das heißt, von Einkommensarmut betroffen. Im Jahr 2002 waren es noch 900.000 oder 12 Prozent, 1999 11 Prozent. Als Armutsgefährdungsschwelle gelten 60 Prozent des mittleren Einkommens (Medianeinkommen). Etwa jede/r Achte muss demnach mit weniger als 785 Euro monatlich auskommen.
Frauen sind (mit 14 Prozent) leicht überproportional armutsgefährdet.
Neben der Einkommensarmut als Indikator für die finanzielle Situation eines Haushalts wird in Österreich von „akuter Armut“ gesprochen, wenn zusätzlich zur finanziellen Benachteiligung gewisse Mängel oder Einschränkungen in grundlegenden Lebensbereichen auftreten (zum Beispiel Zahlungsrückstände bei Miete, oder wenn Heizung, Urlaub, neue Kleider, Essen, unerwartete Ausgaben nicht leistbar sind). Von akuter Armut waren 2003 467.000 Menschen (5,9 Prozent der Bevölkerung) betroffen. Im Jahr davor waren es noch 300.000 Menschen oder 4 Prozent. Nach einem Bericht der Armutskonferenz sind erstmals Daten über so genannte Working Poor verfügbar: in Österreich seien 57.000 Menschen (2003) von Armut trotz Arbeit betroffen. Des weiteren hängt der Grad der Armutsgefährdung von der Art des Beschäftigungsverhältnisses ab:
- Teilzeitbeschäftigte mit bis zu 20 Stunden wöchentlicher Arbeitszeit haben ein dreifaches, bei 21 bis 30 Stunden ein doppelt so hohes Risiko armutsgefährdet zu sein, als Personen, die zwischen 31 und 40 Stunden beschäftigt sind.
Des weiteren kritisiert der Schattenbericht der Armutskonferenz zum 2. Nationalen Aktionsplan für soziale Eingliederung 2003–2005 der österreichischen Bundesregierung, dass Langzeitarbeitslose und Migranten und Migrantinnen in diesem Plan vollkommen fehlten.
Siehe auch: Leben im Wiener Untergrund
Armut in den USA
Nach Angaben des Armutsberichts des Amts für Volkszählungen vom August 2005 ist in den USA die Zahl der Menschen mit Einkommen unterhalb der Armutsgrenze 2004 zum vierten Mal in Folge angestiegen. 12,7 Prozent der Bevölkerung oder 37 Millionen Menschen seien arm. Dies ist ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr von 0,2 Prozentpunkten. Der Anstieg sei vor allem auf den höheren Anteil von Weißen zurückzuführen. Als arm gilt eine vierköpfige Familie, wenn sie weniger als rund 19.310 Dollar im Jahr ausgeben kann. Für Alleinstehende liegt die Grenze bei etwa 9.650 Dollar.
Wie in allen Industrieländern sind Kinder in den USA die Gruppe, die am häufigsten arm ist. Jedoch mit abnehmender Tendenz.
| Kinderarmutsrate verschiedener ethnischer Gruppen in den USA | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Insgesamt | Afroamerikaner | Hispanics |
| 1996 | 20,5% | 39,9% | 40,3% |
| 2001 | 16,3% | 30,2% | 28,0% |
| http://www.acf.hhs.gov/programs/ofa/annualreport5/chap09.htm | |||
Schon seit den 1990er Jahren gibt es in Amerika nicht mehr die Sozialhilfe, wie wir sie kennen. 1992 wurde die so genannte Family Cap in New Jersey eingeführt. Frauen, die schwanger werden, während sie staatliche Unterstützung bekommen, bekommen keine zusätzliche staatliche Unterstützung für das weitere Kind. Heute haben 22 Bundesstaaten der USA Family Caps.[23]
Der Personal Responsibility and Work Opportunity Act (PRWORA) von 1996 regelte die staatliche Sozialfürsorge neu und fasste bisherige Wohlfahrtsleistungen zu einem einzigen Programm, dem Temporary Assistance for Needy Families (TANF), zusammen und setzte enge Zeitgrenzen, insbesondere eine auf das Gesamtleben bezogene Maximalgrenze von fünf Jahren, für aus Bundesmitteln finanzierte Sozialhilfe [24]. Nach zweijährigem Bezug müssen Fürsorgeempfänger, um weiter Leistungen zu erhalten, mindestens 30 Wochenstunden Arbeitsdienst in öffentlichen Arbeitsprogrammen leisten [25]. Diese mit Arbeitsverpflichtung verknüpfte Sozialfürsorge wird auch als Workfare bezeichnet. Die Sozialleistungen können dabei, pro Stunde betrachtet, auch unter dem Mindestlohn liegen. Die Reform führte lauf Kritikern zu einer Zunahme der Beschäftigungszahlen, jedoch nicht zu einer Zunahme der sozialen Mobilität. Viele andere ehemalige Sozialhilfeempfänger erweisen sich in den Worten des Ökonomen Paul Samuelson zudem als »nicht beschäftigungsfähig und schlechter dran ohne kontinuierliche Sozialhilfe«. Zu ihnen zählen vor allem wenig gebildete Niedriglohnarbeiter ohne Arbeitserfahrung, soziale Problemfälle, geistig Behinderte, Drogenabhängige. Für andere dagegen hat sich die Lage gebessert. [26].
Befürworter der Reformen weisen darauf hin, dass durch TANF und die Family Cap die Anzahl armer Kinder abgenommen habe[27] Kritiker wiesen schon früh darauf hin, dass diese Abnahme der Kinderarmut vor allem durch eine Zunahme der Abtreibungen zu erklären sei und nicht dadurch, dass die Eltern in die Lage versetzt worden wären für ihre Kinder zu sorgen[28]. Allein zwischen 1992 und 1996 brachten in New Jersey Frauen, die Sozialhilfe bezogen, 14057 weniger Kinder zur Welt, als statitisch bei gleich bleibender Geburtanrate zu erwarten gewesen wäre, bei 1429 mehr Abtreibungen als zu erwarten[29]
Armutsforschung
In den 1950er Jahren entstand in den USA die Armutsforschung. Als erster wichtiger Armutsforscher gilt der US-amerikanische Anthropologe Oscar Lewis. Dieser erforschte die Lebensbedingungen in mexikanischen Slums. Für die Lebensweise, die er dort vorfand prägte den Begriff „culture of poverty“. Nach Lewis ist die Lebensweise der Armen geprägt von Denk- und Handlungsmustern, die von Generation zu Generation innerhalb der kulturellen Einheit weiter vererbt werden. Diese Kultur der Armut zeichnet sich dadurch aus, dass die Armen nach sofortiger Befriedigung ihrer Bedürfnisse streben. Sie sind nicht in der Lage, ein Bedürfnis zurück zu stellen, um später davon zu profitieren. So investieren die Armen zum Beispiel nicht in ihre Ausbildung und auch nicht in die Ausbildung ihrer Kinder. Das führt dazu, dass auch die nächste Generation arm sein wird. Die einzige Möglichkeit die Armut zu beenden sind laut Lewis von außen kommende Interventionen, etwa durch kompensatorische Erziehung [30],[31]
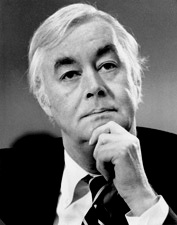
Daniel Patrick Moynihan hat Lewis Konzept auf die USA und andere westliche Industrienationen übertragen. Er argumentiert, dass Arme die Gegenwart mehr wertschätzen würden als die Zukunft. Dies würde zu einem Verfall der Familie führen. Die Kinder würden deshalb schlecht sozialisiert und ein Teufelskreislauf der Armut beginne.[32]
Als Kritik auf die Forschungen von Moynihan warf William Ryan ihm vor die Schuld auf das Opfer zu schieben (blaming the victim). Die Armen sind, laut Ryan, Opfer gesellschaftlicher Missstände gegen die sie wegen ihrer marginalen Position nichts unternehmen können. Ihr Verhalten ist nur eine Reaktion auf diese Opfer-Position [33]
Der Psychologe Martin Seligman stellte die These auf, dass die Armen unter erlernte Hilflosigkeit leiden. Ihre Lebensumstände würden sie dazu verleiten, persönliche Entscheidungen als irrelevant wahrzunehmen. Laut Seligman betrachten Personen in einem Zustand der erlernten Hilflosigkeit Probleme als persönlich, generell oder permanent:
- persönlich - Sie sehen (in) sich selbst als das Problem.
- generell - Sie sehen das Problem als allgegenwärtig und alle Aspekte des Lebens betreffend.
- permanent - Sie sehen das Problem als unveränderlich.
Daraus ziehen sie die Schlussfolgerung, dass es nichts bringt, etwas gegen ein Problem zu unternehmen und unternehmen nichts. Erlernte Hilflosigkeit kommt in allen Schichten vor, ist jedoch in den unteren Schichten besonders häufig. Dies kommt, weil die Leute dieser Schichten mehr negative Erfahrungen machen, als die Leute höherer Schichten. Erlernte Hilflosigkeit kann überwunden werden. Der Betroffene muss sich klar machen, dass er unter erlernter Hilflosigkeit leidet. Er muss sich klar machen, dass er über Handlungskompentenzen verfügt und sein Leben selbst in die Hand nehmen kann. Dabei kann die Psychotherapie helfen.[34]
Der wohl umstrittenste Armutsforscher ist der US-amerikanische Politologe Charles Murray. In seinem Buch Losing Ground teilt Murray Arme in zwei Schichten ein. Die „working class“ (Arbeiterschicht) und die „underclass“ (Unterschicht). Die Unterschicht wird von ihm auch als „dangerous class“ (gefährliche Schicht) oder „undeserving poor“ (Übersetzung in etwa: Arme, die es nicht verdient haben, dass man ihnen hilft) bezeichnet. Diese „undeserving poor“ zeichnen sich laut Murray durch mangelnde Selbstdisziplin aus. Sie hätten nicht den Ehrgeiz ihren Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, sondern würden lieber von Almosen leben. Die underclass hätte sich als Reaktion auf zu hohe Sozialleistungen entwickelt. Einige Leute hätten die Sozialhilfe zu ihrem Lebensstil gemacht. Als natürlichen Feind der „undeserving poor“ sieht Murray die „working class“ an, denn diese würden den Lebensstil der underclass finanzieren, was aber noch schlimmer sei, die underclass würde durch ihren Lebensstil die Kinder der Arbeiterschicht verderben, die die falschen Werte der underclass übernehmen würden.[35] Später gelangte Murray zu der Auffassung, dass Armut vor allem durch niedrige Intelligenz zustande käme. Er schrieb zusammen mit Richard Herrnstein das umstrittene Buch The Bell Curve, in dem auch davon die Rede ist.
Resilienzforschung
Als Reaktion auf die Armutsforschung entstand in den USA die Resilienzforschung. Unter Resilienz wird die Fähigkeit verstanden, schwierige Lebenssituationen unbeschadet zu überstehen. Resilienzforscher wie zum Beispiel Caplan oder Haines beklagen, dass zu sehr die Schwächen armer Familien und Personen und zu wenig die Stärken gesehen würden. Als Stärken einiger armer Bevölkerungsgruppen gelten Familienzusammenhalt, Kollektivismus und Leistungsmotivation. Die Resilienzforschung betrachtet, welche Fähigkeiten ein Individuum haben muss, um konstruktiv mit Armut umgehen zu können. Sie hat einzelne ethnische und soziale Gruppen ausfindig gemacht, die es trotz Armut zu etwas bringen. So erbrachten etwas die Kinder vietnameischer Boat People in den USA bessere Leistungen als Kinder der amerikanischen Mittelschicht [36]. Die jüdische Minderheit wurde innerhalb von zwei Generationen von einer äußerst armen zu einer äußerst reichen ethnischen Gruppe. Kinder aus amerikanischen Mittelschichtsfamilien, die durch die große Depression verarmt waren, wuchsen zu leistungsstarken und gesetzestreuen Bürgern heran [37]. In Deutschland machen vor allem die Kinder der vietnamesischen Vertragsarbeiter trotz Armut mit guten Schulleistungen auf sich aufmerksam[38],[39],[40]. Die griechische Minderheit hat innerhalb von zwei Generationen ihren Weg aus der Armut in die Mitte der Gesellschaft gefunden. Ebenso sieht es mit der spanischen Minderheit aus.
Weiterführende Informationen zur Resilienzforschung sind auf entsprechender Seite zu finden.
Hat Armut immer Konsequenzen?
Arme Bevölkerungsgruppen werden oft einseitig als Problem betrachtet. Dass dies nicht zwangsläufig so ist zeigt zum Beispiel ein Blick auf die vietnamesische Bevölkerungsgruppe in Ostdeutschland. Obwohl diese Bevölkerungsgruppe in Armut lebt und die meisten Eltern nur eine geringe formale Bildung haben, erwiesen sich ihre Kinder als erfolgreich in der Schule. [41][42],[43],[44] Leisering kam zu der Auffassung, dass materielle Armut besonders unter zwei Bedingungen schädliche Auswirkungen auf das Leben von Heranwachsenden hat:
1) Es handelt sich um langdauernde Armut im Gegensatz zur kurzfristigen Armut
2) Die materielle Armut geht mit Bildungsarmut einher
Sind diese zwei Bedingungen nicht erfüllt, dann sind die Auswirkungen der Armut weniger schlimm oder können auch vollkommen ausbleiben[45]
Auswirkung auf Persönlichkeit
Verschiedene Forscher stellten Auswirkungen der Armut auf die Persönlichkeit fest.
Ronald Inglehart stellte die These des Wertewandels auf. Nach Inglehart entwickeln Menschen während ihrer Jugend eine materialistische/postmaterialistische Einstellung. Seine Theorie besagt, dass bei steigendem Wohlstand einer Gesellschaft der Materialismus (z.B. Neigung zu Sicherheit und Absicherung der Grundversorgung) abnimmt während der Postmaterialismus (z.B. Neigung zu politischer Freiheit, Umweltschutz) zunimmt. Zur statistischen Verifikation der Theorie wurde von Inglehart der sogenannte Inglehart-Index geschaffen. Der Index ist bei Sozialwissenschaftlern methodologisch umstritten. Zudem widerlegen empirische Studien die eindimensionale Entwicklung die Inglehart vorhersagte (z.B. Klein 95). Nach Inglehart ist die heutige Generation postmaterialistischer als vorangegangene Generationen. Das kommt, weil sie in größerem Wohlstand aufwuchs.
Helmut Klages war der Meinung, dass in Armut aufgewachsene Genrationen eher zu Pflicht-/und Akzeptanzwerten neigen würden. Zu den Pflicht und Akezeptanzwerten zählen zum Beispiel Pflichterfüllung, Fleiß, Selbstlosigkeit und Hinnahmebereitschaft. In Reichtum aufgewachsene Generationen würden eher zu Selbstverwirklichungswerten neigen. Dazu zählen z.B. Spontaneität und Selbstverwirklichung.[46],[47]
Pierre Bourdieu war der Meinung, dass Arme einen anderen Habitus (Soziologie) hätten als nicht Arme, den sogenannten Habitus der Notwendigkeit.
Armut und Natur
Armut ist in vielen Teilen der Welt auch eine der wichtigsten Ursachen für Gefährdung und Zerstörung der Natur. Die in der Armut begründeten schwerwiegenden Nöte und Probleme lassen den Umweltschutz in den Hintergrund treten. Die für den Schutz mitunter notwendigen finanziellen Mittel können in Regionen mit großer Armut nicht aufgebracht werden. Klaus Töpfer, der Leiter der UNO-Umweltbehörde UNEP, bezeichnete Armut als „das größte Gift für die Umwelt“; Erfolge im Umweltschutz setzten eine Bekämpfung der Armut voraus.
Literatur
- Bliemetsrieder, Sandro: Kinderarmut und krisenhafter Grundschulalltag. Sozioanalytische Fallrekonstruktionen als Orientierungshilfe für die Grundschulpädagogik und Soziale Arbeit/Sozialpädagogik. Herbert Utz Verlag, München 2007, ISBN 978-3-8316-0714-3.* Bräuer, Helmut (Hg.) Arme - ohne Chance? Kommunale Armut und Armutsbekämpfung vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart, Leipzig 2004, ISBN 3-937209-49-2.
- Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Lebenslagen in Deutschland - Der 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. 2005. Download ohne Zahlen-Anhang / Pdf-Datei 1,8 MB- Pressetext dazu, kurz.
- Deutsches Kinderhilfswerk: Kinderreport Deutschland 2007 November 2007
- Edelstein, Wolfgang: Bildung und Armut: Der Beitrag des Bildungssystems zur Vererbung und zur Bekämpfung von Armut. In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung, Jhrg. 26, 2006, Nr. 2, S. 120-134
- Geremek, Bronislaw: Geschichte der Armut. Elend und Barmherzigkeit in Europa, München und Zürich 1988, ISBN 3-7608-1917-6.
- Hines, Gerald: Armut - Pauperismus - Gewerkschaften : die Praxis der deutschen Gewerkschaften, sich nicht mit der Armut zu beschäftigen, Leipzig : AVA, Akad. Verl.-Anst., 2002
- Kelmeling, Åsa und Knöpfel, Carlo: Weniger Familienarmut durch bessere Zusammenarbeit? Stand der Zusammenarbeit zwischen öffentliche, privaten und kirchlichen Einrichtungen im Bereich Familienarmut im Kanton Zürich. Caritas-Verlag, 2006. ISBN 3-85592-095-8.
- Loccumer Initiative kritischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (Hrsg.): Armut als Bedrohung. Der soziale Zusammenhalt zerbricht. Ein Memorandum. Mit einer Einführung von Oskar Negt Hannover 2002, ISBN 3-930345-35-8
- Mardorf, Silke: Konzepte und Methoden von Sozialberichterstattung. Eine empirische Analyse kommunaler Armuts- und Sozialberichte. Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2006
- Mollat, Michel: Die Armen im Mittelalter, München 1984.
- Oexle, Otto Gerhard (Hg.): Armut im Mittelalter, Ostfildern 2004, ISBN 3-7995-6658-9.
- Ostertag, Marta und Knöpfel, Carlo: Einmal arm - immer arm? Lebensgeschichten zur sozialen Vererbung und Mobilität in der Schweiz. Caritas-Verlag, 2006, ISBN 978-3-85592-103-4.
- Rügemer, Werner: Arm und reich. 2. Auflage, Transcript Verlag, Bielefeld 2003, ISBN 3-933127-92-0.
- Sachs, Jeffrey: Das Ende der Armut, Siedler Verlag 2005, ISBN 3886808300.
- Wißmann, Hans und Michel, Diethelm und andere: Armut. In: Theologische Realenzyklopädie. Band 4, 1979, S. 69-121 (historische, religionsgeschichtliche und theologische Aspekte)
Siehe auch
- Resilienzforschung (Entstanden als Reaktion auf die Armutsforschung)
- Unterernährung
Weblinks
- STANDUP: weltweiter Aktionstag der UN gegen Armut am 17. Oktober 2007 (deutsch)
- Nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige im Alter von unter 15 Jahren (SGB II) im Bund, in den Ländern und in den Kreisen: Maximum seit Januar 2005, Bestand und Quoten im März 2007 und in den ersten Quartalen der Jahre 2006 und 2007 (jeweils revidierte Daten) 15.08.2007
- Link der Armutsbetroffenen in Basel mit Texten über Armut
- Attac sieht Mittelschicht von Armut betroffen
- Unicef-Studie über Kinderarmut
- Kinderarmut und die Arche
- Eine Stiftung für Deutschland
- Armut in der Schweiz (youngCaritas Schweiz)
- Dossier Familienarmut
Fußnote
- ↑ Definitionen: Was ist Hunger? (taz vom 11. Juni 2002, S. 3)
- ↑ The World Bank Group: Quick Reference Tables
- ↑ DGB: Armutsbericht ist Aufforderung zum Handeln, PM vom 02. Mai 2005 zum 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung
- ↑ Lehrer-online: Armut in Deutschland, Basistexte sowie ein beispielhaftes Schulprojekt (Kinderarmut in Bremen), 29. November 2006
- ↑ Marie-Luise Hauch-Fleck: Rechnen, bis es passt / Die Bundesregierung manipuliert das Existenzminimum – zum Schaden aller Steuerzahler, DIE ZEIT (Nr. 01/2007), 28.Dezember 2006
- ↑ spiegel.de: NOBELPREISTRÄGER YUNUS: "Wir können Armut in die Museen verbannen"
- ↑ http://www.studentenwerk.de/se/2004/Hauptbericht_soz_17.pdf
- ↑ Pressemeldung des Kinderschutzbundes vom 27. Juli 2006.
- ↑ http://134.147.231.87:8080/sisdemo/datenpool_html/database/?doIt=Anzeigen&st1=70 Kinderarmut in verschiedenen Regionen
- ↑ http://134.147.231.87:8080/sisdemo/datenpool_html/database/html.jsp?id=119
- ↑ http://134.147.231.87:8080/sisdemo/datenpool_html/database/html.jsp?id=207
- ↑ Mielck, A. (Hrsg.): Krankheit und soziale Ungleichheit. Opladen: Leske + Budrich)
- ↑ http://www.boeckler.de/cps/rde/xchg/SID-3D0AB75D-FC61B0A5/hbs/hs.xsl/163_63578.html
- ↑ Winkler, J. Die Bedeutung der neueren Forschungen zur sozialen Ungleichheit der Gesundheit für die allgemeine Soziologie, in: Helmert et al.: Müssen Arme früher sterben? Weinheim und München: Juventa
- ↑ Winkler, J. und Stolzenberg, H.: (1999): Der Sozialschichtindex im Bundesgesundheitssurvey. Gesundheitswesen 61. Sonderheft 2
- ↑ Dieser Begriff von „Kinderarmut“ hat noch eine zweite, hier nicht behandelte Bedeutung: Mangel an Kindern (Oligoteknie).
- ↑ Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik: Arm dran (?)! Lebenslagen und Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen. Zu Armut und Benachteiligung in Deutschland
- ↑ Deutsches Kinderhilfswerk: Kinderreport Deutschland 2007 November 2007
- ↑ http://www.boeckler.de/cps/rde/xchg/SID-3D0AB75D-FC61B0A5/hbs/hs.xsl/163_63578.html
- ↑ World Vision (Hrsg.): "Kinder in Deutschland 2007. 1. World Vision Kinderstudie"; Online im Internet: URL: "http://www.worldvisionkinderstudie.de/kinderstudie/zusammenfassung.html"; Homepage der 1. World Vision Kinder-Studie bezüglich Kinder in Deutschalnd
- ↑ Der Tagesspiegel, Nr. 19379, Mittwoch, 22. November 2006, Wirtschaft, S. 17, „Immer mehr Senioren brauchen Geld vom Staat“
- ↑ http://www.tagi.ch/dyn/news/schweiz/765660.html
- ↑ http://findarticles.com/p/articles/mi_m1141/is_1998_Nov_20/ai_53356101 New Jersey "family cap" increases abortion rate
- ↑ Die Sozial-und Gesundheitspolitik der Clinton-Administration. Kapitel V.: Die Verabschiedung der Sozialhilfereform 1995/96, Söhnke Schreyer, Bundeszentrale für politische Bildung bpb, Auszug aus: U.S.A., Aus Politik und Zeitgeschichte (B 44/2000) (abgerufen am 12. November 2007)
- ↑ Der Einfluss von Religion auf Arbeitsfelder amerikanischer ‚Jugendhilfe’ und seine Charakterisierung, André Richter, Dissertationsschrift, Dortmund, 2003, Seite 259 (abgerufen am 12. November 2007)
- ↑ http://www.zeit.de/2006/33/Welfare-to-Work?page=1 Stolz ohne Stütze
- ↑ http://www.acf.hhs.gov/programs/ofa/annualreport5/chap09.htm Child Poverty and TANF
- ↑ Preston, Jennifer. “With New Jersey Family Cap, Births Fall and Abortion Rise.” The New York Times, November 3, 1998 und http://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/10214.html Family Cap Provisions and Changes in Births and Abortions
- ↑ http://findarticles.com/p/articles/mi_m1141/is_1998_Nov_20/ai_53356101 New Jersey "family cap" increases abortion rate
- ↑ Lewis, Oscar: Five Families; Mexican Case Studies In The Culture Of Poverty, 1959.
- ↑ Lewis, Oscar: La Vida; A Puerto Rican Family In The Culture Of Poverty--San Juan And New York, 1966.
- ↑ Moynihan, D. P. (1965). The negro family: The case for national action. U.S. Department of Labor.
- ↑ Ryan, William (1976): Blaming the Victim. Vintage. ISBN 0-394-72226-4.
- ↑ Martin E. P. Seligman (1979). Erlernte Hilflosigkeit. München, Wien, Baltimore: Urban und Schwarzenberg. ISBN 3-541-08931-8; ISBN 3407220162
- ↑ Murray, Charles A. 1984.: Losing ground: American social policy, 1950 - 1980. New York: Basic Books
- ↑ Nathan Caplan et al.: The Boat People and Archievement in America: A study of family life, hard work, and cultural values. University of Michigan Press (1989)ISBN-0-472-09397-5 und David W. Haines (Hrsg.): Refugees as immigrants: Cambodians, Laotians and Vietnamese in America. Rowman&Littlefield Publishers (1989) ISBN: 084767553X, Nathan Caplan et al. (1992): Indochinese Refugee Families and Academic Archievement, In: Scientific American, Ausgabe Februar 1992; S. 18-24
- ↑ Elder, Glen H. (1974): Children of the Great Depression.Chicago: University of Chicago Press S. 160
- ↑ http://www.taz.de/dx/2005/12/06/a0080.1/text
- ↑ Weiss, Karin & Dennis, Mike (Hrsg.) (2005): Erfolg in der Nische? Vietnamesen in der DDR und in Ostdeutschland. Münster: LIT Verlag
- ↑ Weiss, K. & Kindelberger, H. (im Druck): Zuwanderung und Integration in den neuen Bundesländern – zwischen Transferexistenz und Bildungserfolg - Freiburg: Lambertus.
- ↑ http://www.taz.de/dx/2005/12/06/a0080.1/text
- ↑ Weiss, Karin & Dennis, Mike (Hrsg.) (2005): Erfolg in der Nische? Vietnamesen in der DDR und in Ostdeutschland. Münster: LIT Verlag
- ↑ Weiss, K. & Kindelberger, H. (im Druck): Zuwanderung und Integration in den neuen Bundesländern – zwischen Transferexistenz und Bildungserfolg - Freiburg: Lambertus.
- ↑ Eine weitere erfolgreiche arme Bevölkerungsgruppe sind jüdische Zuwanderer aus der GUS; Schoeps, Julius H., Jasper, Willy & Vogt, Bernhard (1999): 'Jüdische Zuwanderer aus der GUS- zur Problematik von sozio-kultureller und generationsspezifischer Integration. Eine empirische Studie des Moses-Mendelsohn-Zentrum 1997-1999'. In: Julius H. Schoeps, Willi Jasper & Bernhard Vogt (eds.): Ein neues Judentum in Deutschland? Fremd- und Eigenbilder der russisch-jüdischen Einwanderer. (Potsdam: Verlag für Berlin Brandenburg) pp. 13-128.
- ↑ Leisering, Lutz (1983): Armut im Sozialstaat. Diplomarbeit + Ders. (1993): Secondary poverty in the welfare state. Bremen: Univ. Bremen, Zentrum für Sozialpolitik + Ders. (1998): The dynamics of modern society: poverty, policy and welfare. Bristol: Policy Press + Ders. (1999): Time and poverty in western welfare states : united Germany in perspective. Cambridge (u.a.): Cambridge Univ. Press
- ↑ Klages, Helmut (1992): Werte und Wandel: Ergebnisse und Methoden einer Forschungstradition. Frankfurt [u.a.]: Campus-Verl.
- ↑ Klages, Helmut (1988): Wertedynamik: über d. Wandelbarkeit d. Selbstverständl.Zürich: Ed. Interfrom [u.a.]