„Emo (Jugendkultur)“ – Versionsunterschied
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Aka (Diskussion | Beiträge) K Tippfehler entfernt, Links optimiert, Kleinkram |
Überarbeitung, Straffung, Vergangenheitsform (work in progress) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''Emo''' (für ''Emotional'', [[Englische Sprache|engl.]] [{{IPA|ˈiːmoʊ}}], [[Deutsche Sprache|dt.]] auch [{{IPA|ˈeːmo}}]) ist eine [[Jugendkultur]] und [[Mode]]erscheinung mit Schwerpunkt in den 2000er Jahren. |
'''Emo''' (für ''Emotional'', [[Englische Sprache|engl.]] [{{IPA|ˈiːmoʊ}}], [[Deutsche Sprache|dt.]] auch [{{IPA|ˈeːmo}}]) ist eine [[Jugendkultur]] und [[Mode]]erscheinung mit Schwerpunkt in den 2000er Jahren. |
||
Die Ursprünge der Szene lagen in den 1990er-Jahren in den USA und der Musikrichtung [[Emo|Emotional Hardcore]], die Jugendkultur und ihre Mode |
Die Ursprünge der Szene lagen in den 1990er-Jahren in den USA und der Musikrichtung [[Emo|Emotional Hardcore]], die Jugendkultur und ihre Mode fand ihre größte weltweite Ausbreitung etwa von 2000 bis 2015. Die Szene ist dafür bekannt, modische Elemente anderer [[Subkultur]]en zu vermischen. In [[Deutschland]] gelten das Jugendmagazin ''[[Bravo (deutsche Zeitschrift)|Bravo]]'', der Musiker [[Bill Kaulitz]] und dessen Band [[Tokio Hotel]] als Wegbereiter dieser Szene.<ref name="SZ">Akiko Lachenmann: {{Webarchiv |url=http://content.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/1919716_0_9223_-die-emo-szene-im-rausch-der-gefuehle.html |wayback=20130101052026 |text=''Die Emo-Szene: Im Rausch der Gefühle''.}} ''[[Stuttgarter Zeitung]]'', 14. Januar 2009; abgerufen am 3. August 2013.</ref><ref name="TAZ">Enrico Ippolito: [https://taz.de/!5097957/ ''Emo-Bewegung: Gegen Spießer.''] In: ''[[TAZ]]'', 20. März 2012, abgerufen am 28. Dezember 2012.</ref> |
||
Emo wird modisch insbesondere mit schwarzen Haaren und schwarzer Kleidung, Karomuster |
Emo wird modisch insbesondere mit schwarzen Haaren und schwarzer Kleidung, Karomuster und Nietengürteln in Verbindung gebracht. Damit verbindet sich eine Lebenseinstellung, in der [[Emotion|Gefühle]], [[Weltschmerz]] und Freundschaft eine große Rolle spielen. Anhängern wurde wegen des Zurschaustellens von Emotionalität ein Hang zur [[Selbstverletzendes Verhalten|Selbstverletzung]] und [[Suizidalität]] nachgesagt, männliche Anhänger wurden oft [[Pejorativum|pejorativ]] als [[Effemination|unmännlich]] und [[Homosexualität|homosexuell]] bezeichnet, unter anderem wegen deren [[Androgynie|androgyner]] Erscheinung. |
||
== Geschichte == |
== Geschichte == |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
[[Datei:Sleeping With Sirens Tucson, AZ.jpg|mini|links|Das US-amerikanische Magazin ''[[Billboard (Magazin)|Billboard]]'' beschreibt den Stil der Gruppe [[Sleeping with Sirens]] als einen Mix aus [[Emo]] und [[Metalcore]]<ref>Gregory Heaney: [http://www.billboard.com/artist/279579/sleeping-sirens/biography ''Sleeping with Sirens – Biography''.] billboard.com; abgerufen am 25. März 2013.</ref>]] |
[[Datei:Sleeping With Sirens Tucson, AZ.jpg|mini|links|Das US-amerikanische Magazin ''[[Billboard (Magazin)|Billboard]]'' beschreibt den Stil der Gruppe [[Sleeping with Sirens]] als einen Mix aus [[Emo]] und [[Metalcore]]<ref>Gregory Heaney: [http://www.billboard.com/artist/279579/sleeping-sirens/biography ''Sleeping with Sirens – Biography''.] billboard.com; abgerufen am 25. März 2013.</ref>]] |
||
Der Emotional Hardcore oder Emocore entstand Mitte der 1980er Jahre und ist ein Subgenre des [[D.C. Hardcore]] |
Der Emotional Hardcore oder Emocore entstand Mitte der 1980er Jahre und ist ein Subgenre des [[D.C. Hardcore]]. Als wichtiger Wegbereiter des Genres gelten die US-amerikanische [[Punk (Musik)|Punk]]-Bands [[Rites of Spring]] und [[Hüsker Dü]], die emotionale Passagen in ihren Liedern verwendeten. Weitere wichtige Vertreter des Genres sind bzw. waren [[Fugazi (Band)|Fugazi]] und [[Embrace (US-amerikanische Band)|Embrace]], die nach der Auflösung von Rites of Spring als wichtigste Vertreter des Emo- und [[Post-Hardcore]] galten.<ref name="angelfire">''[https://web.archive.org/web/20210411094337/https://www.angelfire.com/emo/origin/ Origin of Emo]'' auf angelfire.com (Archivlink). Abgerufen am 16. Dezember 2021.</ref> |
||
In Deutschland entstanden die ersten Emo-Bands Ende der 1990er Jahre. 1997/98 lag eine der ersten Hochburgen in [[Göttingen]]. Vor allem die Gruppen El Mariachi und |
In Deutschland entstanden die ersten Emo-Bands Ende der 1990er Jahre. 1997/98 lag eine der ersten Hochburgen in [[Göttingen]]. Vor allem die Gruppen El Mariachi und [[Katzenstreik]] prägten die Göttinger Szene. Im deutschsprachigen Raum wird außerdem den Gruppen [[Angeschissen]] und [[Boxhamsters]] eine gewisse Vorreiterrolle zugesprochen. Im [[Screamo]], einem Subgenre des Emo, existierte die Band [[Yage]], die internationale Maßstäbe setzen konnte.<ref>{{Internetquelle |autor= |url=https://www.metalorgie.com/groupe/Yage |titel=Yage |werk=metalorgie.com |sprache=fr |abruf=2021-12-16}}</ref> Größere Band-Szenen existierten in und um [[Hamburg]] bzw. [[Schleswig-Holstein]], [[Berlin]] und im [[Ruhrgebiet]]. |
||
Darüber hinaus wird der Genrebegriff ''Emo'' seit Ende der 1990er auch für Bands verwendet, die ihre Wurzeln im [[Indie-Rock]] haben. So galten [[The Get Up Kids]], [[Texas Is the Reason]], [[The Promise Ring]] und [[Jimmy Eat World]]<ref name="angelfire" /> als Wegbereiter des Indierock-lastigen Emo, zum Teil auch gegen deren Willen: |
|||
{{Zitat |
{{Zitat |
||
|Text=Wir haben zwar Emo aus den achtziger Jahren gehört, werden aber nicht gerne mit diesem Label versehen, weil es eben woanders herkommt als wir. […] wir haben uns immer nur als Rockband auf der Suche nach dem perfekten Song verstanden |
|Text=Wir haben zwar Emo aus den achtziger Jahren gehört, werden aber nicht gerne mit diesem Label versehen, weil es eben woanders herkommt als wir. […] wir haben uns immer nur als Rockband auf der Suche nach dem perfekten Song verstanden |
||
|ref=<ref>''[[FUZE Magazine]]'', Nr. 7, Dezember 2007/Januar 2008; S. 20.</ref>}} |
|Autor=Tim Linton, Jimmy Eat World, 2007 |
||
|ref=<ref>''[[FUZE Magazine]]'', Nr. 7, Dezember 2007/Januar 2008; S. 20.</ref> |
|||
}} |
|||
| ⚫ | |||
Seit Beginn der 2000er Jahre werden vor allem Bands als „Emo“ verstanden, die mit den äußerlichen Merkmalen der Modeerscheinung übereinstimmen. |
|||
| ⚫ | Etwa seit 2000 entstand die Jugendkultur des Emo, die sich sukzessive vom Musikgenre des Emotional Hardcore entfernte und sich vor allem über eine gefühlsorientierte Lebenseinstellung und das äußere Erscheinen definierte. Das Musikgenre ''Emo'' wurde nun vor allem auf Bands angewendet, die mit den Merkmalen dieser Jugendbewegung übereinstimmten. |
||
Der Emocore hat zwar seine Wurzeln im Hardcore, wird jedoch von Hardcore-Anhängern nicht mehr als Subgenre anerkannt, da der Emocore sich von der politischen Sichtweise, die ein Teil der Hardcore-Szene vertritt, entfernt und sich dem Individuum und dem persönlichen Leiden als Hauptmotiv zugewandt hat. Den Individualitäts- und Leidensfokus haben das Genre und die heutige Jugendkultur gemeinsam, wobei die Musik in der heutigen Emo-Szene eher eine Begleiterscheinung darstellt und nicht im Vordergrund steht.<ref name="Bütow3">Birgit Bütow: ''Körper · Geschlecht · Affekt: Selbstinszenierungen und Bildungsprozesse in jugendlichen Sozialräumen.'' S. 85.</ref> Auch führte der Klang des Emocore, der stark am [[Alternative Rock]] und am [[Pop-Punk]] orientiert war, zu der Diskussion, ob der Emocore noch etwas mit dem ursprünglichen Hardcore zu tun habe.<ref>Ronald Hitzler, Arne Niederbacher: ''Leben in Szenen: Formen juveniler Vergemeinschaftung heute.'' S. 82.</ref> |
|||
| ⚫ | Während Anhänger des Emocore in den 1980er und 1990er Jahren, wie im Hardcore-Punk üblich, keinem Dresscode folgten, zeichneten sich die Anhänger des Indierock-Emo in den 1990er Jahren durch [[Hornbrille]]n, enge [[Pullover]], [[Weste]]n, [[Cord (Gewebe)|Cordhosen]], Hemden, Worker-Jackets und Lederschuhe aus. Gegen Ende der 1990er Jahre entstand im Umfeld des Emocore der „Spock-Rock“<!-- Belege für diese Bezeichnung neben Bray? -->, geprägt durch Justin Pearson, Sänger der US-amerikanischen Emocore-Band [[Swing Kids (Band)|Swing Kids]]. Charakteristisch für den „Spock-Rock“ waren ein kurzer, gerade geschnittener [[Pony (Frisur)|Pony]], ähnlich der Figur [[Figuren im Star-Trek-Universum#Commander Spock|Mr. Spock]] aus der Serie ''[[Raumschiff Enterprise|Star Trek]]''.<ref>[http://www.angelfire.com/ky2/lineandink/locust.html ''An Interview with Robert Bray of the Locust''] (englisch)</ref><ref>[http://skatepunk.com/profiled/justin-pearson-interview Interview with Justin Pearson.] skatepunk.com (englisch)</ref><ref>[http://www.sandiegoreader.com/bands/swing-kids/ Swing Kids.] sandiegoreader.com (englisch)</ref> Zu diesem Zeitpunkt trat das Schwarzfärben der Haare erstmals vermehrt auf. Modisch wies die Spock-Rock-Szene nur wenige Besonderheiten auf, häufig getragen wurden Hochwasserhosen und schwarze, enge T-Shirts. |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
[[Datei:Emo6.jpg|mini|Emo-Frisur, 2007]] |
[[Datei:Emo6.jpg|mini|Emo-Frisur, 2007]] |
||
Modisch griff Emo in den 2000er Jahren verschiedene Elemente der früheren Generationen auf und vermischte sie mit Elementen der Gothic-Mode und Anleihen des [[Pop-Punk]]. Emo war bekannt dafür, von anderen Jugendszenen abgelehnt zu werden. Unter anderem warfen Anhänger anderer Szenen ihm vor, sich an anderen Stilen zu bedienen und diese als eigenen Modetrend auszugeben.<ref name="max.de3">{{Webarchiv |url=http://www.max.de/lifestyle/gesellschaft/emos/238352,1,article,Mainstream-frisst-Subkultur.html |text=''Emos: Mainstream frisst Subkultur''. |wayback=20131213163723}} max.de</ref> Britta Schuboth beschreibt, dass die Emo-Szene seit Beginn ihres Bestehens kontrovers diskutiert worden sei und sich dadurch eine negative Zuschreibung in der Öffentlichkeit entwickelte, wodurch die Szene letztlich zur Zielscheibe aggressiv-gewalttätiger Übergriffe wurde.<ref name="Bütow">Britta Schuboth: „Männlichkeitskonstruktionen in der Jugendkultur Emo und ihr aggressionsgeladenes Echo“. In: Birgit Bütow: ''Körper · Geschlecht · Affekt: Selbstinszenierungen und Bildungsprozesse in jugendlichen Sozialräumen'', S. 83.</ref> |
|||
Mitte der 2010er Jahre verlor Emo in Europa an Bedeutung.<ref>{{Literatur |Autor=Dennis Sand |Titel=Emo ist tot: Ein Nachruf |Sammelwerk=DIE WELT |Datum=2014-12-12 |Online=https://www.welt.de/kultur/pop/article135309844/Emo-die-verhassteste-aller-Jugendkulturen-ist-tot.html |Abruf=2021-12-16}}</ref> |
Mitte der 2010er Jahre verlor Emo in Europa an Bedeutung.<ref>{{Literatur |Autor=Dennis Sand |Titel=Emo ist tot: Ein Nachruf |Sammelwerk=DIE WELT |Datum=2014-12-12 |Online=https://www.welt.de/kultur/pop/article135309844/Emo-die-verhassteste-aller-Jugendkulturen-ist-tot.html |Abruf=2021-12-16}}</ref> |
||
== Selbstverständnis == |
|||
== Definition und Ideologie == |
|||
Die Emo-Szene |
Die Emo-Szene wollte nicht als gesellschaftskritische Jugendkultur, sondern als individuelle Möglichkeit zur Selbstdarstellung verstanden werden. Aus dem Musikstil entwickelte sich eine Mode und Lebenseinstellung, in der [[Emotion|Gefühle]], [[Weltschmerz]] und Freundschaft eine große Rolle spielten.<ref name="SZ" /> Dabei standen die Gefühle anderer vor den eigenen Gefühlen.<ref name="Bütow" /> Das Alter der Jugendlichen in der Szene lag zwischen 14 und 20 Jahren, selten waren auch ältere Menschen anzutreffen.<ref name="Spiegel">Carola Padtberg: [http://www.spiegel.de/schulspiegel/leben/jugendkultur-emo-entdeck-das-maedchen-in-dir-a-676835.html ''Jugendkultur Emo – Entdeck das Mädchen in dir'']. ''[[Spiegel Online|SCHULSpiegel]]'', erschienen am 11. März 2010, abgerufen am 28. Dezember 2012.</ref> Grund dafür war unter anderem, dass die Szene auf die „Bedürfnisse Pubertierender zugeschnitten“ war: Innerhalb der Szene durfte man Kind sein und es gab Verständnis für schlechte Laune.<ref name="SZ" /> Viele Angehörige der Szene stammten aus gutbürgerlichen Familien und der oberen Mittelschicht.<ref name="Spiegel" /><ref name="TAZ" /> Der Szene wurde insgesamt ein toleranter und offener Umgang untereinander nachgesagt.<ref name="Bütow5">Birgit Bütow: ''Körper · Geschlecht · Affekt: Selbstinszenierungen und Bildungsprozesse in jugendlichen Sozialräumen.'' S. 89–92.</ref> |
||
Anhänger der Emo-Jugendkultur ordneten sich selbst verschiedenen Kategorien zu, beispielsweise „echter Emo“, „Emo Kiddie“ und „Möchtegern“ (engl. ''wannabe''). Letztere wurden vor allem über äußere und modische Merkmale definiert.<ref name="MasterArbeit">Julia Austermann: [http://www.mediengeschichte.uni-siegen.de/files/2012/07/M.A.-Arbeit-Julia-Austermann_Darstellungen-m%C3%A4nnlicher-Jugendlicher-in-der-digitalen-Emo-Szene.pdf ''Darstellungen männlicher Jugendlicher in der digitalen Emo-Szene.''] (PDF; 1,0 MB) Master-Arbeit an der Uni Siegen, 2011.</ref> |
|||
| ⚫ | |||
=== Musik und Haltung zur Kommerzialisierung === |
|||
| ⚫ | |||
Die Emo-Bewegung präsentierte sich überwiegend [[Introversion und Extraversion|introvertiert]]. Das Zurschaustellen von Emotionen und Gefühlen, etwa in Form von Gedichten, war ein Hauptbestandteil der Szene und zog unter anderen Jugendlichen Spott auf sich.<ref>{{Webarchiv |url=http://der-z-weite-blick.de/themen/emos/ |text=''Belächelt und gehasst – Emos und Männlichkeit''. |wayback=20130804035920}} der-z-weite-blick.de. Abgerufen am 16. Dezember 2021.</ref> Auch die [[Androgynie]] der Anhänger und die Tatsache, dass sich Jungen schminkten und auf ihr Aussehen achteten,<ref name="MasterArbeit" /> wurde mit der Begründung kritisiert, dass so die typische [[Geschlechterrolle|Rollenverteilung]] von Mann und Frau „aufgelöst“ werde.<ref name="MasterArbeit" /> |
|||
In unterschiedlicher Intensität werden etwa auch die überwiegend dem Post-Hardcore und Metalcore zugehörigen Bands [[Black Veil Brides]], [[Pierce the Veil]], [[Senses Fail]], [[Alesana]], [[Hawthorne Heights]], [[Chiodos]] und viele weitere als typische Beispiele des Genres Emo oder Screamo gesehen. Auch die US-amerikanische [[Artrock]]-Band [[Blue October]] wurde wegen ihres Musikstils bereits als Vertreter des [[Emo]] bezeichnet.<ref>{{Webarchiv |url=http://content.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/3002518_0_2798_-lka-longhorn-blue-october.html |wayback=20111122030511 |text=''Die Texaner präsentieren ihr siebtes Studioalbum „Any Man In America“''.}} In: ''[[Stuttgarter Zeitung]]'', 15. November 2011</ref> In Deutschland wird die Band Tokio Hotel mit Emo verbunden, jedoch ist diese bei den Anhängern der Szene unbeliebt.<ref name="TAZ" /> |
|||
Laut dem Autor [[Ronald Hitzler]] steht die Emo-Kultur im Gegensatz zur [[Antifa]]- und zur Hardcore-Punk-Szene der [[Kommerzialisierung]] innerhalb der Musikbranche nicht ganz ablehnend gegenüber, während Antifa sich ganz vom Kommerz und Hardcore-Punks und Goths sich von Szene-Bands, die als „kommerziell“ etikettierte Erfolge erzielen, distanzieren.<ref>[[Ronald Hitzler]], [[Arne Niederbacher]]: ''Leben in Szenen: Formen juveniler Vergemeinschaftung heute.'' S. 194 (erschienen in zweiter Auflage 2005 im [[VS Verlag für Sozialwissenschaften]])</ref> |
|||
=== Soziale Struktur === |
|||
Aus dem Musikstil entwickelte sich eine Mode und Lebenseinstellung, in der [[Emotion|Gefühle]] und [[Weltschmerz]] öffentlich zur Schau gestellt werden. Dabei stehen die Gefühle anderer vor den eigenen Gefühlen, Freundschaft hat einen großen Stellenwert.<ref name="Bütow" /> Das Alter der Jugendlichen in der Szene liegt zwischen 14 und 20 Jahren. Selten sind auch ältere Menschen anzutreffen.<ref name="Spiegel">Carola Padtberg: [http://www.spiegel.de/schulspiegel/leben/jugendkultur-emo-entdeck-das-maedchen-in-dir-a-676835.html ''Jugendkultur Emo – Entdeck das Mädchen in dir'']. ''[[Spiegel Online|SCHULSpiegel]]'', erschienen am 11. März 2010, abgerufen am 28. Dezember 2012.</ref> Viele Angehörige der Szene stammen aus gutbürgerlichen Familien und der oberen Mittelschicht.<ref name="Spiegel" /><ref name="TAZ" /> |
|||
Die Emo-Szene gilt als eine „Freizeitszene“, in der es wie in anderen Jugendkulturen mehrere Kategorien gibt, wie „echter Emo“, „Emo Kiddie“ und „Möchtegern“ (engl. ''wannabe''). Letztere zählen sich bereits zur Szene, wenn sie dem äußeren Merkmal (hauptsächlich die Mode betreffend) entsprechen.<ref name="MasterArbeit" /> Daniela Eichholz analysierte, dass die Szene auf die „Bedürfnisse Pubertierender zugeschnitten“ sei. Innerhalb der Szene dürfe man Kind sein und es gibt Verständnis für schlechte Laune.<ref name="SZ" /> |
|||
Die Emo-Bewegung präsentiert sich überwiegend [[Introversion und Extraversion|introvertiert]], auch wenn die Anhänger der Szene sehr auf ihr Aussehen achten. Das Zurschaustellen von Emotionen und Gefühlen ist ein Hauptbestandteil der Szene und wird unter anderem häufig in Form von [[Gedicht]]en praktiziert. In anderen jugendkulturellen Kreisen zieht das Zeigen von Gefühlen eher Spott auf sich.<ref>{{Webarchiv |url=http://der-z-weite-blick.de/themen/emos/ |text=''Belächelt und gehasst – Emos und Männlichkeit''. |wayback=20130804035920}} der-z-weite-blick.de. Abgerufen am 16. Dezember 2021.</ref> Auch die [[Androgynie]] der Szene und die Tatsache, dass sich Jungen schminken und auf ihr Aussehen achten,<ref name="MasterArbeit">Julia Austermann: [http://www.mediengeschichte.uni-siegen.de/files/2012/07/M.A.-Arbeit-Julia-Austermann_Darstellungen-m%C3%A4nnlicher-Jugendlicher-in-der-digitalen-Emo-Szene.pdf ''Darstellungen männlicher Jugendlicher in der digitalen Emo-Szene.''] (PDF; 1,0 MB) Master-Arbeit an der Uni Siegen, 2011.</ref> wird etwa von der Hip-Hop-Szene nicht akzeptiert, da sie die typische [[Geschlechterrolle|Rollenverteilung]] von Mann und Frau „aufgelöst“ sehen.<ref name="MasterArbeit" /> Auch die [[Visual Kei|Visual-Kei]]-Szene hat unter anderem mit diesem Vorurteil zu kämpfen.<ref name="Spiegel" /> [[Birgit Bütow]] schreibt der Anlehnung der männlichen Emos an die Frauen einen provokativen Wert zu, der dazu führe, dass die Szene oft in Diskurse anderer Jugendszenen und Kulturen hineingezogen werde. |
|||
{{Zitat |
{{Zitat |
||
|Text=Geschlechterbezogene Identitätsarbeit ist immer auch Inszenierungsarbeit und -praxis, spielt mit verschiedenen Darstellungsformen, bezieht sich in verschiedener Form auf Geschlechterdiskurse und provoziert, dass die Akteur/innen je nach Inszenierung auch oft in Diskurse ‚hineingerufen‘ werden. Dies kann am Beispiel männlicher Inszenierungen in der Emo-Szene gezeigt werden, die aufgrund ihrer latenten Provokation von Männlichkeitsstereotypen und damit auch von [[Heteronormativität]] interaktiv und für die Beteiligten häufig auch diskursiv und reflexiv werden. |
|Text=Geschlechterbezogene Identitätsarbeit ist immer auch Inszenierungsarbeit und -praxis, spielt mit verschiedenen Darstellungsformen, bezieht sich in verschiedener Form auf Geschlechterdiskurse und provoziert, dass die Akteur/innen je nach Inszenierung auch oft in Diskurse ‚hineingerufen‘ werden. Dies kann am Beispiel männlicher Inszenierungen in der Emo-Szene gezeigt werden, die aufgrund ihrer latenten Provokation von Männlichkeitsstereotypen und damit auch von [[Heteronormativität]] interaktiv und für die Beteiligten häufig auch diskursiv und reflexiv werden. |
||
|Autor= |
|Autor=Barbara Stauber, John Litau, 2013 |
||
|Quelle= |
|||
| ⚫ | |||
|ref=<ref>"Jugendkulturelles Rauschtrinken – Gender-Inszenierungen in informellen Gruppen." In: ''Körper · Geschlecht · Affekt: Selbstinszenierungen und Bildungsprozesse in jugendlichen Sozialräumen.'', 2013, S. 45.</ref> |
|||
| ⚫ | |||
Die Szene |
Die Emo-Szene war stark im Internet aktiv; allein im sozialen Netzwerk [[Facebook]] existierten annähernd 500 verschiedene „Emo“-Gruppen, in denen unter anderem Treffen, sogenannte „Emotreffs“, organisiert wurden.<ref name="Bütow4">Birgit Bütow: ''Körper · Geschlecht · Affekt: Selbstinszenierungen und Bildungsprozesse in jugendlichen Sozialräumen.'' S. 88</ref> Beispielsweise fand 2009 in [[Stuttgart]] eines der größten Treffen mit mehreren hundert Teilnehmern statt.<ref name="ZDFinfo">[https://www.youtube.com/watch?v=WSYOWYqSQLI&ab_channel=NonExistentX JugendKULTur_ Emo (Teil 1)], ZDFinfokanal, Oktober 2009, auf youtube.com. Abgerufen am 16. Dezember 2021.</ref> |
||
| ⚫ | |||
Im Gegensatz zu anderen Szenen wie der [[Hip-Hop (Subkultur)|Hip-Hop]]- oder der Skater-Subkultur müssen sich Personen nicht beweisen, um in der Szene aufgenommen und akzeptiert zu werden. Integration erfolgt über dieselbe Musik und Kleidung und eine ähnliche Einstellung. Emo gilt daher auch als ein Auffangbecken für Jugendliche, die in anderen Szenen keine Heimat finden.<ref name="SZ" /> |
|||
=== Musik === |
|||
Der Emocore hat seine Wurzeln im Hardcore-Punk, orientiert sich aber auch am [[Alternative Rock]] und am [[Pop-Punk]]. Emocore wendet sich anders als diese Genres besonders dem Individuum und dem persönlichen Leiden als Hauptmotiv zu.<ref>Ronald Hitzler, Arne Niederbacher: ''Leben in Szenen: Formen juveniler Vergemeinschaftung heute'', 2010, S. 82.</ref> Den Individualitäts- und Leidensfokus haben das Genre und die heutige Jugendkultur gemeinsam, wobei die Musik im Laufe der Zeit in den Hintergrund rückte.<ref name=":0">{{Literatur |Autor=Britta Schuboth |Titel=Männlichkeitskonstruktionen in der Jugendkultur Emo und ihr aggressionsgeladenes Echo |Hrsg=Birgit Bütow, Ramona Kahl, Anna Stach |Sammelwerk=Körper • Geschlecht • Affekt. Selbstinszenierungen und Bildungsprozesse in jugendlichen Sozialräumen |Verlag=Springer |Ort=Wiesbaden |Datum=2013 |ISBN= |DOI=10.1007/978-3-531-18998-7_5 |Seiten=83–97}}</ref> |
|||
| ⚫ | In unterschiedlicher Intensität werden unter anderem die dem Post-Hardcore und Metalcore zugehörigen Bands [[Black Veil Brides]], [[Pierce the Veil]], [[Senses Fail]], [[Alesana]], [[Hawthorne Heights]], [[Chiodos]] als typische Beispiele der Genres Emo oder Screamo gesehen. Auch die US-amerikanische [[Artrock]]-Band [[Blue October]] wurde wegen ihres Musikstils bereits als Vertreter des [[Emo]] bezeichnet.<ref>{{Webarchiv |url=http://content.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/3002518_0_2798_-lka-longhorn-blue-october.html |text=''Die Texaner präsentieren ihr siebtes Studioalbum „Any Man In America“''. |wayback=20111122030511}} In: ''[[Stuttgarter Zeitung]]'', 15. November 2011</ref> In Deutschland wird die Band Tokio Hotel mit Emo verbunden, jedoch ist diese bei den Anhängern der Szene unbeliebt.<ref name="TAZ" /> Mit steigender Popularität der Jugendkultur wurden auch viele – teilweise kommerziell erfolgreiche – Bands, die musikalisch stärker dem Alternative Rock,<ref>[http://bands.rock-im-park.de/bands.asp?artistid=14&year=2007 bands.rock-im-park.de] abgerufen am 26. Dezember 2007; Zitat: „[…] katapultierte die Band ([[My Chemical Romance]], Annahme der Redaktion) aus New Jersey gleich bis an die Spitze des Screamo/Emocore-Genres.“</ref> Post-Hardcore<ref>{{Webarchiv |url=http://www.arte.tv/de/kunst-musik/tracks/20050106/1477894.html |text=arte.tv |wayback=20080129140115}} abgerufen am 26. Dezember 2007; Zitat aus dem arte-Magazin ''Tracks'': „Alexisonfire ist Kanadas Vorführ-Export im Genre Emo. […] Sie spielen mit den Genres, haben aber auch kein großes Problem mit dem Stempel Emo.“</ref> oder [[Metalcore]]<ref>„Bisher war ich in der Screamo-Emo-Schiene mit […] MY CHEMICAL ROMANCE eigentlich sehr gut bedient, und so stellte sich schnell die Frage, ob der für [[Bullet for My Valentine|BULLET FOR MY VALENTINE]] im Plattenregal freigehaltene Platz sinnvoll ist.“ [http://www.powermetal.de/cdreview/review-6456.html Powermetal-Reviews] abgerufen am 26. Dezember 2007.</ref> zugeordnet werden, als Emo bezeichnet. Laut [[Ronald Hitzler]] stand die Emo-Kultur im Gegensatz zur [[Antifa]]- und zur Hardcore-Punk-Szene der [[Kommerzialisierung]] innerhalb der Musikbranche nicht ganz ablehnend gegenüber.<ref>[[Ronald Hitzler]], [[Arne Niederbacher]]: ''Leben in Szenen: Formen juveniler Vergemeinschaftung heute.'' S. 194 (erschienen in zweiter Auflage 2005 im [[VS Verlag für Sozialwissenschaften]])</ref> |
||
{{Zitat |
|||
|Text=Sie teilen zuallererst Einstellung, Mode und Musik – und die lässt sich leicht adaptieren. |
|||
|Autor=Daniela Eichholz |
|||
|Quelle=[[Stuttgarter Zeitung]] |
|||
|ref=<ref name="SZ" /> |
|||
| ⚫ | |||
=== Mode === |
=== Mode === |
||
Die [[Kleidermode]] der Emo-Szene setzte sich zum Teil aus Elementen anderer Szenen zusammen. Dazu zählten Nietengürtel (ursprünglich aus der [[Punk]]-Szene), Skater-Schuhe ([[Chuck Taylor All Star|Converse Chucks]] aus dem [[Grunge]] und [[Vans]] aus der [[Skateboard|Skater]]-Kultur)<ref name="Spiegel" />, schwarzgefärbte Haare mit einem asymmetrisch getragenen Pony und Schwarz als Grundfarbe der Kleidung (u. a. aus der [[Gothic (Kultur)|Gothic]]-Szene) und Karomuster (aus dem [[Rockabilly]]). Schwarze Kleidung wurde oft durch grelle Farbmuster kontrastiert.<ref name="ZDFinfo" /><ref name="MasterArbeit" /> Beliebte Kleidungsstücke waren [[Jeans|Röhrenjeans]]<ref>{{Webarchiv |url=http://emo-style.net/kleidung/ |text=Emo-Kleidung (Beispiel). |wayback=20121226161909}} emo-style.net. Abgerufen am 16. Dezember 2021.</ref> und [[Minirock|Miniröcke]].<ref name="MasterArbeit" /> Hinzu kam Dinge, die als „[[Kawaii|süß]]“ galten, wie etwa [[Hello Kitty|Hello-Kitty]]-Accessoires, und düstere Symbole, etwa Totenköpfe und Skelette.<ref name="Spiegel" /> Ebenso gehörte zum Stil eine [[Pony (Frisur)|Pony]]-Frisur, mit Kajal umrandete Augen und [[Piercing]]s (meist [[Labret-Piercing|Labret-Piercings]], aber auch [[Fleshtunnel|Tunnels]]).<ref name="max.de3" /> |
|||
{{Zitat |
{{Zitat |
||
|Text=Emo an sich hat einfach probiert, verschiedene Elemente zu einem zusammenzufügen. Das, was gut ist aus den verschiedenen Richtungen, einfach zu einem zu machen, und daraus ist dann einfach Emo geworden. |
|Text=Emo an sich hat einfach probiert, verschiedene Elemente zu einem zusammenzufügen. Das, was gut ist aus den verschiedenen Richtungen, einfach zu einem zu machen, und daraus ist dann einfach Emo geworden. |
||
|Autor=Amy aka Diamond of Tears |
|Autor=Amy aka Diamond of Tears |
||
|Quelle= |
|Quelle= |
||
|ref=<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=tfs_MTlyZhI Was wollen Emos?] [[Youtube]]</ref>}} |
|ref=<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=tfs_MTlyZhI Was wollen Emos?] [[Youtube]]</ref> |
||
}} |
|||
Mode-Labels wie ''Cupcake Cult'' oder ''Heartless'' |
Mode-Labels wie ''Cupcake Cult'' oder ''Heartless'' waren in der Szene beliebt. Die T-Shirt-Motive zeigten beispielsweise [[Zeichentrickfilm|Zeichentrick]]- oder [[Anime]]-Figuren, [[Horrorfilm]]-Protagonisten oder Bands aus der Metalcore-, Post-Hardcore- und [[Deathcore]]-Szene.<ref name="MasterArbeit" /> |
||
Ein zentrales Motiv in der Emo-Mode |
Ein zentrales Motiv in der Emo-Mode war die [[Rasierklinge]], die zum Beispiel als Ohrring oder als Gürtelschnalle getragen wurde.<ref name="MasterArbeit" /> |
||
== Gesellschaftliche Stellung == |
== Gesellschaftliche Stellung == |
||
Emo |
Emo wurde als „die erste Jugendszene, in der sich Jungs an Mädchen anpassen“ beschrieben, die somit „das Rollenmodell auf den Kopf“ stellte.<ref name="Spiegel" /> Als Beispiele wurden Merkmale wie lange Haare und Schminke genannt; diese waren allerdings schon vorher in anderen Szenen zu finden, etwa bei [[Hippie]]s, im [[Glam Rock]] und den [[New Romantic]]s. |
||
=== Ablehnung und Hass === |
|||
Laut dem Jugendforscher [[Marc Calmbach]] werden die klassischen Geschlechterrollen durch die Emo-Bewegung aufgelöst. |
|||
[[Datei:Diagramm Emo Unsympathisch.svg|mini|Als unsympathisch eingestufte Szenen, an zweiter Stelle Emo (16- bis 29-jährigen Österreichische und deutsche Jugendliche im Vergleich, Institut für Jugendkulturforschung 2012)]] |
|||
Obwohl die Emo-Szene zu den kleinsten Jugendszenen in der Jugendkulturlandschaft der 2010er Jahre gezählt wurde, erlangte sie große öffentliche Aufmerksamkeit. Zusammen mit der [[Skinhead|Skinhead-]], der Gothic- und der Punk-Szene stieß sie auf breite Ablehnung und negative Vorurteile.<ref>{{Literatur |Autor=Beate Großegger |Titel=Teenage-Angst, Dauerdepression oder „einfach anders“? |
|||
Jugendkulturen im Fokus: Die Emo-Szene – Mythen und Fakten |Hrsg=Institut für Jugendkulturforschung |Datum=2013 |Online=https://jugendkultur.at/wp-content/uploads/Dossier_Emo-Szene_Grossegger_2013.pdf |Format=PDF}}</ref> |
|||
In der Gesellschaft der Gleichaltrigen wurde Emos vorgeworfen, sie seien oberflächliche „Style-Victims“ und morbide „Pseudos“, Emos seien verweichlichte Kinder einer degenerierten Mittelschicht oder „Transvestitengesindel“.<ref name="Tagesspiegel">Jan Oberländer: [http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/werbinich/wer-sind-die-eigentlich-findet-emo/1271302.html ''Wer sind die eigentlich? Findet Emo''.] In: ''[[Tagesspiegel]]'', 4. Juli 2008, abgerufen am 28. Dezember 2012</ref> Szenen wie Punk, Gothic, [[Wave (Musik)|Wave]], [[Rap]] oder [[Metal]] erklärten die Emo-Szene aufgrund der übernommenen modischen Elemente zum Feindbild.<ref name="max.de">max.de: {{Webarchiv |url=http://www.max.de/lifestyle/gesellschaft/emos/ |text=Emos: Verhasste Jugendbewegung |wayback=20120728080810}}. Abgerufen am 16. Dezember 2021.</ref><ref name="ZDFinfo" /> |
|||
Die starke Ablehnung der Emo-Szene führte wiederholt zu gewaltsamen Angriffen auf Angehörige der Emo-Szene.<ref name=":0" /> So schlossen sich in [[Mexiko]] im April 2008 etwa tausend Punks zusammen, um „Emos aus der Stadt zu jagen“.<ref>Sebastian Hofer: [http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/jugendgewalt-in-mexiko-toete-einen-emo-a-544885.html ''Jugendgewalt in Mexiko – Töte einen Emo''], ''[[Spiegel Online]]'', 6. April 2010, abgerufen am 28. Dezember 2012</ref><ref name="Bütow2">[[Birgit Bütow]]: ''Körper Geschlecht Affekt: Selbstinszenierungen und Bildungsprozesse in jugendlichen Sozialräumen.'' S. 84: ''Männlichkeitskonstruktionen in der Jugendkultur Emo und ihr aggressionsgeladenes Echo''.</ref> In [[Chile]] bildete die Emo-Szene zwar eine der größten Jugendkulturen, wurde aber wegen ihrer nach außen getragenen Emotionalität und der androgynen bzw. femininen Selbstdarstellung zum Streitthema.<ref name=":0" /> Männliche Emos wurden pejorativ als verweichlicht und homosexuell bezeichnet und dafür auch körperlich angegriffen.<ref name="MasterArbeit" /> |
|||
{{Zitat |
|||
|Text=Warte mal, stopp, du kannst mich noch nicht gehen lassen<br /> |
|||
Nimm dir doch lieber diese Emos, die ihr Leben hassen |
|||
|Quelle=Auszug aus „Der Himmel soll warten“ von [[Sido]] feat. [[Adel Tawil]]}} |
|||
| ⚫ | Anfang 2012 wurden im [[Irak]] 90 Jugendliche von religiösen Milizen gesteinigt, da sie der Emo-Szene angehörten. Ihnen wurde vom [[Innenministerium]] eine Nähe zum [[Satanismus]] unterstellt.<ref>Florian Flade: [https://www.welt.de/politik/ausland/article13917321/Milizen-sollen-90-Emo-Jugendliche-gesteinigt-haben.html ''Irak: Milizen sollen 90 Emo-Jugendliche gesteinigt haben''], ''[[Welt Online]]'', 12. März 2012, abgerufen am 28. Dezember 2012.</ref><ref>Florian Flade, Dietrich Alexander: [https://www.welt.de/politik/ausland/article13918191/Auf-der-Todesliste-weil-sie-Schwarz-tragen.html ''Auf der Todesliste, weil sie Schwarz tragen''.] [[Die Welt|Welt Online]], 12. März 2012; abgerufen am 31. Dezember 2012</ref> Auch in [[Saudi-Arabien]] wurden 2010 zehn Mädchen, die der Emo-Szene angehörten, von der Polizei wegen Unruhestiftung inhaftiert.<ref>[http://www.abc.net.au/news/2010-05-23/saudi-emo-girls-busted-by-religious-cops/836866 Saudi ‘emo’ girls busted by religious cops], 23. Mai 2010, abgerufen am 28. Dezember 2012.</ref> In der [[Türkei]] wurden Emos als eine Gefahr für die religiösen und konservativen Werte des Landes angesehen.<ref name=":0" /> |
||
Es heißt außerdem, dass die männliche Selbstdarstellung innerhalb der Emo-Szene im Kontrast zum allgemeinen Männlichkeitsideal sowie dessen Wettbewerb und Hierarchisierung innerhalb der männlichen Geschlechtergruppe stehe. Diese Konfrontation der Selbstdarstellung und der allgemeinen Männerideale führte des Öfteren zu gewaltsamen und kriminellen Auseinandersetzungen mit Angehörigen der Emo-Szene.<ref name="Bütow2">[[Birgit Bütow]]: ''Körper Geschlecht Affekt: Selbstinszenierungen und Bildungsprozesse in jugendlichen Sozialräumen.'' S. 84: ''Männlichkeitskonstruktionen in der Jugendkultur Emo und ihr aggressionsgeladenes Echo''.</ref> Aber nicht nur in Jugendkulturen mit klaren Geschlechterrollen werden Emos gehasst. Auch in der Punk-Szene wird seit einigen Jahren gegen die Emo-Szene gehetzt. So schlossen sich in [[Mexiko]] im April 2008 etwa tausend Punks zusammen, um „Emos aus der Stadt zu jagen“.<ref>Sebastian Hofer: [http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/jugendgewalt-in-mexiko-toete-einen-emo-a-544885.html ''Jugendgewalt in Mexiko – Töte einen Emo''], ''[[Spiegel Online]]'', 6. April 2010, abgerufen am 28. Dezember 2012</ref> Als Grund wurde unter anderem „Symbolklau“ aus anderen Kulturen genannt.<ref name="Bütow2" /> Laut Austermann ist die patriarchische Struktur in Ländern wie Mexiko oder auch [[Chile]] ebenfalls Ursache für die Verfolgung von männlichen Emos.<ref name="MasterArbeit" /> In Chile bildet die Emo-Szene zwar eine der größten Jugendkulturen, aber sie wurde wegen ihrer nach außen getragenen Emotionalität und der androgynen bzw. femininen Selbstdarstellung zu einem emotionalen Streitthema.<ref name="Bütow" /> |
|||
| ⚫ | [[Datei:Fuck Emo graffiti.jpg|mini|Dieses Graffiti in [[Tecate (Baja California)|Tecate]], [[Mexiko]] zeigt, dass die Emo-Bewegung nicht allgemein akzeptiert ist.]]Anhänger der Emo-Kultur wird häufig [[Selbstverletzendes Verhalten|autoaggressives Verhalten]] und ein Hang zur [[Suizidalität]] nachgesagt. Ein möglicher Grund hierfür können Veröffentlichungen von Selbstporträts, verziert mit Blut oder Rasierklingen, im Internet sein. Manuel Iber, Gründer des Online-Portals ''emostar.de'' (Deutschlands größte Emo-Community<ref name="MasterArbeit" />), ist der Meinung, dass man diese Bilder als eine Art Kunst verstehen müsse.<ref name="max.de" /> Auch das öffentliche Ausstellen von Sensibilität wird als Grund für die Ablehnung der Szene genannt.<ref name="Tagesspiegel" /> |
||
Viele andere Szenen wie Punk, Gothic, [[Wave (Musik)|Wave]], [[Rap]] oder [[Metal]] haben die Emo-Szene zu einem gemeinsamen Feindbild erklärt.<ref name="max.de">max.de: {{Webarchiv |url=http://www.max.de/lifestyle/gesellschaft/emos/ |text=Emos: Verhasste Jugendbewegung |wayback=20120728080810}}. Abgerufen am 16. Dezember 2021.</ref> Im Gegensatz zur Hip-Hop-Subkultur prangern diese nicht direkt das androgyne Auftreten der Szene an, sondern die Tatsache, dass sich diese an ihrem Stil vergriffen habe und ihn als eigenen Stil verkaufe.<ref name="ZDFinfo" /> Allerdings findet sich in dem mexikanischen Blog ''Movimiento Anti Emo Sexual'' auch ein Beitrag, in dem der Emo mit [[Homosexualität]] gleichgesetzt wird, da Emos weinerlich, androgyn und extrem unmännlich wirkten.<ref name="max.de2">max.de: '' {{Webarchiv |url=http://www.max.de/lifestyle/gesellschaft/emos/238345,1,article,Aufmarsch-der-Emo-Hasser.html |text=Aufmarsch der Emo-Hasser |wayback=20131213175152}}''</ref> |
|||
| ⚫ | Aufgrund dieses Vorurteils, dass Anhänger der Emo-Szene einen Hang zur Selbstverletzung (häufig in Verbindung gebracht mit „Ritzen“,<ref name="Spiegel" /><ref name="JungleWorld">Martin Büsser: [http://jungle-world.com/artikel/2008/33/22417.html ''Die zarteste Versuchung''.] In: ''[[Jungle World]]'', 14. August 2008, abgerufen am 28. Dezember 2012.</ref> dem Aufschneiden von Armen und Beinen mit Rasierklingen, Messern und Scheren etc.) und zum [[Suizid]] hätten, entstanden viele Witze über die Szene, die teilweise [[Diskriminierung|diskriminierend]] wirken<ref name="JungleWorld" /> und vor allem im Internet Verbreitung finden.<ref name="JungleWorld" /> Ebenso wird der Begriff „Emo“ als abwertende Bezeichnung für gefühlvolle Menschen gebraucht und gilt in anderen Szenen als „Beleidigung“.<ref name="Bütow" /><ref name="Bütow5" />{{Zitat |
||
{{Zitat |
|||
|Text=Emo ist das neue Schwul! […] Weil die alle so weinerlich sind. Schwul ist eben das passende Wort für etwas, was irgendwie verweichlicht und scheiße ist. |
|||
|Quelle=Zitat von Unbekannt nach Nordmann (2009), S. 69. |
|||
|ref=<ref name="MasterArbeit" /> |
|||
}} |
|||
Außerdem fanden sich in diesem Blog Beiträge, die zur Hetze und Ermordung von Emos aufforderten. |
|||
{{Zitat |
|||
|Text=Metal-Fans, Punks, Gothics, wir müssen uns zusammentun, um den Emos ein für alle Mal den Garaus zu machen […] Unterstütze dein Vaterland, töte einen Emo. |
|||
|Quelle=Aufruf zur Hetze und Ermordung von Emos im MOVIMIENTO ANTI EMO SEXUAL |
|||
|ref=<ref name="max.de2" />}} |
|||
| ⚫ | |||
[[Datei:Fuck Emo graffiti.jpg|mini|Dieses Graffiti in [[Tecate (Baja California)|Tecate]], [[Mexiko]] zeigt, dass die Emo-Bewegung nicht allgemein akzeptiert ist.]] |
|||
[[Datei:Emo jump spot.jpg|links|mini|Emos wird ein Drang zur [[Selbstverletzendes Verhalten|Selbstverletzung]] und [[Suizidalität]] nachgesagt, wie dieses Graffiti an einer Brücke der [[East Coast Main Line]] zeigt.]] |
|||
| ⚫ | Anhänger der Emo-Kultur wird häufig [[Selbstverletzendes Verhalten|autoaggressives Verhalten]] und ein Hang zur [[Suizidalität]] nachgesagt. Ein möglicher Grund hierfür können Veröffentlichungen von Selbstporträts, verziert mit Blut oder Rasierklingen, im Internet sein. Manuel Iber, Gründer des Online-Portals ''emostar.de'' (Deutschlands größte Emo-Community<ref name="MasterArbeit" />), ist der Meinung, dass man diese Bilder als eine Art Kunst verstehen müsse.<ref name="max.de" /> Auch das öffentliche Ausstellen von Sensibilität wird als Grund für die Ablehnung der Szene genannt.<ref name="Tagesspiegel" /> |
||
| ⚫ | Aufgrund dieses Vorurteils, dass Anhänger der Emo-Szene einen Hang zur Selbstverletzung (häufig in Verbindung gebracht mit „Ritzen“,<ref name="Spiegel" /><ref name="JungleWorld">Martin Büsser: [http://jungle-world.com/artikel/2008/33/22417.html ''Die zarteste Versuchung''.] In: ''[[Jungle World]]'', 14. August 2008, abgerufen am 28. Dezember 2012.</ref> dem Aufschneiden von Armen und Beinen mit Rasierklingen, Messern und Scheren etc.) und zum [[Suizid]] hätten, entstanden viele Witze über die Szene, die teilweise [[Diskriminierung|diskriminierend]] wirken<ref name="JungleWorld" /> und vor allem im Internet Verbreitung finden.<ref name="JungleWorld" /> Ebenso wird der Begriff „Emo“ als abwertende Bezeichnung für gefühlvolle Menschen gebraucht und gilt in anderen Szenen als „Beleidigung“.<ref name="Bütow" /><ref name="Bütow5" /> |
||
{{Zitat |
|||
|Text=Ich selber sehe mich nicht als Emo, denn in der Gesellschaft ist Emo mittlerweile total verrufen. Es sind die, die sich ritzen und depressiv in der Gegend rumlaufen und nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen […] Emo ist im Grunde nur ein Style und die Musik, beides find ich gut, so dass ich im Grunde ein Emo bin. Wannabes sind wir alle, denn nur die aus den Emocorebands sind richtige Emos, denn von denen haben wir es uns ja abgeschaut. |
|Text=Ich selber sehe mich nicht als Emo, denn in der Gesellschaft ist Emo mittlerweile total verrufen. Es sind die, die sich ritzen und depressiv in der Gegend rumlaufen und nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen […] Emo ist im Grunde nur ein Style und die Musik, beides find ich gut, so dass ich im Grunde ein Emo bin. Wannabes sind wir alle, denn nur die aus den Emocorebands sind richtige Emos, denn von denen haben wir es uns ja abgeschaut. |
||
|Quelle=Zitat einer 23-jährigen Frau im Buch ''Körper · Geschlecht · Affekt – Selbstinszenierungen und Bildungsprozesse in jugendlichen Sozialräumen'' |
|Quelle=Zitat einer 23-jährigen Frau im Buch ''Körper · Geschlecht · Affekt – Selbstinszenierungen und Bildungsprozesse in jugendlichen Sozialräumen'' |
||
|ref=<ref name="Bütow5" />}} |
|ref=<ref name="Bütow5" />}} |
||
[[Datei:Diagramm Emo Unsympathisch.svg|mini|Repräsentativumfrage des Institutes für Jugendkulturforschung in Wien und Hamburg im Jahr 2012: deutsche und österreichische Jugendliche im Alter zwischen 16 und 29 Jahren (Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich); die Grafik zeigt, dass Jugendliche lediglich Skinheads unsympathischer empfinden als Emos.]] |
|||
Obwohl die Szene von vielen anderen Szenen nicht anerkannt wird, gilt Emo laut Experten als die Jugendkultur mit dem größten Zulauf. In manchen Ländern wie [[Ägypten]] oder [[Russland]] wurde wegen des androgynen Aussehens bereits diskutiert, die Kultur zu verbieten.<ref>[http://eltern.t-online.de/-emos-und-visus-bei-teenies-boomt-androgynitaet-/id_18993066/index ''„Emos“ und „Visus“: Bei Teenies boomt Androgynität''.] eltern.t-online.de, 22. Dezember 2010; abgerufen am 28. Dezember 2012.</ref> [[Yevgeny Yuryev]] legte der [[Duma]] Anfang Juli 2008 einen Gesetzesentwurf vor, der das Tragen von Emo-Outfits an Schulen verbieten sollte. Als Begründung nannte er, dass Emo [[Depression]]en, [[Perspektivlosigkeit]] und sozialen Rückzug fördere.<ref name="JungleWorld" /> In einem Portal war sogar von [[Kannibalismus]] die Rede.<ref name="Bütow" /> Manche Vertreter sehen die Emo-Szene als einen Erben der [[Hippie]]-Bewegung an, in der es kaum Tabus gebe.<ref name="Tagesspiegel" /> Dokumentationen über die Szene wurden unter anderem über [[ZDFinfo]], dem [[KiKA]], [[ProSieben]]<ref name="Grinik">L. Ginik: ''Emo – Eine Jugendsubkultur.'' S. 42</ref> und [[RTL Television|RTL]]<ref name="Grinik" /><ref name="SZ" /> veröffentlicht. An der RTL-Sendung kritisierten Anhänger der Szene allerdings in Internetforen und sozialen Netzwerken das Klischeedenken über die Szene sowie die mangelnde Objektivität.<ref>Janina: [http://kekse.tanine.com/?p=697 RTL erklärt die Welt – Heute: EMO.] kekse.tanine.com</ref><ref>{{Webarchiv |url=http://www.emo-videos.de/frisuren/rtl-erklaert-emo-oder-versucht-es/ |wayback=20130429040819 |text=''RTL-Bericht erklärt Emo (oder versucht es)''- |archiv-bot=2018-04-08 09:18:00 InternetArchiveBot}} (Beispiel) emo-videos.de</ref> RTL beschrieb ''Emo'' als „Trend zur Selbstverstümmelung“ oder als „Hilfeschrei nach Aufmerksamkeit“, während ProSieben die Szene mit dem [[Borderline-Syndrom]] in Verbindung brachte.<ref name="Grinik" /><ref>[http://www.myvideo.de/watch/4752052/Rtl_erklaert_die_Welt_heute_Emo RTL erklärt die Welt – Heute: Emo.] [[MyVideo]]</ref> Grinik schrieb den beiden Dokumentationen zu, dass im Vordergrund „Blut, Selbstzerstörung und verstörte Eltern“ als Spektakel dienten: |
Obwohl die Szene von vielen anderen Szenen nicht anerkannt wird, gilt Emo laut Experten als die Jugendkultur mit dem größten Zulauf. In manchen Ländern wie [[Ägypten]] oder [[Russland]] wurde wegen des androgynen Aussehens bereits diskutiert, die Kultur zu verbieten.<ref>[http://eltern.t-online.de/-emos-und-visus-bei-teenies-boomt-androgynitaet-/id_18993066/index ''„Emos“ und „Visus“: Bei Teenies boomt Androgynität''.] eltern.t-online.de, 22. Dezember 2010; abgerufen am 28. Dezember 2012.</ref> [[Yevgeny Yuryev]] legte der [[Duma]] Anfang Juli 2008 einen Gesetzesentwurf vor, der das Tragen von Emo-Outfits an Schulen verbieten sollte. Als Begründung nannte er, dass Emo [[Depression]]en, [[Perspektivlosigkeit]] und sozialen Rückzug fördere.<ref name="JungleWorld" /> In einem Portal war sogar von [[Kannibalismus]] die Rede.<ref name="Bütow" /> Manche Vertreter sehen die Emo-Szene als einen Erben der [[Hippie]]-Bewegung an, in der es kaum Tabus gebe.<ref name="Tagesspiegel" /> Dokumentationen über die Szene wurden unter anderem über [[ZDFinfo]], dem [[KiKA]], [[ProSieben]]<ref name="Grinik">L. Ginik: ''Emo – Eine Jugendsubkultur.'' S. 42</ref> und [[RTL Television|RTL]]<ref name="Grinik" /><ref name="SZ" /> veröffentlicht. An der RTL-Sendung kritisierten Anhänger der Szene allerdings in Internetforen und sozialen Netzwerken das Klischeedenken über die Szene sowie die mangelnde Objektivität.<ref>Janina: [http://kekse.tanine.com/?p=697 RTL erklärt die Welt – Heute: EMO.] kekse.tanine.com</ref><ref>{{Webarchiv |url=http://www.emo-videos.de/frisuren/rtl-erklaert-emo-oder-versucht-es/ |wayback=20130429040819 |text=''RTL-Bericht erklärt Emo (oder versucht es)''- |archiv-bot=2018-04-08 09:18:00 InternetArchiveBot}} (Beispiel) emo-videos.de</ref> RTL beschrieb ''Emo'' als „Trend zur Selbstverstümmelung“ oder als „Hilfeschrei nach Aufmerksamkeit“, während ProSieben die Szene mit dem [[Borderline-Syndrom]] in Verbindung brachte.<ref name="Grinik" /><ref>[http://www.myvideo.de/watch/4752052/Rtl_erklaert_die_Welt_heute_Emo RTL erklärt die Welt – Heute: Emo.] [[MyVideo]]</ref> Grinik schrieb den beiden Dokumentationen zu, dass im Vordergrund „Blut, Selbstzerstörung und verstörte Eltern“ als Spektakel dienten: |
||
| Zeile 150: | Zeile 114: | ||
== Literatur == |
== Literatur == |
||
* [[Martin Büsser]], [[Jonas Engelmann]], |
* [[Martin Büsser]], [[Jonas Engelmann]], Ingo Rüdiger: ''Emo – Portrait einer Szene.'' Ventil Verlag, 2013. |
||
| ⚫ | |||
* [[Leonie Mainka]]: ''Jugend und Jugendkulturen im 21. Jahrhundert.'' |
|||
* [[ |
* [[Ronald Hitzler]], [[Arne Niederbacher]]: ''Leben in Szenen: Formen jugendlicher Vergemeinschaftung heute'' Springer Fachmedien, 2010. |
||
* [[Ronald Hitzler]], [[Arne Niederbacher]]: ''Leben in Szenen: Formen jugendlicher Vergemeinschaftung heute'' Springer Fachmedien. |
|||
* L. Grinik, L. John, J. Linse und M. Sauter: ''Emo – Eine Jugendsubkultur'' Grin Verlag, 2011. |
|||
* Julia Austermann: [http://www.mediengeschichte.uni-siegen.de/files/2012/07/M.A.-Arbeit-Julia-Austermann_Darstellungen-m%C3%A4nnlicher-Jugendlicher-in-der-digitalen-Emo-Szene.pdf Darstellungen männlicher ''Jugendlicher in der digitalen Emo-Szene.''] (PDF; 1,0 MB) Master-Arbeit im Studiengang Medienkultur der Universität Siegen, 2011. |
* Julia Austermann: [http://www.mediengeschichte.uni-siegen.de/files/2012/07/M.A.-Arbeit-Julia-Austermann_Darstellungen-m%C3%A4nnlicher-Jugendlicher-in-der-digitalen-Emo-Szene.pdf Darstellungen männlicher ''Jugendlicher in der digitalen Emo-Szene.''] (PDF; 1,0 MB) Master-Arbeit im Studiengang Medienkultur der Universität Siegen, 2011. |
||
* Beate Großegger: ''[https://jugendkultur.at/wp-content/uploads/Dossier_Emo-Szene_Grossegger_2013.pdf Teenage-Angst, Dauerdepression oder „einfach anders“?]'', 2013. |
* Beate Großegger: ''[https://jugendkultur.at/wp-content/uploads/Dossier_Emo-Szene_Grossegger_2013.pdf Teenage-Angst, Dauerdepression oder „einfach anders“?]'', 2013. |
||
Version vom 18. Dezember 2021, 19:51 Uhr

Emo (für Emotional, engl. [], dt. auch []) ist eine Jugendkultur und Modeerscheinung mit Schwerpunkt in den 2000er Jahren.
Die Ursprünge der Szene lagen in den 1990er-Jahren in den USA und der Musikrichtung Emotional Hardcore, die Jugendkultur und ihre Mode fand ihre größte weltweite Ausbreitung etwa von 2000 bis 2015. Die Szene ist dafür bekannt, modische Elemente anderer Subkulturen zu vermischen. In Deutschland gelten das Jugendmagazin Bravo, der Musiker Bill Kaulitz und dessen Band Tokio Hotel als Wegbereiter dieser Szene.[1][2]
Emo wird modisch insbesondere mit schwarzen Haaren und schwarzer Kleidung, Karomuster und Nietengürteln in Verbindung gebracht. Damit verbindet sich eine Lebenseinstellung, in der Gefühle, Weltschmerz und Freundschaft eine große Rolle spielen. Anhängern wurde wegen des Zurschaustellens von Emotionalität ein Hang zur Selbstverletzung und Suizidalität nachgesagt, männliche Anhänger wurden oft pejorativ als unmännlich und homosexuell bezeichnet, unter anderem wegen deren androgyner Erscheinung.
Geschichte
Seit Mitte der 1980er Jahre: das Musikgenre



Der Emotional Hardcore oder Emocore entstand Mitte der 1980er Jahre und ist ein Subgenre des D.C. Hardcore. Als wichtiger Wegbereiter des Genres gelten die US-amerikanische Punk-Bands Rites of Spring und Hüsker Dü, die emotionale Passagen in ihren Liedern verwendeten. Weitere wichtige Vertreter des Genres sind bzw. waren Fugazi und Embrace, die nach der Auflösung von Rites of Spring als wichtigste Vertreter des Emo- und Post-Hardcore galten.[4]
In Deutschland entstanden die ersten Emo-Bands Ende der 1990er Jahre. 1997/98 lag eine der ersten Hochburgen in Göttingen. Vor allem die Gruppen El Mariachi und Katzenstreik prägten die Göttinger Szene. Im deutschsprachigen Raum wird außerdem den Gruppen Angeschissen und Boxhamsters eine gewisse Vorreiterrolle zugesprochen. Im Screamo, einem Subgenre des Emo, existierte die Band Yage, die internationale Maßstäbe setzen konnte.[5] Größere Band-Szenen existierten in und um Hamburg bzw. Schleswig-Holstein, Berlin und im Ruhrgebiet.
Darüber hinaus wird der Genrebegriff Emo seit Ende der 1990er auch für Bands verwendet, die ihre Wurzeln im Indie-Rock haben. So galten The Get Up Kids, Texas Is the Reason, The Promise Ring und Jimmy Eat World[4] als Wegbereiter des Indierock-lastigen Emo, zum Teil auch gegen deren Willen:
„Wir haben zwar Emo aus den achtziger Jahren gehört, werden aber nicht gerne mit diesem Label versehen, weil es eben woanders herkommt als wir. […] wir haben uns immer nur als Rockband auf der Suche nach dem perfekten Song verstanden“
2000er und 2010er Jahre: die Jugendkultur
Etwa seit 2000 entstand die Jugendkultur des Emo, die sich sukzessive vom Musikgenre des Emotional Hardcore entfernte und sich vor allem über eine gefühlsorientierte Lebenseinstellung und das äußere Erscheinen definierte. Das Musikgenre Emo wurde nun vor allem auf Bands angewendet, die mit den Merkmalen dieser Jugendbewegung übereinstimmten.
Während Anhänger des Emocore in den 1980er und 1990er Jahren, wie im Hardcore-Punk üblich, keinem Dresscode folgten, zeichneten sich die Anhänger des Indierock-Emo in den 1990er Jahren durch Hornbrillen, enge Pullover, Westen, Cordhosen, Hemden, Worker-Jackets und Lederschuhe aus. Gegen Ende der 1990er Jahre entstand im Umfeld des Emocore der „Spock-Rock“, geprägt durch Justin Pearson, Sänger der US-amerikanischen Emocore-Band Swing Kids. Charakteristisch für den „Spock-Rock“ waren ein kurzer, gerade geschnittener Pony, ähnlich der Figur Mr. Spock aus der Serie Star Trek.[7][8][9] Zu diesem Zeitpunkt trat das Schwarzfärben der Haare erstmals vermehrt auf. Modisch wies die Spock-Rock-Szene nur wenige Besonderheiten auf, häufig getragen wurden Hochwasserhosen und schwarze, enge T-Shirts.

Modisch griff Emo in den 2000er Jahren verschiedene Elemente der früheren Generationen auf und vermischte sie mit Elementen der Gothic-Mode und Anleihen des Pop-Punk. Emo war bekannt dafür, von anderen Jugendszenen abgelehnt zu werden. Unter anderem warfen Anhänger anderer Szenen ihm vor, sich an anderen Stilen zu bedienen und diese als eigenen Modetrend auszugeben.[10] Britta Schuboth beschreibt, dass die Emo-Szene seit Beginn ihres Bestehens kontrovers diskutiert worden sei und sich dadurch eine negative Zuschreibung in der Öffentlichkeit entwickelte, wodurch die Szene letztlich zur Zielscheibe aggressiv-gewalttätiger Übergriffe wurde.[11]
Mitte der 2010er Jahre verlor Emo in Europa an Bedeutung.[12]
Selbstverständnis
Die Emo-Szene wollte nicht als gesellschaftskritische Jugendkultur, sondern als individuelle Möglichkeit zur Selbstdarstellung verstanden werden. Aus dem Musikstil entwickelte sich eine Mode und Lebenseinstellung, in der Gefühle, Weltschmerz und Freundschaft eine große Rolle spielten.[1] Dabei standen die Gefühle anderer vor den eigenen Gefühlen.[11] Das Alter der Jugendlichen in der Szene lag zwischen 14 und 20 Jahren, selten waren auch ältere Menschen anzutreffen.[13] Grund dafür war unter anderem, dass die Szene auf die „Bedürfnisse Pubertierender zugeschnitten“ war: Innerhalb der Szene durfte man Kind sein und es gab Verständnis für schlechte Laune.[1] Viele Angehörige der Szene stammten aus gutbürgerlichen Familien und der oberen Mittelschicht.[13][2] Der Szene wurde insgesamt ein toleranter und offener Umgang untereinander nachgesagt.[14]
Anhänger der Emo-Jugendkultur ordneten sich selbst verschiedenen Kategorien zu, beispielsweise „echter Emo“, „Emo Kiddie“ und „Möchtegern“ (engl. wannabe). Letztere wurden vor allem über äußere und modische Merkmale definiert.[15]
Die Emo-Bewegung präsentierte sich überwiegend introvertiert. Das Zurschaustellen von Emotionen und Gefühlen, etwa in Form von Gedichten, war ein Hauptbestandteil der Szene und zog unter anderen Jugendlichen Spott auf sich.[16] Auch die Androgynie der Anhänger und die Tatsache, dass sich Jungen schminkten und auf ihr Aussehen achteten,[15] wurde mit der Begründung kritisiert, dass so die typische Rollenverteilung von Mann und Frau „aufgelöst“ werde.[15]
„Geschlechterbezogene Identitätsarbeit ist immer auch Inszenierungsarbeit und -praxis, spielt mit verschiedenen Darstellungsformen, bezieht sich in verschiedener Form auf Geschlechterdiskurse und provoziert, dass die Akteur/innen je nach Inszenierung auch oft in Diskurse ‚hineingerufen‘ werden. Dies kann am Beispiel männlicher Inszenierungen in der Emo-Szene gezeigt werden, die aufgrund ihrer latenten Provokation von Männlichkeitsstereotypen und damit auch von Heteronormativität interaktiv und für die Beteiligten häufig auch diskursiv und reflexiv werden.“
Die Emo-Szene war stark im Internet aktiv; allein im sozialen Netzwerk Facebook existierten annähernd 500 verschiedene „Emo“-Gruppen, in denen unter anderem Treffen, sogenannte „Emotreffs“, organisiert wurden.[18] Beispielsweise fand 2009 in Stuttgart eines der größten Treffen mit mehreren hundert Teilnehmern statt.[19]
Elemente
Musik
Der Emocore hat seine Wurzeln im Hardcore-Punk, orientiert sich aber auch am Alternative Rock und am Pop-Punk. Emocore wendet sich anders als diese Genres besonders dem Individuum und dem persönlichen Leiden als Hauptmotiv zu.[20] Den Individualitäts- und Leidensfokus haben das Genre und die heutige Jugendkultur gemeinsam, wobei die Musik im Laufe der Zeit in den Hintergrund rückte.[21]
In unterschiedlicher Intensität werden unter anderem die dem Post-Hardcore und Metalcore zugehörigen Bands Black Veil Brides, Pierce the Veil, Senses Fail, Alesana, Hawthorne Heights, Chiodos als typische Beispiele der Genres Emo oder Screamo gesehen. Auch die US-amerikanische Artrock-Band Blue October wurde wegen ihres Musikstils bereits als Vertreter des Emo bezeichnet.[22] In Deutschland wird die Band Tokio Hotel mit Emo verbunden, jedoch ist diese bei den Anhängern der Szene unbeliebt.[2] Mit steigender Popularität der Jugendkultur wurden auch viele – teilweise kommerziell erfolgreiche – Bands, die musikalisch stärker dem Alternative Rock,[23] Post-Hardcore[24] oder Metalcore[25] zugeordnet werden, als Emo bezeichnet. Laut Ronald Hitzler stand die Emo-Kultur im Gegensatz zur Antifa- und zur Hardcore-Punk-Szene der Kommerzialisierung innerhalb der Musikbranche nicht ganz ablehnend gegenüber.[26]
Mode
Die Kleidermode der Emo-Szene setzte sich zum Teil aus Elementen anderer Szenen zusammen. Dazu zählten Nietengürtel (ursprünglich aus der Punk-Szene), Skater-Schuhe (Converse Chucks aus dem Grunge und Vans aus der Skater-Kultur)[13], schwarzgefärbte Haare mit einem asymmetrisch getragenen Pony und Schwarz als Grundfarbe der Kleidung (u. a. aus der Gothic-Szene) und Karomuster (aus dem Rockabilly). Schwarze Kleidung wurde oft durch grelle Farbmuster kontrastiert.[19][15] Beliebte Kleidungsstücke waren Röhrenjeans[27] und Miniröcke.[15] Hinzu kam Dinge, die als „süß“ galten, wie etwa Hello-Kitty-Accessoires, und düstere Symbole, etwa Totenköpfe und Skelette.[13] Ebenso gehörte zum Stil eine Pony-Frisur, mit Kajal umrandete Augen und Piercings (meist Labret-Piercings, aber auch Tunnels).[10]
„Emo an sich hat einfach probiert, verschiedene Elemente zu einem zusammenzufügen. Das, was gut ist aus den verschiedenen Richtungen, einfach zu einem zu machen, und daraus ist dann einfach Emo geworden.“
Mode-Labels wie Cupcake Cult oder Heartless waren in der Szene beliebt. Die T-Shirt-Motive zeigten beispielsweise Zeichentrick- oder Anime-Figuren, Horrorfilm-Protagonisten oder Bands aus der Metalcore-, Post-Hardcore- und Deathcore-Szene.[15]
Ein zentrales Motiv in der Emo-Mode war die Rasierklinge, die zum Beispiel als Ohrring oder als Gürtelschnalle getragen wurde.[15]
Gesellschaftliche Stellung
Emo wurde als „die erste Jugendszene, in der sich Jungs an Mädchen anpassen“ beschrieben, die somit „das Rollenmodell auf den Kopf“ stellte.[13] Als Beispiele wurden Merkmale wie lange Haare und Schminke genannt; diese waren allerdings schon vorher in anderen Szenen zu finden, etwa bei Hippies, im Glam Rock und den New Romantics.
Ablehnung und Hass

Obwohl die Emo-Szene zu den kleinsten Jugendszenen in der Jugendkulturlandschaft der 2010er Jahre gezählt wurde, erlangte sie große öffentliche Aufmerksamkeit. Zusammen mit der Skinhead-, der Gothic- und der Punk-Szene stieß sie auf breite Ablehnung und negative Vorurteile.[29]
In der Gesellschaft der Gleichaltrigen wurde Emos vorgeworfen, sie seien oberflächliche „Style-Victims“ und morbide „Pseudos“, Emos seien verweichlichte Kinder einer degenerierten Mittelschicht oder „Transvestitengesindel“.[30] Szenen wie Punk, Gothic, Wave, Rap oder Metal erklärten die Emo-Szene aufgrund der übernommenen modischen Elemente zum Feindbild.[31][19]
Die starke Ablehnung der Emo-Szene führte wiederholt zu gewaltsamen Angriffen auf Angehörige der Emo-Szene.[21] So schlossen sich in Mexiko im April 2008 etwa tausend Punks zusammen, um „Emos aus der Stadt zu jagen“.[32][33] In Chile bildete die Emo-Szene zwar eine der größten Jugendkulturen, wurde aber wegen ihrer nach außen getragenen Emotionalität und der androgynen bzw. femininen Selbstdarstellung zum Streitthema.[21] Männliche Emos wurden pejorativ als verweichlicht und homosexuell bezeichnet und dafür auch körperlich angegriffen.[15]
Anfang 2012 wurden im Irak 90 Jugendliche von religiösen Milizen gesteinigt, da sie der Emo-Szene angehörten. Ihnen wurde vom Innenministerium eine Nähe zum Satanismus unterstellt.[34][35] Auch in Saudi-Arabien wurden 2010 zehn Mädchen, die der Emo-Szene angehörten, von der Polizei wegen Unruhestiftung inhaftiert.[36] In der Türkei wurden Emos als eine Gefahr für die religiösen und konservativen Werte des Landes angesehen.[21]
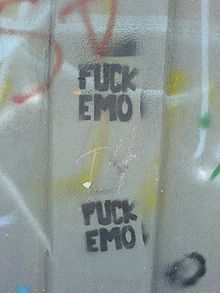
Anhänger der Emo-Kultur wird häufig autoaggressives Verhalten und ein Hang zur Suizidalität nachgesagt. Ein möglicher Grund hierfür können Veröffentlichungen von Selbstporträts, verziert mit Blut oder Rasierklingen, im Internet sein. Manuel Iber, Gründer des Online-Portals emostar.de (Deutschlands größte Emo-Community[15]), ist der Meinung, dass man diese Bilder als eine Art Kunst verstehen müsse.[31] Auch das öffentliche Ausstellen von Sensibilität wird als Grund für die Ablehnung der Szene genannt.[30] Aufgrund dieses Vorurteils, dass Anhänger der Emo-Szene einen Hang zur Selbstverletzung (häufig in Verbindung gebracht mit „Ritzen“,[13][37] dem Aufschneiden von Armen und Beinen mit Rasierklingen, Messern und Scheren etc.) und zum Suizid hätten, entstanden viele Witze über die Szene, die teilweise diskriminierend wirken[37] und vor allem im Internet Verbreitung finden.[37] Ebenso wird der Begriff „Emo“ als abwertende Bezeichnung für gefühlvolle Menschen gebraucht und gilt in anderen Szenen als „Beleidigung“.[11][14]
„Ich selber sehe mich nicht als Emo, denn in der Gesellschaft ist Emo mittlerweile total verrufen. Es sind die, die sich ritzen und depressiv in der Gegend rumlaufen und nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen […] Emo ist im Grunde nur ein Style und die Musik, beides find ich gut, so dass ich im Grunde ein Emo bin. Wannabes sind wir alle, denn nur die aus den Emocorebands sind richtige Emos, denn von denen haben wir es uns ja abgeschaut.“
Obwohl die Szene von vielen anderen Szenen nicht anerkannt wird, gilt Emo laut Experten als die Jugendkultur mit dem größten Zulauf. In manchen Ländern wie Ägypten oder Russland wurde wegen des androgynen Aussehens bereits diskutiert, die Kultur zu verbieten.[38] Yevgeny Yuryev legte der Duma Anfang Juli 2008 einen Gesetzesentwurf vor, der das Tragen von Emo-Outfits an Schulen verbieten sollte. Als Begründung nannte er, dass Emo Depressionen, Perspektivlosigkeit und sozialen Rückzug fördere.[37] In einem Portal war sogar von Kannibalismus die Rede.[11] Manche Vertreter sehen die Emo-Szene als einen Erben der Hippie-Bewegung an, in der es kaum Tabus gebe.[30] Dokumentationen über die Szene wurden unter anderem über ZDFinfo, dem KiKA, ProSieben[39] und RTL[39][1] veröffentlicht. An der RTL-Sendung kritisierten Anhänger der Szene allerdings in Internetforen und sozialen Netzwerken das Klischeedenken über die Szene sowie die mangelnde Objektivität.[40][41] RTL beschrieb Emo als „Trend zur Selbstverstümmelung“ oder als „Hilfeschrei nach Aufmerksamkeit“, während ProSieben die Szene mit dem Borderline-Syndrom in Verbindung brachte.[39][42] Grinik schrieb den beiden Dokumentationen zu, dass im Vordergrund „Blut, Selbstzerstörung und verstörte Eltern“ als Spektakel dienten:
„Im Vordergrund steht in den Beiträgen von ProSieben und RTL das Spektakel – Blut, Selbstzerstörung und verstörte Eltern.“
Auch Printmedien wie die Rheinpfalz am Sonntag äußerten sich negativ und herablassend über die Szene.
„Gegen die Übel dieser Welt hilft nur eines: depressiv sein, jammern, heulen und sich mit Rasierklingen in die Arme ritzen, bis Blut fließt. Innerer Schmerz muss nach außen getragen werden. Das glauben Sie nicht? Dann fragen sie mal bei Jugendlichen nach. Es gibt eine Szene, die das als ihre Lebenseinstellung deklariert. So wie andere aus Liebe zum Fußball allsamstäglich ins Stadion gehen, sitzen sie grüppchenweise stundenlang deprimiert auf Parkbänken und bedauern sich selbst.“
In der Erwachsenengesellschaft herrscht laut Beate Großegger das Klischeebild vom Emo als „Ritzer“. Die mediale und öffentliche Debatte stelle die Szene als eine Problemzone dar: Emo mache depressiv, verleite Jugendliche zu selbstverletzendem Verhalten oder fördere sogar Suizidgedanken.[43] Großegger stellte fest, dass eine vorurteilsfreie Auseinandersetzung mit der Kultur, dem Selbstverständnis und der Geschichte der Emos kaum existiere. So finde die Entstehung dieser Jugendkultur aus dem Hardcore Punk, der seinerseits in den späten 1970er-Jahren aus der Punk-Bewegung hervorging, in der öffentlichen Debatte kaum Erwähnung. Auch wofür die Szene steht, interessiere kaum jemanden.[43]
Seit 2005 strahlt der britische Sender MTV2 die Serie Mighty Moshin’ Emo Rangers aus. Sie ist eine Parodie der Power Rangers und wendet sich negativ an die Emo-Szene. Bis heute entstanden insgesamt neun Episoden in zwei Staffeln. Eine Episode ist knapp fünf Minuten lang.[44] Der Eröffnungssong der Kurzfilmserie wurde von der britischen Post-Hardcore-Band Fei Comodo eingespielt, die oft mit der Emo-Kultur in Verbindung gebracht wurde.[45] Auf Newgrounds existierte sogar ein Flash-Videospiel unter dem Titel Go Go Emo Rangers.
Literatur
- Martin Büsser, Jonas Engelmann, Ingo Rüdiger: Emo – Portrait einer Szene. Ventil Verlag, 2013.
- Birgit Bütow (Hrsg.): Körper, Geschlecht, Affekt: Selbstinszenierungen und Bildungsprozesse in jugendlichen Sozialräumen, Springer Fachmedien, 2013.
- Ronald Hitzler, Arne Niederbacher: Leben in Szenen: Formen jugendlicher Vergemeinschaftung heute Springer Fachmedien, 2010.
- Julia Austermann: Darstellungen männlicher Jugendlicher in der digitalen Emo-Szene. (PDF; 1,0 MB) Master-Arbeit im Studiengang Medienkultur der Universität Siegen, 2011.
- Beate Großegger: Teenage-Angst, Dauerdepression oder „einfach anders“?, 2013.
Weblinks
- Emo, Skater, Punk - Wie funktionieren Subkulturen? Klub Konkret, 2016, auf youtube.com
- RBB Stilbruch über Emo auf youtube.com
- Emos in Zürich, Schweizer Fernsehen, 2009, auf youtube.com
- ZDFinfo: JugendKULTur – Emo, 2009, von Monja Eigenschenk
- "Ich bin irgendwie anders", 2020, edit-magazin.de
Einzelnachweise
- ↑ a b c d Akiko Lachenmann: Die Emo-Szene: Im Rausch der Gefühle. ( vom 1. Januar 2013 im Internet Archive) Stuttgarter Zeitung, 14. Januar 2009; abgerufen am 3. August 2013.
- ↑ a b c Enrico Ippolito: Emo-Bewegung: Gegen Spießer. In: TAZ, 20. März 2012, abgerufen am 28. Dezember 2012.
- ↑ Gregory Heaney: Sleeping with Sirens – Biography. billboard.com; abgerufen am 25. März 2013.
- ↑ a b Origin of Emo auf angelfire.com (Archivlink). Abgerufen am 16. Dezember 2021.
- ↑ Yage. In: metalorgie.com. Abgerufen am 16. Dezember 2021 (französisch).
- ↑ FUZE Magazine, Nr. 7, Dezember 2007/Januar 2008; S. 20.
- ↑ An Interview with Robert Bray of the Locust (englisch)
- ↑ Interview with Justin Pearson. skatepunk.com (englisch)
- ↑ Swing Kids. sandiegoreader.com (englisch)
- ↑ a b Emos: Mainstream frisst Subkultur. ( vom 13. Dezember 2013 im Internet Archive) max.de
- ↑ a b c d Britta Schuboth: „Männlichkeitskonstruktionen in der Jugendkultur Emo und ihr aggressionsgeladenes Echo“. In: Birgit Bütow: Körper · Geschlecht · Affekt: Selbstinszenierungen und Bildungsprozesse in jugendlichen Sozialräumen, S. 83.
- ↑ Dennis Sand: Emo ist tot: Ein Nachruf. In: DIE WELT. 12. Dezember 2014 (welt.de [abgerufen am 16. Dezember 2021]).
- ↑ a b c d e f Carola Padtberg: Jugendkultur Emo – Entdeck das Mädchen in dir. SCHULSpiegel, erschienen am 11. März 2010, abgerufen am 28. Dezember 2012.
- ↑ a b c Birgit Bütow: Körper · Geschlecht · Affekt: Selbstinszenierungen und Bildungsprozesse in jugendlichen Sozialräumen. S. 89–92.
- ↑ a b c d e f g h i Julia Austermann: Darstellungen männlicher Jugendlicher in der digitalen Emo-Szene. (PDF; 1,0 MB) Master-Arbeit an der Uni Siegen, 2011.
- ↑ Belächelt und gehasst – Emos und Männlichkeit. ( vom 4. August 2013 im Internet Archive) der-z-weite-blick.de. Abgerufen am 16. Dezember 2021.
- ↑ "Jugendkulturelles Rauschtrinken – Gender-Inszenierungen in informellen Gruppen." In: Körper · Geschlecht · Affekt: Selbstinszenierungen und Bildungsprozesse in jugendlichen Sozialräumen., 2013, S. 45.
- ↑ Birgit Bütow: Körper · Geschlecht · Affekt: Selbstinszenierungen und Bildungsprozesse in jugendlichen Sozialräumen. S. 88
- ↑ a b c JugendKULTur_ Emo (Teil 1), ZDFinfokanal, Oktober 2009, auf youtube.com. Abgerufen am 16. Dezember 2021.
- ↑ Ronald Hitzler, Arne Niederbacher: Leben in Szenen: Formen juveniler Vergemeinschaftung heute, 2010, S. 82.
- ↑ a b c d Britta Schuboth: Männlichkeitskonstruktionen in der Jugendkultur Emo und ihr aggressionsgeladenes Echo. In: Birgit Bütow, Ramona Kahl, Anna Stach (Hrsg.): Körper • Geschlecht • Affekt. Selbstinszenierungen und Bildungsprozesse in jugendlichen Sozialräumen. Springer, Wiesbaden 2013, S. 83–97, doi:10.1007/978-3-531-18998-7_5.
- ↑ Die Texaner präsentieren ihr siebtes Studioalbum „Any Man In America“. ( vom 22. November 2011 im Internet Archive) In: Stuttgarter Zeitung, 15. November 2011
- ↑ bands.rock-im-park.de abgerufen am 26. Dezember 2007; Zitat: „[…] katapultierte die Band (My Chemical Romance, Annahme der Redaktion) aus New Jersey gleich bis an die Spitze des Screamo/Emocore-Genres.“
- ↑ arte.tv ( vom 29. Januar 2008 im Internet Archive) abgerufen am 26. Dezember 2007; Zitat aus dem arte-Magazin Tracks: „Alexisonfire ist Kanadas Vorführ-Export im Genre Emo. […] Sie spielen mit den Genres, haben aber auch kein großes Problem mit dem Stempel Emo.“
- ↑ „Bisher war ich in der Screamo-Emo-Schiene mit […] MY CHEMICAL ROMANCE eigentlich sehr gut bedient, und so stellte sich schnell die Frage, ob der für BULLET FOR MY VALENTINE im Plattenregal freigehaltene Platz sinnvoll ist.“ Powermetal-Reviews abgerufen am 26. Dezember 2007.
- ↑ Ronald Hitzler, Arne Niederbacher: Leben in Szenen: Formen juveniler Vergemeinschaftung heute. S. 194 (erschienen in zweiter Auflage 2005 im VS Verlag für Sozialwissenschaften)
- ↑ Emo-Kleidung (Beispiel). ( vom 26. Dezember 2012 im Internet Archive) emo-style.net. Abgerufen am 16. Dezember 2021.
- ↑ Was wollen Emos? Youtube
- ↑ Beate Großegger: Teenage-Angst, Dauerdepression oder „einfach anders“? Jugendkulturen im Fokus: Die Emo-Szene – Mythen und Fakten. Hrsg.: Institut für Jugendkulturforschung. 2013 (jugendkultur.at [PDF]).
- ↑ a b c Jan Oberländer: Wer sind die eigentlich? Findet Emo. In: Tagesspiegel, 4. Juli 2008, abgerufen am 28. Dezember 2012
- ↑ a b max.de: Emos: Verhasste Jugendbewegung ( vom 28. Juli 2012 im Internet Archive). Abgerufen am 16. Dezember 2021.
- ↑ Sebastian Hofer: Jugendgewalt in Mexiko – Töte einen Emo, Spiegel Online, 6. April 2010, abgerufen am 28. Dezember 2012
- ↑ Birgit Bütow: Körper Geschlecht Affekt: Selbstinszenierungen und Bildungsprozesse in jugendlichen Sozialräumen. S. 84: Männlichkeitskonstruktionen in der Jugendkultur Emo und ihr aggressionsgeladenes Echo.
- ↑ Florian Flade: Irak: Milizen sollen 90 Emo-Jugendliche gesteinigt haben, Welt Online, 12. März 2012, abgerufen am 28. Dezember 2012.
- ↑ Florian Flade, Dietrich Alexander: Auf der Todesliste, weil sie Schwarz tragen. Welt Online, 12. März 2012; abgerufen am 31. Dezember 2012
- ↑ Saudi ‘emo’ girls busted by religious cops, 23. Mai 2010, abgerufen am 28. Dezember 2012.
- ↑ a b c d Martin Büsser: Die zarteste Versuchung. In: Jungle World, 14. August 2008, abgerufen am 28. Dezember 2012.
- ↑ „Emos“ und „Visus“: Bei Teenies boomt Androgynität. eltern.t-online.de, 22. Dezember 2010; abgerufen am 28. Dezember 2012.
- ↑ a b c d e L. Ginik: Emo – Eine Jugendsubkultur. S. 42
- ↑ Janina: RTL erklärt die Welt – Heute: EMO. kekse.tanine.com
- ↑ RTL-Bericht erklärt Emo (oder versucht es)- ( des vom 29. April 2013 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (Beispiel) emo-videos.de
- ↑ RTL erklärt die Welt – Heute: Emo. MyVideo
- ↑ a b Beate Großegger: Teenage-Angst, Dauerdepression oder „einfach anders“? – Jugendkulturen im Fokus: Die Emo-Szene – Mythen und Fakten. (PDF; 1,0 MB) Wien 2013, S. 10.
- ↑ Emo Rangers. Offizielle Homepage (englisch)
- ↑ Fei Comodo – Go, Go! Emo Rangers. Youtube