„Bundesrat (Schweiz)“ – Versionsunterschied
| [gesichtete Version] | [ungesichtete Version] |
K Änderungen von 81.221.12.109 (Diskussion) wurden auf die letzte Version von Badener zurückgesetzt |
|||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
== Departementsprinzip == |
== Departementsprinzip == |
||
Di sieben Bundesräte regieren eigentlich gemeinsam über alle Geschäfte, aber in der Praxis stehen sie als ''«Departementsvorsteher»'' je einem Bereich der Bundesverwaltung vor (Departementalprinzip) und sind dadurch vergleichbar mit [[Minister]]n anderer Länder; umgangssprachlich beziehungsweise in den Medien ist die Bezeichnung ''«Minister»'' für die Departementsvorsteher auch üblich. Einen [[Regierungschef]] mit [[Richtlinienkompetenz]] gibt es aber explizit nicht. |
|||
Die Verteilung der Departemente wird jeweils nach der Bundesratswahl durch die Bundesräte selber vorgenommen, es gibt kein Mitwirkungsrecht des Parlaments. Dabei wird nach dem ''«[[Anciennität]]sprinzip»'' vorgegangen: Der amtsälteste Bundesrat wählt zuerst sein Departement, anschliessend der zweitälteste und so weiter. Dem neugewählten Bundesrat wird das verbleibende Departement zugeteilt. Darüber hinaus sind alle Bundesräte auch für sämtliche Geschäfte der anderen Departemente mit zuständig und haben dadurch erhebliche Mitsprache- und Einflussmöglichkeiten. |
Die Verteilung der Departemente wird jeweils nach der Bundesratswahl durch die Bundesräte selber vorgenommen, es gibt kein Mitwirkungsrecht des Parlaments. Dabei wird nach dem ''«[[Anciennität]]sprinzip»'' vorgegangen: Der amtsälteste Bundesrat wählt zuerst sein Departement, anschliessend der zweitälteste und so weiter. Dem neugewählten Bundesrat wird das verbleibende Departement zugeteilt. Darüber hinaus sind alle Bundesräte auch für sämtliche Geschäfte der anderen Departemente mit zuständig und haben dadurch erhebliche Mitsprache- und Einflussmöglichkeiten. |
||
Version vom 7. Oktober 2011, 09:36 Uhr
| Bundesrat | |
|---|---|
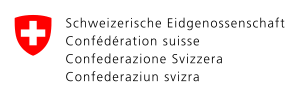 | |
| Staatliche Ebene | Bund |
| Stellung | Oberste leitende und vollziehende Behörde |
| Gründung | 16. November 1848 |
| Hauptsitz | Bundeshaus, Bern |
| Vorsitz | Micheline Calmy-Rey, Bundespräsidentin 2011 |
| Website | www.admin.ch/br |

Johann Schneider-Ammann
Didier Burkhalter
Doris Leuthard
Micheline Calmy-Rey (Bundespräsidentin 2011)
Eveline Widmer-Schlumpf (Vizepräsidentin 2011)
Ueli Maurer
Simonetta Sommaruga
Corina Casanova (Bundeskanzlerin)

Der Bundesrat (französisch Conseil fédéral, italienisch Consiglio federale, rätoromanisch Cussegl federal) ist die Bundesregierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft und gemäss Art. 174 der Bundesverfassung die Vorlage:"-de-CH. Die einzelnen Mitglieder werden ebenfalls «Bundesrat» oder «Bundesrätin» genannt; falls es aus sprachlichen Gründen nötig ist, zwischen der Behörde und dem einzelnen Mitglied zu unterscheiden, wird erstere auch «Gesamtbundesrat» genannt.
Als Kollegialbehörde (Art. 177 Abs. 1 BV) unterscheidet sich der Bundesrat teils erheblich von den Regierungen anderer demokratischer Staaten. Er besteht aus sieben gleichberechtigten, von der Vereinigten Bundesversammlung fest auf vier Jahre gewählten Mitgliedern. Der Bundesrat als Ganzes (und nicht der Bundespräsident) übt auch die protokollarischen Funktionen aus, die in anderen Ländern dem Staatsoberhaupt obliegen (ein solches sieht die Bundesverfassung nicht vor).
Bei der Schaffung des Bundesrates dienten das französische Direktorium der Revolutionszeit und antike griechische Behörden (Archonten) als Vorbild. Die Schweiz ist das einzige Land der Welt, welches dieses System angepasst und anstelle eines Westminster-Systems oder eines präsidentiellen Regierungssystems als Regierungsform übernommen hat.[1]
Seit der Wahl von Simonetta Sommaruga in den Ersatzwahlen 2010 haben Frauen erstmals eine Mehrheit im Bundesrat.[2]
Wahl
Die Mitglieder des Bundesrates werden von der Vereinigten Bundesversammlung mit absolutem Mehr gewählt. Verschiedene Versuche zur Einführung der Volkswahl des Bundesrates blieben bisher erfolglos. Jeweils in der ersten Session des neu gewählten Nationalrates, also zu Beginn seiner vierjährigen Legislaturperiode, findet eine Gesamterneuerungswahl des Bundesrates statt. Dazwischen werden jährlich von der Vereinigten Bundesversammlung aus den Bundesratsmitgliedern der Präsident und der Vizepräsident des Bundesrates für das kommende Jahr bestimmt. Falls ein einzelner Bundesrat vor Ablauf der Amtszeit zurücktritt, wird ein Nachfolger gewählt, der aber nur bis zur nächsten Gesamterneuerungswahl gewählt ist.
Wählbar ist grundsätzlich jeder stimmberechtigte Schweizer Bürger. Bei jeder Wahl melden sich einige Bewerber aus dem «gewöhnlichen Volk». Im Laufe der Geschichte hat sich jedoch ein nicht leicht darzustellendes Wahlverfahren mit zahlreichen geschriebenen und ungeschriebenen Regeln entwickelt, dessen Ziel eine möglichst «gerechte», ausgewogene Vertretung der Bevölkerung im Sinne der schweizerischen Konkordanzdemokratie ist.
Das Verfahren richtet sich nach Art. 175 BV[3] und Art. 130, 131, 132, 133 und 134 ParlG.[4]
Da ein parlamentarisches Misstrauensvotum in der Verfassung nicht vorgesehen ist, können Bundesräte während der Legislaturperiode nicht abgesetzt werden. Auch eine Nichtwiederwahl eines amtierenden Bundesrates ist nicht üblich und geschah seit 1848 erst viermal, in jüngster Zeit wurden am 10. Dezember 2003 Bundesrätin Ruth Metzler-Arnold und am 12. Dezember 2007 Bundesrat Christoph Blocher nicht wiedergewählt. Daraus ergibt sich auch eine sehr lange Amtsdauer der Bundesräte (rund zehn Jahre im Durchschnitt). Der längstdienende Bundesrat war Karl Schenk von 1864 bis 1895; die längstdienenden Bundesräte im 20. Jahrhundert waren Giuseppe Motta von 1911 bis 1940 und Philipp Etter von 1934 bis 1959.
Bis 2009 war auch das Vorgehen im Falle einer dauernden Handlungsunfähigkeit eines Bundesrates nicht geregelt. Als Bundesrat Jean Bourgknecht im Mai 1962 einen Schlaganfall erlitt, wurde das damit entstandene Problem der Amtsunfähigkeit eines Mitgliedes des Bundesrates ad hoc gelöst, wenn auch aus heutiger Sicht auf rechtlich problematische Art und Weise, indem drei Familienangehörige des Bundesrates am 3. September 1962 in seinem Namen den Rücktritt erklärten. Diese Lücke wurde erst nach einer parlamentarischen Initiative von 2005[5] mit der Revision des Parlamentsgesetzes vom 3. Oktober 2008[6] (Inkrafttreten am 2. März 2009) geschlossen. Dessen Art. 140a[7] legt nun fest, dass im Falle einer voraussichtlich langandauernden Amtsunfähigkeit eines Mitglieds des Bundesrates infolge schwerwiegender gesundheitlicher Probleme oder Einwirkungen, die ihn daran hindern, an seinen Arbeitsplatz zurückzukehren, die Vereinigte Bundesversammlung auf Antrag des Büros derselben oder des Bundesrates die Amtsunfähigkeit feststellt.
Gemäss dem Parlamentsgesetz kann ein Bundesrat nicht zugleich Mitglied des Parlaments sein.[8] Trotzdem pflegen die Bundesräte üblicherweise einen regen Kontakt mit der Fraktion ihrer Partei und nehmen an den Fraktionssitzungen mit beratender Stimme teil, dürfen aber – im Gegensatz zu Fraktionsmitgliedern – weder Anträge stellen noch abstimmen.
Departementsprinzip
Di sieben Bundesräte regieren eigentlich gemeinsam über alle Geschäfte, aber in der Praxis stehen sie als «Departementsvorsteher» je einem Bereich der Bundesverwaltung vor (Departementalprinzip) und sind dadurch vergleichbar mit Ministern anderer Länder; umgangssprachlich beziehungsweise in den Medien ist die Bezeichnung «Minister» für die Departementsvorsteher auch üblich. Einen Regierungschef mit Richtlinienkompetenz gibt es aber explizit nicht.
Die Verteilung der Departemente wird jeweils nach der Bundesratswahl durch die Bundesräte selber vorgenommen, es gibt kein Mitwirkungsrecht des Parlaments. Dabei wird nach dem «Anciennitätsprinzip» vorgegangen: Der amtsälteste Bundesrat wählt zuerst sein Departement, anschliessend der zweitälteste und so weiter. Dem neugewählten Bundesrat wird das verbleibende Departement zugeteilt. Darüber hinaus sind alle Bundesräte auch für sämtliche Geschäfte der anderen Departemente mit zuständig und haben dadurch erhebliche Mitsprache- und Einflussmöglichkeiten.
Der siebenköpfige Bundesrat wird durch den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin unterstützt. Dieser bzw. diese leitet die Schweizerische Bundeskanzlei (BK), die Stabsstelle des Bundesrates.
Kollegialitätsprinzip

Die Beschlüsse des Bundesrates werden durch das Kollegium mit Mehrheitsentscheid getroffen und müssen dann vom zuständigen Departementsvorsteher vor Parlament und Öffentlichkeit auch dann vertreten werden, wenn dieser den getroffenen Entscheid eigentlich ablehnt (Kollegialitätsprinzip). Dabei regelt die Bundesverfassung im Grunde nur die Form der Entscheidungsfindung (Art. 177 Abs. 1 BV: Vorlage:"-de-CH), ohne sich zur Handhabung des Prinzips sonst, insbesondere zum Verhalten der Mitglieder des Bundesrats nach getroffenen Entscheiden, weiter zu äussern. Von altersher wurde es ausnahmsweise als zulässig erachtet, dass ein Bundesrat eine vom Gesamtbundesrat abweichende Meinung öffentlich kundtut, wenn er sich auf Gewissensgründe beruft und die Entscheidung nicht unter der Bearbeitung des eigenen Departements fällt. Es ist in letzter Zeit jedoch immer öfter zu beobachten, dass einzelne Bundesräte Entscheide des Kollegiums mehr oder weniger offen zu desavouieren versuchen. So werden Sinn und Unsinn des Kollegialitätsprinzips auch immer wieder in den Medien und in politischen Gremien thematisiert.
Bedeutsame Unterschiede zwischen Regierungsmitgliedern anderer Länder und den Schweizer Bundesräten bestehen darin, dass ein Bundesrat zugleich noch Teil des Staatsoberhauptes ist und dass es keinen richtigen Regierungschef mit Weisungsbefugnis oder wenigstens Richtlinienkompetenz gibt. Dazu kommt die Tatsache, dass ein Bundesrat auf eine Periode von vier Jahren fest gewählt ist. Der Bundespräsident hat im Vergleich zu den übrigen Bundesräten selbst im äussersten Fall nur den Stichentscheid bei einer sonst unentschiedenen Abstimmung im Gesamtbundesrat.
Bundespräsident und Vizepräsident
Die Vereinigte Bundesversammlung wählt jedes Jahr aus den sieben Bundesräten den Bundespräsidenten sowie den Vizepräsidenten des Bundesrates. Gemäss Tradition werden diese Positionen der Reihe nach allen Mitgliedern des Bundesrates übertragen. Ein neues Bundesratsmitglied wird üblicherweise erst zum Vizepräsidenten und anschliessend zum Bundespräsidenten gewählt, nachdem es unter dem Präsidium aller amtsälteren Kollegen gewirkt hat. Der Bundespräsident kann nicht als Staatsoberhaupt oder als Regierungschef der Schweiz bezeichnet werden, da er als erster unter Gleichen (→ primus inter pares) keine erweiterten Rechte hat. Ihm werden Repräsentationsaufgaben als Stellvertreter des Gesamtbundesrates übergeben, und er leitet die Bundesratssitzungen.
Weil die Schweiz kein Staatsoberhaupt hat, pflegt sie auch keine Staatsbesuche abzustatten. Wenn sich der Bundespräsident ins Ausland begibt, dann tut er dies nur als zuständiger Departementsvorsteher. Jedoch gelten hier auch Ausnahmen. So vertritt der Bundespräsident die Schweiz an Versammlungen von Staatsoberhäuptern (beispielsweise an der Generalversammlung der Vereinten Nationen).
Gemäss der protokollarischen Rangordnung in der Schweiz ist der Bundespräsident der höchste Schweizer. Im Jahr 2011 ist Micheline Calmy-Rey Bundespräsidentin und Eveline Widmer-Schlumpf Vizepräsidentin.
Zauberformel
In der Schweiz herrscht eine Konkordanzdemokratie. Unter der Konkordanz wird der Wille verstanden, möglichst viele verschiedene Parteien, Minderheiten und gesellschaftliche Gruppen in einen Prozess einzubeziehen und Entscheidungen durch Herbeiführung eines Konsenses zu treffen.
Diese Konkordanz wird bei der Zusammenstellung des Bundesrats vom Parlament berücksichtigt. Die Konkordanz in der Schweiz ist jedoch nicht, wie die Berücksichtigung der verschiedenen Landesteile, von der Verfassung aufgetragen, sondern wurde vielmehr während Jahrzehnten zu einer Tradition. Aus dieser Konkordanz hat sich auch eine sogenannte Zauberformel gebildet. Sie besagt, dass die drei während der Zeit zwischen 1959 und 1999 stärksten Parteien im Parlament, SP, FDP und CVP, je zwei Sitze im Bundesrat beanspruchen dürfen und die SVP als viertstärkste Partei einen Sitz. Dieses Verhältnis 2:2:2:1 blieb bis 2003 unverändert.[9]
Entschädigung
Ein Schweizer Bundesrat erhält einen jährlichen Lohn von 404'791 Schweizer Franken[10] sowie jährliche (nicht steuerpflichtige) Repräsentationszulagen von 30'000 Franken.
Überdies haben die Mitglieder der Landesregierung Anspruch auf zwei Dienstfahrzeuge sowie einen Chauffeur. Bei Zeitdruck kann für grössere oder kleinere Dienstreisen ein Hubschrauber oder Jet der Schweizer Luftwaffe beansprucht werden. Nach der Tätigkeit als Bundesrat erhält der ehemalige Magistrat eine jährliche Pension von 220'000 Franken, falls der Lohn aus einer allfälligen beruflichen Tätigkeit nicht mehr als 220'000 Franken beträgt.
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ Allgemeine Staatslehre, Thomas Fleiner-Gerster, Thomas Fleiner, Peter Hänni, Lidija R. Basta, Seite 469
- ↑ Swissinfo.ch
- ↑ Artikel 175 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
- ↑ Artikel 130 ff. Bundesgesetz über die Bundesversammlung vom 13. Dezember 2002
- ↑ Parlamentarische Initiative Hochreutener. Handlungsunfähige Bundesräte, 05.437
- ↑ Bundesgesetz vom 3. Oktober 2008, AS 2009 725; siehe auch den Bericht der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates vom 21. Februar 2008, BBl 2008 1869, und die Stellungnahme des Bundesrates vom 16. April 2008, BBl 2008 3177
- ↑ Art. 140 Bundesgesetz über die Bundesversammlung vom 13. Dezember 2002
- ↑ Art. 14, Bst. a Bundesgesetz über die Bundesversammlung vom 13. Dezember 2002
- ↑ Michael Hermann: Grund zur Abregung. Was bewegt sich in der Schweizer Politik wirklich? Eine Analyse jenseits von rechter Märchenstunde und linker Horrorshow. Das Magazin (Schweiz), 31. August 2007, abgerufen am 17. August 2010.
- ↑ SR 172.121.1 Art. 1 Bundesrat (Verordnung der Bundesversammlung über Besoldung und berufliche Vorsorge der Magistratspersonen), abgerufen am 2. August 2010
Weblinks
- {{{Autor}}}: Bundesrat. In: Historisches Lexikon der Schweiz.
- Website des Schweizerischen Bundesrats
- Departemente und Untereinheiten
- Chronologisches Verzeichnis der Mitglieder des Bundesrates seit 1848; PDF-Fotogalerie
- Graphische Darstellung der Zusammensetzung des Bundesrates seit 1848 (nach Parteien)







