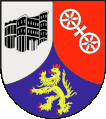Wehrbereichskommando
Ein Wehrbereichskommando (WBK) war die territoriale nationale Kommandobehörde der Bundeswehr in einem Wehrbereich und wurde von einem Befehlshaber geführt. Ein Wehrbereich umfasste ein oder mehrere Bundesländer. Die Wehrbereichskommandos gehörten in der letzten Struktur vor ihrer Auflösung zur Streitkräftebasis und unterstanden dem Streitkräfteunterstützungskommando.
Im Rahmen der Neuausrichtung der Bundeswehr wurden die Wehrbereichskommandos zum 1. Februar 2013 aufgelöst. Deren Aufgaben wurden im Wesentlichen vom Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr in Berlin sowie die ihm unterstellten Landeskommandos übernommen.[1]
Geschichte
Schon in der Weimarer Republik war das Staatsterritorium in Wehrkreise eingeteilt. Die Wehrkreiskommandos hatten jedoch andere Funktionen als die Wehrbereichskommandos.
Mit Aufstellung der Bundeswehr wurden die Wehrbereiche als Verwaltungsbezirke geschaffen. Je nach Größe umfassten sie ein oder mehrere Bundesländer (z. B. waren Bayern oder Baden-Württemberg je ein Wehrbereich, Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen zusammen war ein Wehrbereich). Innerhalb eines Wehrbereichs gibt es als mittlere Bundesbehörden des Bundesministeriums der Verteidigung die Wehrbereichsverwaltungen und als militärische Kommandobehörden die Wehrbereichskommandos, beide mit nachgeordneten Dienststellen bzw. Truppenteilen.
Die militärischen Dienststellen/Truppenteile waren
- „aktiv“, d. h. im Frieden bereits voll aufgestellt (Material vollständig vorhanden, Personal überwiegend vorhanden und im Spannungs- oder Verteidigungsfall noch mit einzelnen Reservisten zu ergänzen (personelle Mob-Ergänzung));
- „teilaktiv“, d. h. im Frieden waren einzelne Einheiten/Teileinheiten dieser Truppenteile voll aufgestellt, andere Einheiten/Teileinheiten waren gekadert;
- „nichtaktiv“ oder „gekadert“, d. h. die Einheiten bestanden im Frieden nur aus Kaderpersonal (ein Soldat und zwei bis drei zivile Mitarbeiter zur Verwaltung der Unterlagen und Pflege des vorhanden Materials), das eigentliche Personal bestand aus eingeplanten Reservisten, die erst im Spannungs- oder Verteidigungsfall einberufen worden wären. Das militärspezifische Material wie z. B. Waffen war eingelagert, anderes Material wie z. B. Kraftfahrzeuge war ebenfalls nur eingeplant und wäre ebenso einberufen worden (materielle Mob-Ergänzung).
In der DDR gab es zwei Militärbezirke, für den südlichen Teil der DDR den Militärbezirk III mit Sitz in Leipzig und für den nördlichen Teil den Militärbezirk V mit Sitz in Neubrandenburg. Die Wehrbezirke waren höhere Kommandobehörden der Landstreitkräfte der Nationalen Volksarmee. Ihnen unterstanden neben anderen Truppenteilen vor allem jeweils zwei Mot.-Schützen-Divisionen und eine Panzerdivision.
Anfangsjahre der Bundeswehr

1956 begann die Aufstellung „territorialer Kommandostäbe“ für jeweils einen Wehrbereich, die 1957 in Wehrbereichskommando umbenannt wurden. Ebenso wurde als deren oberste nationale Kommandobehörde 1957 das „Amt für territoriale Verteidigung“ – später in „Kommando Territoriale Verteidigung“ umbenannt – aufgestellt, das direkt dem Bundesministerium der Verteidigung unterstand.
Im gleichen Jahr wurde mit der Aufstellung von „VP-TV Stäben“ für jeden Regierungsbezirk (in kleinen Bundesländern ohne Regierungsbezirke nur ein Stab) begonnen, die 1963 in Verteidigungsbezirkskommandos (VBK) umbenannt wurden. Es gehörten zum
- WBK I in Kiel die VBKs 10 (Hamburg), 11 (Schleswig) und 12 (Eutin),
- WBK II in Hannover die VBKs 20 (Bremen), 21 (Osnabrück), 22 (Hannover), 23 (Braunschweig), 24 (Oldenburg) und 25 (Lüneburg),
- WBK III in Düsseldorf die VBKs 31 (Köln), 32 (Düsseldorf), 33 (Münster), 34 (Arnsberg), 35 (Detmold) und 36 (Aachen),
- WBK IV in Mainz die VBKs 41 (Koblenz), 42 (Trier), 43 (Darmstadt), 44 (Kassel), 45 (Neustadt), 46 (Saarbrücken) und 47 (Gießen),
- WBK V in Stuttgart die VBKs 51 (Stuttgart), 52 (Karlsruhe), 53 (Freiburg im Breisgau) und 54 (Tübingen),
- WBK VI in München die VBKs 61 (Augsburg), 62 (Regensburg), 63 (Ansbach), 64 (Würzburg), 65 (München), 66 (Landshut) und 67 (Bayreuth).
Den VBKs unterstanden Verteidigungskreiskommandos (VKK) auf der Ebene der Landkreise und eigene nichtaktive Truppenteile (Jägerregiment, Fernmeldekompanie, Nachschubkompanie, Transportkompanie, Wallmeistertrupps). Den VKKs unterstanden für Aufgaben der Objektsicherung nichtaktive Heimatschutzkompanien und Sicherungszüge. Ihre Zahl hing jeweils von der Anzahl und Größe der zu sichernden Objekte ab. Diese Dienststellen und Truppenteile wurden bis 1969 aufgestellt.

1969 wurde die bisherige „Territoriale Reserve“, die ursprünglich als eine eigene Teilstreitkraft geplant war, als „Territorialheer“ in das Heer integriert.
Bis 2002, dem Beginn der „Transformation der Bundeswehr“, war der Auftrag der WBKs
- die Aufrechterhaltung der Operationsfreiheit der NATO-Streitkräfte (einschließlich der deutschen),
- die Unterstützung der Zivilen Verteidigung,
und bestand neben der fachlichen und truppendienstlichen Führung der unterstellten Truppenteile vor allem in Planungsarbeiten auf der Grundlage einer sehr genauen Kenntnis von „Land und Leuten“. Bis dahin war auch im Verteidigungsfall die Zusammenarbeit mit den Korps der NATO vorgesehen.
Dieser Auftrag unterschied sich sehr von dem heutigen, oben bereits genannten Auftrag und beinhaltete im Einzelnen:[2]
- Das WBK hat im Frieden alle Maßnahmen vorzubereiten und im Spannungs- oder Verteidigungsfall zu ergreifen, die geeignet sind:
- sich selbst über die Lage der zivilen Verteidigung, die militärische Lage und die Infrastrukturlage zu unterrichten und Truppen, die sich im Wehrbereich aufhalten, zivile Behörden oder unmittelbar die Bevölkerung über die militärische Lage und die Maßnahmen und Absichten des Feindes zu unterrichten und vor den Auswirkungen von ABC-Kampfmitteln zu warnen;
- bestimmte Objekte, Verkehrswege und Räume
- gegen Beeinträchtigung ihrer Nutzung durch Feindeinwirkung zu Lande zu schützen, insbesondere „Empfindliche Punkte“ (EP);
- zur Nutzung bereitzustellen und bereitzuhalten, insbesondere militärische und zivile Infrastruktur von militärischem Interesse, oder freizuhalten durch Verkehrslenkung und Lenkung von Bevölkerungsbewegungen;
- für Unbefugte oder Feind zu sperren oder ihre Funktion zu lähmen;
- feste Fernmeldeeinrichtungen zu unterhalten und zu betreiben;
- Reservelazarette einzurichten und zu betreiben und Truppen vor Seuchen und Vergiftungen zu schützen;
- Personal der Bundeswehr zu ersetzen, um dadurch die Operationsfreiheit der Streitkräfte aufrechtzuerhalten.
- Das WBK hat ferner auf Anforderung
- die Streitkräfte durch Bereitstellen von militärischen Kräften oder von Hilfsmitteln aus dem zivilen Bereich, insbesondere von Dienstleistungen und Material zu unterstützen, um dadurch
- die Funktionsfähigkeit von Kampf-, Führungs- und Versorgungsanlagen und -einrichtungen wiederherzustellen, oder
- zur Versorgung der Truppe beizutragen;
- die zivilen Behörden bei ihren Maßnahmen zur Zivilverteidigung, insbesondere zur Wiederherstellung von Anlagen und Einrichtungen von militärischem Interesse zu unterstützen, um dadurch
- die Regierungsgewalt aufrechtzuerhalten,
- oder die Bevölkerung vor Feindeinwirkung zu schützen,
- oder die Versorgung der Bevölkerung oder der Truppe sicherzustellen.
Heeresstruktur 3 (1970 bis 1980)
Die Art und Stärke der den WBKs neben den VBKs direkt unterstellten Truppenteile war unterschiedlich und richtete sich teilweise nach geographischen Gegebenheiten (Küste, wichtige Flussübergänge für Nachschubstraßen (Main Supply Road, MSR) oder Eisenbahntransportlinien (ETL)), teilweise nach militärischen Notwendigkeiten (Anteil der Rückwärtigen Kampfzone („Rear Combat Zone“) im Raum des WBK / Entfernung zu den Grenzen zum Ostblock). Immer wurden ihnen im Laufe der weiteren Aufstellung der Bundeswehr die Truppenübungsplatzkommandanturen, Feldjägerkräfte, Transport- und Lazarettverbände unterstellt.
Ab 1972 wurden in den Wehrbereichskommandos zunächst je ein teilaktives Heimatschutzkommando (HschKdo) (Nummern 13–18) aufgestellt. Damit verfügte das Territorialheer erstmals über Verbände, die nicht rein infanteristisch gegliedert, sondern auch mit gepanzerten Gefechtsfahrzeugen ausgestattet waren. Sie wurden 1982 in Heimatschutzbrigaden (HschBrig) (Nummern 51–56) umbenannt. (siehe dazu auch Liste der Jägerverbände der Bundeswehr mit den dort aufgeführten Heimatschutzbrigaden)
Zum Stab eines WBKs gehörten die Stabsabteilungen der Führungsgrundgebiete G1 (Personal/Innere Führung), G 2 (militärisches Nachrichtenwesen), G 3 (Führung/Organisation/Ausbildung) und G 4 (Logistik) sowie die Abteilungen
- Infrastruktur/ Pionierwesen (militärischen Belange auf dem Gebiet der Infrastruktur mit unterstellten Wallmeistergruppen u. –trupps)
- Verkehrsführung (mit Verkehrskommandanturen in den Regierungsbezirken)
- Militärgeografischer Dienst (Erstellung des Kartenmaterials und die Versorgung aller Truppenteile der Bundeswehr innerhalb des Wehrbereiches mit Karten)
- Fernmeldewesen (Planung und Einrichtung der ortsfesten bundeswehreigenen Fernmeldeanlagen und -verbindungen. Dazu unterstanden ihr Fernmeldekommandanturen am Sitz der Oberpostdirektionen),
- Militärisches Kraftfahrwesen (Zulassung der Kraftfahrzeuge der Bundeswehr und Durchführung der Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO)
- Wehrbereichbibliothek.
Auf Grund der Mittlerfunktion zwischen Bundeswehr und ziviler Verwaltung einerseits und alliierten Truppen andererseits gehörten zur Abteilung G3 entsprechende große Verbindungskommandos.
Heeresstruktur 4 (1980 bis 1992)

Ab 1982 wurde bei jedem WBK eine weitere, nichtaktive Heimatschutzbrigade aufgestellt (Nummern 61–66).
Ab 1985 wurden im Rahmen des Wartime Host Nation Support – Abkommens mit den USA Unterstützungskommandos (Ukdo) aufgestellt, die teilweise den WBKs unterstellt waren.
Als Beispiel für die Vielzahl der Truppen eines WBKs kann die Gliederung des WBK V gelten:
Der Stab selbst war teilaktiv und sollte im Spannungsfall von rund 250 auf rund 800 Soldaten aufwachsen.
- 10 nichtaktive Verbindungskommandos (zur Landesregierung Baden-Württemberg, zu den NATO-Korps und -Divisionen sowie zu den Nachbar-WBKs)
- die teilaktive Stabskompanie (zusätzlich zum Stabspersonal drei Sicherungszüge zur Sicherung des Gefechtsstandes)
- die VBKs 51, 52, 53 und 54
- die teilaktive Heimatschutzbrigade 55
- die nichtaktive Heimatschutzbrigade 65
- das nichtaktive Unterstützungskommando 5 (nur der Stab war teilaktiv)
- der Bereichsfernmeldeführer 5
- die aktiven Truppenübungsplatzkommandanturen Münsingen und Heuberg
- das nichtaktive Lazarettregiment 75 (nur der Stab war teilaktiv)
- das nichtaktive Pionierregiment 75
- das aktive Feldjägerbataillon 750
- das nichtaktive Feldjägerbataillon 751
- das nichtaktive Transportbataillon 750
- das nichtaktive ABC-Abwehrbataillon 750 (direkt dem WBK unterstellter WHNS-Truppenteil)
- die nichtaktive Instandsetzungskompanie 750
- die nichtaktive Nachschubkompanie 750
- der nichtaktive Kampfmittelbeseitigungszug 7500
Dazu kamen noch die im Wehrbereich stationierten Truppenteile des Territorialkommandos Süd:
- der Stab des Territorialkommandos Süd (Mannheim),
- die Stäbe Fernmeldekommando 850 (Mannheim), Pionierkommando 850 (Mannheim) und Sanitätskommando 850 (Mannheim). Diesen Kommandos auf Brigadeebene unterstanden weitere nichtaktive Truppenteile.
- das selbständige gekaderte Feldersatzbataillon 852 (Kraichtal)
Im Frieden unterstanden die gekaderten Wehrleitersatzbataillone (WL/ErsBtl) des Territorialkommandos Süd einzelnen VKKs. In Baden-Württemberg waren dies u. a. die zum Feldausbildungsregiment 86 (München) gehörenden Wehrleitersatzbataillone 866 (Kirchzarten, bei VKK 533), 867 (Hechingen, bei VKK 541), 868 (Amstetten, bei VKK 542), 869 (Weingarten, bei VKK 543), 870 (Renningen, bei VKK 511), 871 (Schorndorf, bei VKK 512), 872 (Siegelsbach, bei VKK 513), 873 (Ludwigsburg, bei VKK 511), 874 (Oftersheim, bei VKK 522), 875 (Pforzheim, bei VKK 523) und 876 (Neuhausen ob Eck, bei VKK 532).
Nach der Wiedervereinigung wurde im Oktober 1990 in den neuen Bundesländern zunächst ein neuer Wehrbereich für Sachsen, Thüringen, Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt geschaffen. Die bei der Übernahme der Nationalen Volksarmee am 3. Oktober 1990 bestehenden Kommandos der Militärbezirke III in Leipzig und V in Neubrandenburg wurden am 1. Dezember 1990 in die Wehrbereichskommandos VII mit Sitz in Leipzig und VIII mit Sitz in Neubrandenburg umgegliedert und am 1. Juli 1991 in Division(Div)/WBK VII (Leipzig) und Division(Div)/WBK VIII (Neubrandenburg) umbenannt. Ihnen unterstanden die VBKs 71 (Erfurt), 72 (Suhl), 73 (Gera), 74 (Leipzig), 75 (Chemnitz), 76 (Dresden), 81 (Halle), 82 (Magdeburg), 83 (Cottbus), 84 (Potsdam), 85 (Frankfurt (Oder)), 86 (Schwerin), 87 (Neubrandenburg) und später das VBK 100/StOKdo Berlin.
Heeresstruktur 5 (ab 1992) und weitere Entwicklung

Im Rahmen der Heeresstruktur 5 (Nachsteuerung) (1993–1997) wurden die WBKs als eigenständige Kommandobehörden aufgelöst und mit bestehenden Divisionen fusioniert, die den entsprechenden neuen Namen erhielten:
| Bisheriges WBK | bisherige Division | neuer Name |
|---|---|---|
| WBK I | 6. Panzergrenadierdivision | WBK I / 6. PzGrenDiv |
| WBK II | 1. Panzerdivision | WBK II / 1. PzDiv |
| WBK III | 7. Panzerdivision | WBK III / 7. PzDiv |
| WBK IV | 5. Panzerdivision | WBK IV / 5. PzDiv |
| WBK V | 10. Panzerdivision | WBK V / 10. PzDiv |
| WBK VI | 1. Gebirgsdivision | WBK VI / 1. GebDiv |
| Div / WBK VII | WBK VII / 13. PzGrenDiv | |
| Div / WBK VIII | WBK VIII / 14. PzGrenDiv |
Die Wehrbereiche als Raum blieben unverändert bestehen. Als einziges befand sich der Sitz des WBK V / 10. PzDiv nicht in der Landeshauptstadt Stuttgart, sondern in Sigmaringen.
Der größte Teil der nichtaktiven Verbände und Einheiten der bisherigen WBKs wurde aufgelöst, einzelne als sogenannter „WBK-Anteil“ innerhalb der Division ausdrücklich gekennzeichnet. Die neuen Stäbe erhielten einen zusätzlichen „Stellvertretenden Divisionskommandeur und Kommandeur WBK-Truppen“ (ab 1996 umbenannt in „Stellvertretender Befehlshaber und General Nationale Territoriale Angelegenheiten“). Im Spannungsfall wären die Stäbe der WBKs in einen mobilen, der NATO unterstellten Divisionsstab und einen nationalen, am Standort verbleibenden Stab WBK geteilt worden. Die Truppenteile wären entsprechend unterstellt worden.

Veranschaulicht am Beispiel des Jägerregiment 10 „Linzgau“ des WBK V / 10. PzDiv:
Im Frieden unterstanden alle vier Bataillone dem Regiment. Das aktive Jägerbataillon 101, das teilaktive Jägerbataillon 102 und das nichtaktive Sicherungsbataillon 108 (vorgesehen zur Sicherung der Divisions-Gefechtsstände) wären bei der 10. PzDiv geblieben, das nichtaktive Jägerbataillon 852 wäre dem WBK unterstellt worden.
Situation 2001 bis 2006
Im Rahmen der Umgliederung zur „von Grund auf erneuerten Bundeswehr“ 2001 wurde das Territorialheer aufgelöst und verbliebene nationale Strukturen und Aufgaben in den neu geschaffenen Organisationsbereich Streitkräftebasis eingegliedert. Die Verantwortung für die „Nationalen Territorialen Aufgaben“ wechselte am 1. Oktober 2001 vom Heeresführungskommando zum neuen Streitkräfteunterstützungskommando, neuer „Nationaler Territorialer Befehlshaber“ wurde der Befehlshaber des Streitkräfteunterstützungskommandos. Gleichzeitig wurden die Divisionen / WBKs defusioniert und die Anzahl der Wehrbereiche/WBKs von sieben auf vier reduziert, die dem Streitkräfteunterstützungskommando unterstellt wurden. Außerdem wurden einzelne VBKs und die noch bestehenden nichtaktiven Truppenteile der WBKs aufgelöst.
Die vier neuen Wehrbereiche umfassen die Länder
- WB I mit WBK I „Küste“: Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein,
- WB II mit WBK II: Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland,
- WB III mit WBK III: Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen,
- WB IV mit WBK IV „Süddeutschland“: Bayern und Baden-Württemberg.
Da die verbliebenen VBKs ihre alte Nummer (die erste Ziffer zeigt die Zugehörigkeit zum früheren WBK) behielten, ist mit deren Zuordnung zu den neuen WBKs die neue Raumordnung deutlich sichtbar.
Wehrbereichskommando I – Küste
Sein Sitz war in Kiel. Dem WBK I waren die VBKs 10, 11, 20, 23, 24, 25, 86 und 87 unterstellt.
Wehrbereichskommando II
Mit Auflösungsappell am 5. Dezember 2012 aufgelöst.[3]
Der Sitz war in Mainz. Dem WBK II waren die VBKs 31, 34, 35, 42, 46 und 47 unterstellt.
Wehrbereichskommando III
Sein Sitz war in Erfurt. Dem WBK III waren das VBK 71, 75, 76, 81, 82, 84, 85 und das Standortkommando Berlin (StOKdo) unterstellt.
Wehrbereichskommando IV – Süddeutschland
Sein Sitz war in München. Dem WBK IV waren die VBKs 51, 52, 63, 65, 66 und 67 unterstellt.
2006 bis 2013
Auftrag
Ein Wehrbereichskommando war verantwortlich für die Wahrnehmung territorialer militärischer Aufgaben und arbeitete innerhalb des Wehrbereichs mit den dort stationierten Truppenteilen der Teilstreitkräfte (seit 2000 auch mit dem Zentralen Sanitätsdienst der Bundeswehr), den Dienststellen der Bundeswehrverwaltung, den mittleren Bundesbehörden und den jeweiligen Landesbehörden zusammen.
Der Auftrag im Einzelnen umfasste
- die Sicherstellung des streitkräftegemeinsamen Grundbetriebes,
- die Unterstützung der Teilstreitkräfte / Organisationsbeiche im Inland und bei Auslandseinsätzen,
- die fachliche und truppendienstliche Führung der unterstellten Truppenteile,
- die Organisation der Hilfseinsätze der Bundeswehr im Inneren nach Art. 35 des Grundgesetzes (ZMZ Inland).[4]
Organisation

Mit der Auflösung der Verteidigungsbezirkskommandos (VBK) und Aufstellung der Landeskommandos (LKdo) hatten die Wehrbereichskommandos im Wesentlichen ihre Zielstruktur 2010 im Rahmen der „Transformation der Bundeswehr“[5] eingenommen. Ihnen waren mit unterschiedlichem Schwerpunkt verschiedene Truppenteile und Dienststellen unterstellt.
In den Ländern, in denen die vier Wehrbereichskommandos stationiert waren, waren die Landeskommandos in das WBK integriert. Die LKdos führten entsprechend der politischen Strukturen der Bundesländer 34 Bezirksverbindungskommandos (BVK) als Verbindungskommando zu den Bezirksregierungen/Regierungspräsidien und 429 Kreisverbindungskommandos (KVK) als Verbindungskommando zu den Kreisen. Die BVKs und KVKs bestanden ausschließlich aus Reservisten.
Wehrbereichskommando I „Küste“
Das Wehrbereichskommando I war für die Bundesländer Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein zuständig. Sein Sitz war im Niemannsweg 220 in Kiel. Der Schwerpunkt des WBK I war die Logistik. Dem WBK I waren unterstellt
- die Landeskommandos Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern (Schwerin), Niedersachsen (Hannover) und Schleswig-Holstein (Kiel),
- Interne Verbandsabzeichen der Landeskommandos
-
LKdo Bremen
-
LKdo Hamburg
-
LKdo Niedersachsen
-
LKdo Mecklenburg-Vorpommern
-
LKdo Schleswig-Holstein
- die Logistikbrigade 1 (Delmenhorst) mit den Logistikbataillonen 161 (Delmenhorst), 162 (Boostedt), dem Instandsetzungsbataillon 163 (Boostedt), dem Spezialpionierbataillon 164 (Husum) und dem Transportbataillon 165 (Delmenhorst) sowie das Logistikregiment 17 (Burg) mit den Logistikbataillonen 171 „Sachsen-Anhalt“ (Burg) und 172 (Beelitz),
- die Feldjägerbataillone 151 (Neubrandenburg) und 152 (Hannover),
- das CIMIC-Zentrum in Nienburg,
- die Materialprüfgruppen 11 (Kiel) und 12 (Hannover),
- die Truppenübungsplatzkommandanturen Jägerbrück, Bergen und Putlos sowie das Schießplatzkommando Nordhorn.
- das Wehrbereichsmusikkorps I (Neubrandenburg)
| Nr. | Dienstgrad | Name | Beginn der Berufung |
|---|---|---|---|
| 1. | Konteradmiral | Uwe Kahre | 28. März 2003 |
| 2. | Generalmajor | Heinz-Georg Keerl | Januar 2005 |
| 3. | Konteradmiral | Jens-Volker Kronisch | 18. Januar 2008 |
| 4. | Brigadegeneral | Wolfgang Brüschke | 27. Juni 2011 |
Wehrbereichskommando II
Das Wehrbereichskommando II war für die Bundesländer Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland zuständig. Sein Sitz war in Mainz. Der Schwerpunkt des WBK II war die Führungsunterstützung.
Dem WBK II waren unterstellt
- die Landeskommandos Hessen (Wiesbaden), Nordrhein-Westfalen (Düsseldorf), Rheinland-Pfalz (Mainz) und Saarland (Saarlouis),
- Interne Verbandsabzeichen der Landeskommandos
-
LKdo Hessen
-
LKdo Nordrhein-Westfalen
-
LKdo Rheinland-Pfalz
-
LKdo Saarland
- das Führungsunterstützungsregiment 28 (Mechernich),
- das Führungsunterstützungsregiment 29 (Dillingen),
- die Feldjägerbataillone 251 (Mainz) und 252 (Hilden),
- die Truppenübungsplatzkommandanturen Daaden und Baumholder,
| Nr. | Dienstgrad | Name | Beginn der Berufung |
|---|---|---|---|
| 1. | Generalmajor | Christian Otto Eduard Millotat | 2002 |
| 2. | Generalmajor | Bernd Diepenhorst | 1. März 2004 |
| 3. | Generalmajor | Gerhard Stelz | 12. Dezember 2008 |
Wehrbereichskommando III
Das Wehrbereichskommando III war für die Bundesländer Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zuständig. Sein Sitz ist in Erfurt. Der Schwerpunkt des WBK III war die Führungsunterstützung.
Dem WBK III waren unterstellt
- die Landeskommandos Brandenburg (Potsdam), Sachsen (Dresden), Sachsen-Anhalt (Magdeburg) und Thüringen (Erfurt),
- Interne Verbandsabzeichen der Landeskommandos
-
StOKdo Berlin
-
LKdo Brandenburg
-
LKdo Sachsen
-
LKdo Sachsen-Anhalt
-
LKdo Thüringen
- das Standortkommando Berlin
- das Feldjägerbataillon 350 (Berlin)
- das Stabsmusikkorps der Bundeswehr (Berlin)
- das Wachbataillon beim Bundesministerium für Verteidigung (Berlin)
- das Feldjägerbataillon 351 (Leipzig)
- das Führungsunterstützungsregiment 38 (Storkow),
- das Wehrbereichsmusikkorps III (Erfurt),
- die Sportfördergruppen Berlin, Frankenberg/Sachsen, Frankfurt (Oder) und Oberhof
- die Truppenübungsplatzkommandanturen Oberlausitz (Weißkeisel), Wittstock und Klietz.
Ehemalige unterstellte Dienststellen:
- die Prüfgruppe § 78 BHO 32 (Erfurt), sowie
- das Materialprüfkommando III (Erfurt), wurde zum 1. Juli 2012 dem Logistikzentrum der Bundeswehr (LogZBw) (Wilhelmshaven) – Logistische Steuerstelle 4 (LogStSt 4) Sondershausen unterstellt.
| Nr. | Dienstgrad | Name | Beginn der Berufung |
|---|---|---|---|
| 1. | Generalmajor | Josef Priller | 1. Oktober 2001 |
| 2. | Generalmajor | Johann G. Oppitz | 14. September 2005 |
| 3. | Generalmajor | Heinrich Geppert | 27. März 2009 |
Wehrbereichskommando IV – Süddeutschland
Das Wehrbereichskommando IV – Süddeutschland – (WBK IV) war für die Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg zuständig. Sein Sitz war zunächst in der Bayernkaserne, später in der Fürst-Wrede-Kaserne in München. Der Schwerpunkt des WBK IV war die Logistik.
Dem WBK IV waren unterstellt
- die Landeskommandos Bayern (München) und Baden-Württemberg (Stuttgart),
- Interne Verbandsabzeichen der Landeskommandos
-
LKdo Bayern
-
LKdo Baden-Württemberg
- die Feldjägerbataillone 451 (München) und 452 (Stetten am kalten Markt)
- das Logistikregiment 46 (Diez) mit je einem Nachschub-, Transport-, Instandsetzungs- und Logistikbataillon,
- das Logistikregiment 47 (Dornstadt) mit drei Logistikbataillonen und dem Spezialpionierbataillon 464 sowie ortsfesten logistischen Einrichtungen,
- die Truppenübungsplatzkommandanturen Wildflecken mit den Truppenübungsplätzen Wildflecken, Hammelburg, Ohrdruf und Schwarzenborn sowie Heuberg,
- der deutsche militärische Vertreter Truppenübungsplatz Grafenwöhr,
- das Zentrum für Kampfmittelbeseitigung der Bundeswehr (Stetten am kalten Markt),
- das Gebirgsmusikkorps, Garmisch-Partenkirchen,
- diverse Kleindienststellen, z. B. den Sportfördergruppen der Bundeswehr Bischofswiesen, Bruchsal und Todtnau.
| Nr. | Dienstgrad | Name | Beginn der Berufung |
|---|---|---|---|
| 1. | Generalmajor | Kersten Lahl | 1. Juli 2001 |
| 2. | Generalmajor | Justus Gräbner | 29. September 2003 |
| 3. | Generalmajor | Gert Wessels | 27. September 2007 |
Siehe auch
- Territorialheer
- Kommandobehörde
- Streitkräfteunterstützungskommando
- Nationale Volksarmee
- Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr
Literatur
- Rolf Clement, Paul Elmar Jöris: 50 Jahre Bundeswehr. 1955–2005. Mittler & Sohn, Hamburg u. a. 2005, ISBN 3-8132-0839-7.
- Wehrbereichskommando V (Hrsg.): Wehrbereichskommando V, Jahre 1956–1966. ohne Jahr.
- Ferdinand von Senger und Etterlin: Das Wehrbereichskommando. In: Jahrbuch des Heeres. Nr. 4, 1973, ISSN 0075-2282, S. 109–115.
Weblinks
- WBK I Küste
- WBK II
- WBK III
- WBK IV Süddeutschland
- Geschichte einzelner Verbände/Dienststellen
- Bundesarchiv – Militärarchiv BH 26
- Bundesarchiv – Militärarchiv BH 33 – Heimatschutzkommandos und Heimatschutzbrigaden
Einzelnachweise
- ↑ Sebastian Wanninger, Sina Pawlowski: Zweite Ebene erreicht. streitkraeftebasis.de, 4. Februar 2013, archiviert vom am 4. März 2016; abgerufen am 10. Juni 2016.
- ↑ nach von Senger und Etterlin
- ↑ Bericht in den Landesnachrichten auf SWR 3
- ↑ Beispiel: Vereinbarung über die Zivil-Militärische Zusammenarbeit im Land Brandenburg
- ↑ Regierungserklärung des Verteidigungsministers, 97. Sitzung des Bundestags 15. Periode, TOP 3, am 11. März 2004