„Wikipedia Diskussion:Kurier“ – Versionsunterschied
Neuer Abschnitt →Wikipedia-Gläubig |
|||
| Zeile 619: | Zeile 619: | ||
<small>Als Seitenbemerkung: [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Benutzerin_Diskussion:Lydia_Pintscher_%28WMDE%29&diff=prev&oldid=148891865].--[[Benutzer:Mautpreller|Mautpreller]] ([[Benutzer Diskussion:Mautpreller|Diskussion]]) 12:52, 10. Dez. 2015 (CET)</small> |
<small>Als Seitenbemerkung: [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Benutzerin_Diskussion:Lydia_Pintscher_%28WMDE%29&diff=prev&oldid=148891865].--[[Benutzer:Mautpreller|Mautpreller]] ([[Benutzer Diskussion:Mautpreller|Diskussion]]) 12:52, 10. Dez. 2015 (CET)</small> |
||
: Da mich {{antwort|Jayen466}} gebeten hat, als damaliger Disk-Teilnehmer nochmal was zu sagen.. ich habe jetzt nicht alles genau verfolgt, aber ich versuch nochmal meine Punkte anzumerken: |
|||
:* Was Denny [https://lists.wikimedia.org/pipermail/wikimedia-l/2015-December/080290.html hier sagt], passt mE. nicht zu der Auffassung der europäischen Datenbankrechte. Dort ist es nämlich tatsächlich so, dass es nicht auf die Form der Datenbank ankommt, sondern lediglich, ob es eine strukturierte Anordnung von Datenelementen gibt - in dem Sinne wäre die Summe unserer Infoboxen durchaus bereits als Datenbank zu verstehen. Denny hätte Recht, wenn wir aus den '''Fließtexten''' händisch die Daten erst einzeln und mühsam raussuchen würden. Aber darum geht es ja mW. nicht, sondern darum, dass wir massiv die bereits aufbereiteten Daten aus den Infoboxen (und ggf. auch Listen-Artikeln) abgreifen. '''Meine grobe Idee an der Stelle wäre''' (aber das müsste man sicher mit einem Rechtsexperten noch erörtern), dass die Wikipedia-Projekte, die als Quelle für solche Übernahmen herhalten sollen, ein Meinungsbild veranstalten, wo die User einmal einem Prozedere oder Lizenzanpassung zustimmen, nach dem die Datenentahme unter einer ODbL-ähnlichen Lizenz gestattet wird und man dann als Attribution ähnlich wie bei OpenStreetMap "Wikipedia und Mitwirkende" angibt. Denn die Datenbankrechte sind ohnehin nicht an einzelne User, sondern an eine Gemeinschaft/Firma geknüpft. |
|||
:* Wenn ich Dennys Standpunkt recht verstehe sagt er: WikiData ist ein US-Projekt und europäisches Recht interessiert daher für WikiData ohnehin nicht. Wenn das aber die Art und Weise ist, wie man innerhalb der Wikipedia mit der Arbeit anderer User umgeht, fänd ich das ziemlich beschämend. Und wenn ich jetzt noch lese, dass es da anscheinend von Anfang an eine Interessen-Überschneidung mit Google gab, dann scheint mir das jetzt irgendwie, als ginge es nur darum, die gesammelten Wikipedia-Daten möglichst schnell und einfach an Google zu verfüttern. Vielleicht ist das auch der Punkt wo sich WikiData und OpenStreetMap unterscheiden. OSM war strategisch in einer Situation, in der man dringend mehr Mitwirkende brauchte (entspr. Publicity über die ODbL-Lizenz und Festlegung, dass die ganze Arbeit nicht eines Tages unter einer geschlossenen Lizenz kommerzialisiert werden kann). Bei WikiData hingegen geht es ja mehr darum, die bereits vorhandenen Daten aus Wikipedia einfach zu verwerten, egal ob man damit jetzt die Wiki-Mitwirkenden motiviert. |
|||
:* Ein weiteres wesentliches Problem ist mE. der Import von Fremddaten, die unter einer Share-Alike-Lizenz veröffentlicht werden. Zum Beispiel gibt es momentan in diversen Bundesländern OpenData-Portale, die aber fast alle eine ODbL oder CC-ähnliche Lizenz verwenden. Bei OpenStreetMap hat man mit diesen Dingen einige Erfahrung. Da hätte ich mir gewünscht, dass man von deren KnowHow hätte ein wenig mitnehmen können |
|||
: Das waren glaub ich so meine Punkte. --[[Benutzer:Alexrk2|alexrk]] ([[Benutzer Diskussion:Alexrk2|Diskussion]]) 15:43, 12. Dez. 2015 (CET) |
|||
== Deutschland ist Weltmeister == |
== Deutschland ist Weltmeister == |
||
Version vom 12. Dezember 2015, 16:43 Uhr
| Bitte achtet auf einen zivilisierten Umgangston!
Auch Diskussionsseiten sind nicht der Ort für öffentliche Beleidigungen – egal ob gegenüber Wikipedianern oder anderen Personen. Beiträge einzelner Diskussionsteilnehmer spiegeln grundsätzlich nur deren Meinung wider – unsachgemäße Äußerungen schaden jedoch auch dem Ruf der Wikipedia. Siehe dazu auch: Wikiquette, Wikiliebe, Keine persönlichen Angriffe |
| Archiv |
| Archivübersicht (Präfixindex) |
| Wie wird ein Archiv angelegt? |
Telefonfundraising im Auftrag von Wikimedia Deutschland
Kann es denn wirklich sein, dass nicht nur die Mailinglisten sondern auch die Mitgliederlisten in falsche Hände geraten sind?
Ich frage mich dies, weil mich eben ein junger Mann (aktiv mit weiteren 20 Kollegen) aus einem Callcenter anruft, sich zunächst als Mitarbeiter von Wikipedia vorstellt und sich für meine Unterstützung der Wikipedia bedankt. Sehr schnell wurde jedoch klar, das er - wie er sagte - im Auftrag der Wikimedia Mitglieder abtelefoniert, um zusätzlich zum Beitrag Spenden akquirieren will. Ist das wirklich eine authentische Aktion der deutschen Wikimedia? -- MaxxL - Disk 15:54, 20. Nov. 2015 (CET)
- Hi MaxxL, ja, das ist eine authentische Aktion. Wir haben eine Agentur beauftragt, eine kleine Anzahl an Fördermitglieder nach einer Beitragserhöhung zu fragen. Da sehr viele gemeinnützige Organisatonen erfolgreich Telefonfundraising machen, wollen wir dieses Jahr herausfinden, inwiefern telefonische Kontaktaufnahmen für einen derartigen Zweck funktionieren. Nebenbei fragen wir auch nach Beitragserhöhungen im Rahmen von postalischen Mailings. Gruß, Till Mletzko (WMDE) (Diskussion) 16:15, 20. Nov. 2015 (CET)
- Nachtrag: MaxxL, kannst du bitte bestätigen, dass er sich "Mitarbeiter von Wikipedia" vorgestellt hat? Danke, Till Mletzko (WMDE) (Diskussion) 16:22, 20. Nov. 2015 (CET)
- (quetsch) @Till Mletzko (WMDE): Ich musste mehrfach nachfragen: "Sind Sie ein Mitarbeiter von Wikimedia" - "Ja" - "Sind Sie da sicher?" - "Ja" - "Rufen Sie denn im Auftrag der Wikimedia an? - "Ja" - "Dann sind Sie also kein Mitarbeiter von Wikimedia?" - "Ich rufe Sie im Auftrag ...." - "Dann sind Sie Mitarbeiter eines Callcenters?" - Ernst dann kam das Eingeständnis, sich nicht richtig vorgestellt zu haben. -- MaxxL - Disk 16:46, 20. Nov. 2015 (CET)
- danke MaxxL für den Hinweis. Ich werde die Agentur darauf aufmerksam machen, dass Sie wie vereinbart klar mitteilt, dass sie in unserem Auftrag anruft. Till Mletzko (WMDE) (Diskussion) 16:59, 20. Nov. 2015 (CET)
- (quetsch) @Till Mletzko (WMDE), wie hoch ist "eine kleine Anzahl an Fördermitglieder", die ihr habt anrufen lassen? --Alraunenstern۞ 09:40, 21. Nov. 2015 (CET)
- danke MaxxL für den Hinweis. Ich werde die Agentur darauf aufmerksam machen, dass Sie wie vereinbart klar mitteilt, dass sie in unserem Auftrag anruft. Till Mletzko (WMDE) (Diskussion) 16:59, 20. Nov. 2015 (CET)
- Unabhängig von den zusätzlichen Aktionen, um Fundraising zu betreiben (was ich grundsätzlich begrüsse), sehe ich aber weiterhin ein Missverhältnis zwischen den Aktivitäten gegenüber den (stillen) Vereinsmitgliedern, wenn's um Spenden/Fundraising geht gegenüber dann, wenn es um die inhaltliche Ansprache dieser mittlerweile ja klar fünfstelligen Zahl von Personen geht. Polemisch formuliert: Wenn's um das Melken der Karteileichen geht, wird viel probiert und gemacht, wenn's darum geht dieses ungenutzte Reservoir an Ideen, Teilhabe und non-monetärer Unterstützung zu aktivieren, läuft vieles auf Sparflamme. Woran liegst's? --Jens Best (Diskussion) 16:27, 20. Nov. 2015 (CET)
- Ich halte das anrufen um Geld zu bekommen für eine mißbräuchliche Verwendung der euch zu Verfügung gestellten Daten. Wäre ich noch Vereinsmitglied und würde ich dann einen solchen Anruf bekommen, würde ich dann austreten. Den Leuten auf diese Weise hinterher zu steigen ist eine beschämende Aktion. Ich schäme mich mittlerweile fast von Tag zu Tag mehr für meinen ehemaligen Verein und finde meinen Austritt immer richtiger. Marcus Cyron Reden 21:08, 20. Nov. 2015 (CET)
- Ich gehe nicht ganz so weit und unterschreibe eine „mißbräuchliche Verwendung" von Daten; ich teile aber Marcus' Empörung: Ich halte es für wenig verwunderlich, daß jetzt auch WMDE – wie jeder, der irgendeine valide Adresse (sei es E-, sei es Snail-Mail) von einem Kunden hat – den Kunden oder das Mitglied mit tollen Angeboten oder halbseidenen Fragen belästigt. Derlei Gespamme nervt total. Dreist finde ich, daß die Mitgliederdaten (muß ja wenigstens voller Name, Telefonnummer und Details zur Mitgliedschaft sein) einfach an ein Callcenter weitergegeben werden. Gibts da irgendeine entsprechende Klausel im Mitgliedschaftsformular a la „[ ] Ich bin einverstanden, daß meine Daten an Dritte weitergegeben werden, damit man mir tolle Angebote macht"? Nein, oder? Ist zudem wieder die typische Unsensibilität von WMDE was spezielle Befindlichkeiten der WP-Klientel angeht: In WP ist Anonymität ein hohes Gut (das weiß man bei WMDE schon allein deshalb, weil es immer wieder Knatsch wg. Klarnamenspflicht oder -fragen bei Veranstaltungen oder Projektanträgen gibt), aber man hats nicht auf dem Zettel oder ignoriert es. @Till Mletzko (WMDE): An sich schätze ich die Arbeit des Fundraising-Teams, weil ihr euch in den letzten Jahren sehr viel Mühe gegeben habt transparent zu arbeiten und die Community einzubeziehen. Aber diese Callcenter-Nummer ist ein – Pardon! – Griff ins Klo. Sowas geht nicht! --Henriette (Diskussion) 00:19, 21. Nov. 2015 (CET)
- Ich spezifiziere: nicht rechtlich (das weiß ich nicht wirklich, aber möglicherweise sogar hier, wenn da nicht eine Klausel unterschrieben wurde, die das anrufen zu derartigen Werbezwecken gestattet) sondern moralisch halte ich das für fragwürdig. Marcus Cyron Reden 03:49, 21. Nov. 2015 (CET)
- Moralisch finde ich das auch hoch fragwürdig: Wer es jemals mit einem wirklich guten Telefon-Marketing-Menschen zu tun hatte, der weiß das die einen in einem Gespräch sehr charmant und extrem elegant in die beabsichtigte Richtung schieben. Und in einem netten Gespräch mit einem netten Menschen am Ende sagen, daß man dem tollen Verein der soooo viel Gutes tut keine lumpigen 5 oder 10 Euro im Jahr zusätzlich gönnt … das geht natürlich; aber wenn der Marketing-Mensch richtig gut ist, dann hat man hinterher noch stundenlang ein schlechtes Gewissen. Was MaxxL da oben schildert, klingt aber nach 08/15-Callcenter mit schlecht ausgebildeten Leuten. Wenn ich so einen dranhabe, dann mach' ich mir immer den Spaß die ein bisschen zu verwirren :) Was danach bei mir als Kunde hängenbleibt, ist: Die setzen irgendwelche schlecht bezahlten und schlecht ausgebildeten Leute auf mich an, verplempern meine Zeit, bieten mir Dinge an die ich nicht brauche und zwingen mir Gespräche mit Leuten auf mit denen ich nicht reden will. Geht also voll nach hinten los und hinterläßt lediglich einen schlechten Eindruck. --Henriette (Diskussion) 10:39, 21. Nov. 2015 (CET)
- Ich habe gerade Zweifel, daß das bei "lediglich" bleibt. Marcus Cyron Reden 14:44, 21. Nov. 2015 (CET)
- Moralisch finde ich das auch hoch fragwürdig: Wer es jemals mit einem wirklich guten Telefon-Marketing-Menschen zu tun hatte, der weiß das die einen in einem Gespräch sehr charmant und extrem elegant in die beabsichtigte Richtung schieben. Und in einem netten Gespräch mit einem netten Menschen am Ende sagen, daß man dem tollen Verein der soooo viel Gutes tut keine lumpigen 5 oder 10 Euro im Jahr zusätzlich gönnt … das geht natürlich; aber wenn der Marketing-Mensch richtig gut ist, dann hat man hinterher noch stundenlang ein schlechtes Gewissen. Was MaxxL da oben schildert, klingt aber nach 08/15-Callcenter mit schlecht ausgebildeten Leuten. Wenn ich so einen dranhabe, dann mach' ich mir immer den Spaß die ein bisschen zu verwirren :) Was danach bei mir als Kunde hängenbleibt, ist: Die setzen irgendwelche schlecht bezahlten und schlecht ausgebildeten Leute auf mich an, verplempern meine Zeit, bieten mir Dinge an die ich nicht brauche und zwingen mir Gespräche mit Leuten auf mit denen ich nicht reden will. Geht also voll nach hinten los und hinterläßt lediglich einen schlechten Eindruck. --Henriette (Diskussion) 10:39, 21. Nov. 2015 (CET)
- Ich spezifiziere: nicht rechtlich (das weiß ich nicht wirklich, aber möglicherweise sogar hier, wenn da nicht eine Klausel unterschrieben wurde, die das anrufen zu derartigen Werbezwecken gestattet) sondern moralisch halte ich das für fragwürdig. Marcus Cyron Reden 03:49, 21. Nov. 2015 (CET)
- Ich gehe nicht ganz so weit und unterschreibe eine „mißbräuchliche Verwendung" von Daten; ich teile aber Marcus' Empörung: Ich halte es für wenig verwunderlich, daß jetzt auch WMDE – wie jeder, der irgendeine valide Adresse (sei es E-, sei es Snail-Mail) von einem Kunden hat – den Kunden oder das Mitglied mit tollen Angeboten oder halbseidenen Fragen belästigt. Derlei Gespamme nervt total. Dreist finde ich, daß die Mitgliederdaten (muß ja wenigstens voller Name, Telefonnummer und Details zur Mitgliedschaft sein) einfach an ein Callcenter weitergegeben werden. Gibts da irgendeine entsprechende Klausel im Mitgliedschaftsformular a la „[ ] Ich bin einverstanden, daß meine Daten an Dritte weitergegeben werden, damit man mir tolle Angebote macht"? Nein, oder? Ist zudem wieder die typische Unsensibilität von WMDE was spezielle Befindlichkeiten der WP-Klientel angeht: In WP ist Anonymität ein hohes Gut (das weiß man bei WMDE schon allein deshalb, weil es immer wieder Knatsch wg. Klarnamenspflicht oder -fragen bei Veranstaltungen oder Projektanträgen gibt), aber man hats nicht auf dem Zettel oder ignoriert es. @Till Mletzko (WMDE): An sich schätze ich die Arbeit des Fundraising-Teams, weil ihr euch in den letzten Jahren sehr viel Mühe gegeben habt transparent zu arbeiten und die Community einzubeziehen. Aber diese Callcenter-Nummer ist ein – Pardon! – Griff ins Klo. Sowas geht nicht! --Henriette (Diskussion) 00:19, 21. Nov. 2015 (CET)
- Das mit der Community einbeziehen kann ich so nicht bestätigen. Ich habe eher den Eindruck, es geht damals wie heute darum, um jeden Preis die Kohle zu maximieren. – Giftpflanze 00:52, 21. Nov. 2015 (CET)
Ich bin ja "nur" Mitglied bei Wikimedia CH und hoffe, dass man sich dort nie eine derart fragwürdige Aktion einfallen lässt. Insbesondere, da es bei Wikimedia doch gegenwärtig keinerlei Geldprobleme gibt, Spenden gehen seit Jahren mehr als genug ein, d.h. die bestehenden Spendenaufrufe funktionieren gut genug und sollten ausreichen. Gestumblindi 22:32, 20. Nov. 2015 (CET)
Oha, das nenne ich mal tief gesunken. Getreu dem Motto: „schlimmer geht immer“, bin ich gespannt, was demnächst kommt. Türwerbung á la Rotes Kreuz, Vorwerk und Pallhuber & Söhne? „Unterschreiben Sie hier und Sie bekommen Wikipedia im Abo.“ Da muss ich an Loriot denken, Frisch entkorkt... es grüßt mit ungläubigem Augenaufschlag bzgl. der leichtfertigen und anscheinend nicht mal Datenschutzrechtlich einwandfreien Datenweitergabe --Itti 00:29, 21. Nov. 2015 (CET)
@Till Mletzko (WMDE): Das ist bitte nicht euer Ernst? Reicht es nicht mehr, allen Online-Nutzern in unserem Namen auf den Zeiger zu gehen und ihnen immer mehr Kohle aus der Tasche zu ziehen, die schon lange jegliche vernünftige Bedarfsgrenze überschritten hat; jetzt wird auch noch unter dem Deckmantel unserer Arbeit in der Wikipedia Telefonabzockerei betrieben und wir dürfen uns hinterher anhören, was da für ein Mist läuft? Ich glaube, es wird Zeit für eine deutliche Erklärung an die Presse im Namen der Autoren der Wikipedia und einem Aufruf, den WMDE/WMF-Spendenaufrufen NICHT zu folgen! -- Achim Raschka (Diskussion) 00:40, 21. Nov. 2015 (CET)
- @Achim und jeden, der glaubwürdig versichert eine solche Anzeige zu organisieren: bitte auf meiner Disk melden - ich spende 100€ (für die Anzeige)-- Summer • Streicheln •
Note00:46, 22. Nov. 2015 (CET) - Volle Zustimmung.--Cirdan ± 00:47, 21. Nov. 2015 (CET)
- In der Tat. Trifft man einen Spender kann man ihm kaum noch in die Augen schauen ... Julius1990 Disk. Werbung 00:55, 21. Nov. 2015 (CET)
- Kann mal jemand die Nummer des Callcenters veröffentlichen? Ich möchte die auf meine Rufnummernsperren-Liste nehmen, um möglichem Telefonspam vorzubeugen. *kopfschüttelnd* --Alnilam (Diskussion) Heute schon gelobt? 01:02, 21. Nov. 2015 (CET)
- (quetsch)@Alnilam: Die Rufnummerkann ich Dir gerne geben: 0404665517170. -- MaxxL - Disk 11:39, 21. Nov. 2015 (CET)
- Kann mal jemand die Nummer des Callcenters veröffentlichen? Ich möchte die auf meine Rufnummernsperren-Liste nehmen, um möglichem Telefonspam vorzubeugen. *kopfschüttelnd* --Alnilam (Diskussion) Heute schon gelobt? 01:02, 21. Nov. 2015 (CET)
- In der Tat. Trifft man einen Spender kann man ihm kaum noch in die Augen schauen ... Julius1990 Disk. Werbung 00:55, 21. Nov. 2015 (CET)
- Jetzt abgesehen von anderen Aspekten: gibt es für telephonisches Herantzreten (Werbung) nicht seit einigen Jahren sehr strenge Eingrenzungen? Werden diese möglicherweise verletzt? So etwas hat ja früher jede Versicherung gemacht, irgendwann gab es da eine richterliche Entscheidung, soweit ich weiß. -jkb- 01:10, 21. Nov. 2015 (CET)
- <quetsch> Ich hatte auf den Seiten der Bundesnetzagentur nachgeschaut; das fällt wohl gerade noch nicht in deren Zuständigkeitsbereich, wenn nicht gleich telefonisch Geld abgebucht wird. --Alnilam (Diskussion) Heute schon gelobt? 01:46, 21. Nov. 2015 (CET)
- Ja, da war was: § 7 UWG. Kostet nach § 20 UWG bis zu 300.000 Euro, eine schöne Stange Geld. -- Liliana • 01:48, 21. Nov. 2015 (CET)
- Mir gings um Akquise#Kaltakquise und Warmakquise und Unerwünschte telefonische Werbung; inwieweit dies aber hier zutrifft will ich nicht beurteilen. -jkb- 01:52, 21. Nov. 2015 (CET)
- So ein Aufruf wäre in der Tat interessant dafür könnte ich mich auch erwärmen.--Kmhkmh (Diskussion) 01:36, 21. Nov. 2015 (CET)
- So kann man sich auch ins Abseits schießen ... Eine ziemlich idiotische Idee von WMDE und angesichts des Spendenaufkommens der letzten Jahre überflüssig wie ein Kropf die Fördermitglieder noch einmal an zubetteln. Zeigt aber recht gut den Trend bei der Foundation den Laden hier als Marke/Produkt vermarkten zu wollen. Wir, die hier Inhalte schaffen und den Laden am Laufen halten, sind nur noch Mittel zum Zweck .... --codc Disk 01:58, 21. Nov. 2015 (CET)
- Frage: WMDE hat ja auch Daten von Benutzern, die gar nicht im Verein Mitglieder sind (z. B. durch Rückerstattung von Reisekosten u.ä.). Werden die auch angerufen? --Felistoria (Diskussion) 02:01, 21. Nov. 2015 (CET)
- Ähm Felistoria, steht doch da oben klar und deutlich! Zitat Till: „Wir haben eine Agentur beauftragt, eine kleine Anzahl an Fördermitglieder nach einer Beitragserhöhung zu fragen.” Fördermitglieder sind Mitglieder des Vereins. Nicht-Mitglieder des Vereins sind keine Mitglieder des Vereins und auch keine Fördermitglieder. Noch Fragen? --Henriette (Diskussion) 02:23, 21. Nov. 2015 (CET)
- Nö. --Felistoria (Diskussion) 02:32, 21. Nov. 2015 (CET)
- Klar und deutlich steht da in meinen Augen nichts. Was ist denn bitte in Euren Augen eine kleine Anzahl von Fördermitgliedern? Der Typ am Telefon sagte doch, dass er und 20 weitere Kollegen Födermitgleider anrufen. Glaubt ihr im Ernst, ein Callcenter brieft 21 Kollegen, um dann eine kleine Anzahl von Anrufen durchzuführen. Wieviele Anrufe soll den jeder dieser Mitarbeiter nach der Schulung tätigen, damit eine kleine Anzahl von Anrufen zusammenkommt? Und welchen Betrag soll so ein Callcenter pro Anruf der Wikimedia in Rechnung stellen, damit es die Zeit für die Erarbeitung der Kampagne, das Briefing von 21 Leuten und die Anrufe einigermaßen angemessen bezahlt bekommt? Sorry, nie im Leben ist der Auftrag der WMDE 'eine kleine Anzahl an Fördermitgliedern' zu kontaktieren. Das ist bestimmt kein kleiner Versuchsballon, um sowas mal mit einer kleinen Anzahl an Fördermitgliedern ausprobieren, hätte man ja einen Mitarbeiter von WMDE für einen Tag dransetzen können, dann hätte man gewußt, ob es klapp oder nicht.
- Der Beitrag von Till Mletzko ist ein ziemlich ungeschickter Versuch, die Aktion zu verniedlichen: eine kleine Anzahl an Födermitgliedern wird nicht um Geld angebettelt, sondern nach einer Beitragserhöhung gefragt, das ganze ist nur ein Versuch für dieses Jahr und andere gemeinnützige Organisatonen machen das ja auch erfolgreich. Und: Gut, dass ich erfahre, dass sich die Callcenter-Mitarbeiter als Wikipedia-Mitarbeoter ausgeben, da hake ich mal nach gehört in die gleiche Schublade. Wenn so ein Callcenter-Anrufer erst nach mehrmaligen Nachfragen zugibt, dass er nicht für Wikimedia oder Wikipedia arbeitet, dann steht das klipp und klar so im Briefing, das er bekommen hat. Und das Briefing in der Regel sehr ausführlich und eindeutig mit dem Auftraggeber abgestimmt.
- Sorry, aber nach dem platten und dreisten Beschwichtigungsversuch von Till Mletzko bleiben bei mir noch viele Fragen offen!--
 09:53, 21. Nov. 2015 (CET)
09:53, 21. Nov. 2015 (CET)
- Nö. --Felistoria (Diskussion) 02:32, 21. Nov. 2015 (CET)
- Ähm Felistoria, steht doch da oben klar und deutlich! Zitat Till: „Wir haben eine Agentur beauftragt, eine kleine Anzahl an Fördermitglieder nach einer Beitragserhöhung zu fragen.” Fördermitglieder sind Mitglieder des Vereins. Nicht-Mitglieder des Vereins sind keine Mitglieder des Vereins und auch keine Fördermitglieder. Noch Fragen? --Henriette (Diskussion) 02:23, 21. Nov. 2015 (CET)
- Zum Aspekt Marke möchte ich noch anmerken, dass ich die große Gefahr sehe, dass durch solche Aktionen die Glaubwürdigkeit einer der zurzeit beliebtesten Marken Deutschlands(!) schwer in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Man erinnere sich zum Beispiel an die Unicef-Geschichte um Heide Simonis. Da fällt dann eine unüberlegte Aktion von ein paar Mitarbeitern auf unser ganzes Projekt zurück, dessen Beliebtheit und Glaubwürdigkeit einem Marktwert im Millionenbereich entspricht. (Nicht, dass Geld jetzt das wichtigste wäre, aber es verdeutlicht die Dimensionen, auch wenn man hier auf der Kurier-Diskussionsseite manchmal einen anderen Eindruck hat.)--Cirdan ± 09:25, 21. Nov. 2015 (CET)
- Wie bitte? Es werden vertrauliche Daten von Vereinsmitgliedern/Fördermitgliedern an Dritte weitergegeben? Häh? --1971markus ⇒ Laberkasten ... 02:27, 21. Nov. 2015 (CET)
- Frage: WMDE hat ja auch Daten von Benutzern, die gar nicht im Verein Mitglieder sind (z. B. durch Rückerstattung von Reisekosten u.ä.). Werden die auch angerufen? --Felistoria (Diskussion) 02:01, 21. Nov. 2015 (CET)
- So kann man sich auch ins Abseits schießen ... Eine ziemlich idiotische Idee von WMDE und angesichts des Spendenaufkommens der letzten Jahre überflüssig wie ein Kropf die Fördermitglieder noch einmal an zubetteln. Zeigt aber recht gut den Trend bei der Foundation den Laden hier als Marke/Produkt vermarkten zu wollen. Wir, die hier Inhalte schaffen und den Laden am Laufen halten, sind nur noch Mittel zum Zweck .... --codc Disk 01:58, 21. Nov. 2015 (CET)
- Ich bin ehrlich gesagt entsetzt, wie man mit den persönlichen Daten der Mitglieder umgeht, zumal beim Antrag auf Mitgliedschaft für Fördermitglieder an keiner Stelle gefragt wird, ob man mit Kontaktaufnahme jeglicher Art einverstanden ist. Eine Kalt-Aquise per Telefon durch eine ist ein absolutes (!) no-go und die Weitergabe von Daten an eine Agentur macht mich einigermaßen fassungslos. Ich erwarte, dass man dazu auf der MV nächste Woche eine entsprechende Erklärung bekommt. Geolina mente et malleo ✎ 02:56, 21. Nov. 2015 (CET)
- Noch ein anderer Aspekt neben den Datenschutzbestimmungen:
- Was sind das eigentlich für mittlerweile 20.000+ Vereinsmitglieder, über deren jährliches rapides Wachstum ehemalige Vereinsvorstände immer so stolz waren? Es sind zu einem sehr großen Teil — polemisch gesprochen — in die Fördermitgliedschaft gelockte Karteileichen, die beim Spendenaufruf angekreuzt haben, dass sie regelmässig geben wollen. Ein Fördermitglied, das sich bewusst für WMDE entschieden hat, weil es wusste, was da alles möglich ist, sind diese Personen in den seltensten Fällen.
- Als ich mal ein Amt hatte im Verein, habe ich mal diese „Karteileichen“ in fünf verschiedenen Städten eingeladen zu einem „Begegnungsabend“. Eingeladen wurden per Mail diejenigen, die in machbarer Nähe der fünf Städte lebten (nach Postleitzahl). Es antworteten 3-4%, die Interesse, aber keine Zeit hatten und eine kleine Anzahl von rund um die zehn Leute pro Stadt kamen tatsächlich. Mal mehr, mal weniger.
- Viele hatten keine Ahnung, wie die Wikipedia funktioniert und was eigentlich WMDE macht. Nach einiger Aufklärung gab es bei vielen Lust und Ideen mitzumachen.
- Aber aus meiner ehrenamtlichen Position heraus konnte ich nach diesen Treffen nur stetig dafür werben, diese „Karteileichen“ als Potential zu sehen. Aktuell sind sie eine reine Geldmaschine, es war sogar zeitweise üblich ein in der Geschäftsstelle anrufendes Vereinsmitglied (nicht die üblichen Verdächtigen, aber alle anderen) gleich ins Fundraising durchzustellen, was implizit ausdrückte, unter welcher Kategorie man diese Personen einordnete.
- Das Fundraising-Team selbst ist sicherlich nicht zu kritisieren, denn die machten und machen einen guten Job. Die Tatsache, dass trotz leicht gesteigerter Mailwurfversendungen von allgemein informativer Natur immer noch keine nachhaltige und ernstgemeinte Einbindung dieser „Vereinsmitglieder“ erfolgt, zeigt, dass man immer noch Angst davor hat, 90% der Leute könnte plötzlich klarwerden, das sie gar keine Ahnung haben von dem Verein, bei dem sie Fördermitglied sind.
- Ich hielt das und halte das aus zweierlei Gründen für falsch: Erstens werden diese Menschen als rein monetäre Ressource gesehen und das geht mir gegen den Strich, weil das ein merkwürdiges Selbstverständnis als Verein offenbart. Und zweitens fuchst es mich, dass man nicht den Mut hat herauszufinden, wie viel mögliches Potential (oder eben nicht) in vielen dieser Karteikarten-Mitglieder steckt. Mir ist auch bekannt, dass eine Beteiligungsquote von 15-20% der Mitglieder in deutschen Vereinen bereits bedeutet, dass man einen aktiven Verein hat, aber selbst von dieser Prozentzahl ist WMDE weit entfernt.
- Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich weiss, dass bei etlichen Mitarbeitern von WMDE der Wille da ist - jetzt stellt sich nur die Frage, warum nicht mal ein anderer Weg als der der reinen Geldakkumulation (ohne vergleichbar großen Impact) gegangen wird. --Jens Best (Diskussion) 03:21, 21. Nov. 2015 (CET)
Achims Vorschlag ist für mich gerade sehr verlockend, weil bei aller Etatvergrößerung beim eigentlichen Vereinszweck, der Unterstützung der Wikimedianer kaum noch etwas ankommt. Ich plane einen größeren Beitrag dazu für den Kurier oder anderswo in Bälde. Und erstmals, ja, heute erstmals, erscheint mir eine Verkleinerung der Geschäftsstelle sehr verlockend. Ich habe das Gefühl, es muß wieder Realität in den Laden. Wer arbeitet für wen und was sind die obersten Aufgaben und Ziele. Das scheint vergessen. Im Zentrum stehen heute Geld machen und Berichte schreiben - oder vulgo: Selbsterhalt der Geschäftsstelle. Ausgerechnet die Comunityförderung ist seit Monaten chronisch unterbesetzt. Es liegt nur am unfassbar grandiosen Engagement der dortigen Mitarbeiter, daß es hier noch nicht zu wirklich merklichen Engpässen gekommen ist. Für nächstes Jahr spätestens sehe ich das auf uns zukommen. Oder schauen wir in den Bereich "Politik und Gesellschaft". Das waren mal 5 Leute. Die beiden "Politiker" sind mittlerweile weg, eine GLAMerin ist zu OER versetzt. Die beiden letzten GLAM-Frauen des völlig unterfinanzierten Bereiches schaffen es gerade noch so Coding da Vinci (tolles Projekt, zweifelsohne - aber das kann doch nicht die GLAM-Arbeit eines derartigen Vereins sein) und eine Vortragsreihe zu machen. Aber Hauptsache an der Community kann man sich vorbei im Glanze von OER-Kram sonnen und so tun, als würde man mit Ministerien etc. auf Augenhöhe zusammen arbeiten. Schlimmer noch - wie man zwischen den Zeilen heraus hören kann, steht noch nicht einmal fest, daß es nächstes Jahr noch GLAM-Arbeit von WMDE geben wird. Ausgerechnet ein Bereich, den die Community nicht nur angenommen, sondern getragen hat. Nochmal: die Zusammenarbeit mit den letzten Resten Derer in der Geschäftsstelle, die noch Communityarbeit machen ist wunderbar. Aber das kann nicht darüber hinweg täuschen, daß die Geschäftsstelle als Ganzes schon lange nicht mehr das tut, was sie tun soll. Ich erinnere an dieser Stelle auch noch einmal an das stehlen des sakrosanten Community-Raumes, in dem jetzt völlig überfüllt das Team Community sitzt, die ihrerseits ihre vormals zwei Zimmer verloren haben. Und wenn Jemand aus der Community vorbei kommt, darf der sich entweder auf den Flur setzen, oder ins "Alphabet", einen Raum, in dem man sich verliert, weil er eigentlich zu groß ist. Man kann sich fragen, warum man uns nicht gleich in den ganz großen Saal abgeschoben hat. War die große GS nicht mal als Anlaufpunkt für die Berliner Wikimedianer, ja für die ganzen deutschen Wikimedianer gedacht? Woher kommt der Eindruck, die GS war in der Eisenacher Straße noch so viel produktiver, als sie es heute ist? Öffentlichkeitsarbeit hat WMDE leider komplett eingestellt, der Bereich Kommunikation ist leider mit internem Berichteschreiben ausgelastet. Schade. Denn ich glaube, das Team könnte wirklich ganz anders. Aber wo war der Bericht im WMDE-Blog (oder noch besser die Pressemitteilung!) über den ersten Wikipedianer in der de:WP mit einer Million Edits? Warum muß das überlastete Team Community (oder wie sie gerade heissen) die Wikimedia-Woche betreuen? Das ist doch ureigenste Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit. Infomaterialien werden nicht erneuert, obwohl das schon Jahrelang geplant ist, immer wird aufgeschoben und vertröstet. Und ich höre immer öfter, daß Freiwillige nicht die Infomaterialien bekommen, die sie bei ihrer Arbeit brauchen (von Giveaways mal ganz zu schweigen, dabei sind gerade derartige Kleinigkeiten wichtige Dinge um im Gedächtnis zu bleiben). Dafür nimmt man Freiwilligen Mailadressen weg, weil man dem Wahn verfallen ist, nicht die seien Wikimedia, sondern die bezahlten Mitarbeiter. Aber ich wollte je jetzt noch gar nicht meinen ausführlichen Beitrag schreiben. Habe ich auch noch nicht. Marcus Cyron Reden 04:21, 21. Nov. 2015 (CET)
Solche Telefonate dauern bei mir regelmäßig keine 20 Sekunden. Ich übernehme sofort die Rede: „Hören Sie: Ich habe kein Interesse. Streichen Sie mich von Ihrer Liste. Rufen Sie mich nie wieder an. Das Gespräch ist beendet.“ Auflegen. Beim zweiten Anruf kommt die Nummer auf die Sperrliste der Telefonanlage. Ich finde diese Anrufe – genau wie die Spendensammler in den Fußgängerzonen – in höchstem Maße als ärgerlich. So eine Aktion rückt WMDE in das Feld der Unseriösität. --Drahreg01 (Diskussion) Hilf mit! 06:11, 21. Nov. 2015 (CET)
Sehr interessanter Sachverhalt. Einerseits deutet er auf eine sehr professionelle Herangehensweise der Kollegen des Fundraising an ihr Handwerk, das nun nach offline ausgreift. Andere NGOs erblassen manchmal vor Erstaunen. Andererseits gibt es offenbar einen ganz erheblichen Klärungsbedarf, ob das alles rechtlich zulässig ist (Datenschutz und unerbetene „Telefonwerbung“). Zu diesem „andererseits“ ist hier, lieber Till Mletzko, eine ganz präzise Auskunft sicher sehr hilfreich.
Etwas Drittes ist wichtig. Mir scheint das ein Beispiel zu sein für Verselbständigungstendenzen. Das Mittel (die Spende) hat sich vom Zweck (Enzyklopädieerstellung) abgelöst. Der Spende wird nachgestellt mit allen Mitteln der Kunst, und so erfolgreich, dass man kaum weiß wohin mit den Einnahmen. Am Gelde aber krankt unsere Wikipedia-Welt nun wirklich nicht. Wir haben zu wenige Autorinnen und Autoren. Wir haben ein schlechtes Klima. Um nur zwei Kernprobleme zu benennen. Das wird seit vielen Jahren bemängelt. Geändert hat sich daran sehr wenig, von Teilerfolgen abgesehen.
Es regiert die Quantität. Dem Imperativ des „mehr, Mehr, MEHR!“ wird bedingungslos gefolgt. An den Quantitäten wird die Güte des Handelns gemessen statt an Qualität. Foundation und Geschäftsstelle verhalten sich, als habe es nirgendwo in den letzten 50 Jahren Debatten über die Grenzen und Dysfunktionalitäten des Wachstums gegeben. Erstaunlich.
Mich würde es im Übrgen nicht wirklich wundern, wenn die Kritik an Telefonfundraising in den Wikimedia-Institutionen wirklungslos verklingt wie weißes Rauschen. Ich höre sie schon, die Sätze: "Das Telefonfundraising war super. Nur die paar Mimosen der Community haben sich ein wenig aufgeregt, kein Problem." Atomiccocktail (Diskussion) 08:12, 21. Nov. 2015 (CET)
- Schlimme Verirrung in das kommerzielle Belästigungsgewerbe: sofort abbrechen!
-- Barnos (Post) 08:17, 21. Nov. 2015 (CET)- Sehr ungeschickt, mehr sag ich dazu besser nicht. Für mich wäre so ein Anruf -rein zum Geldeintreiben- ein Grund die Mitgliedschaft aufzulössen (Bin aber nur WMCH). --Bobo11 (Diskussion) 08:32, 21. Nov. 2015 (CET)
Nehmen wir an, wir hätten den Job, möglichst viel Geld einzusammeln und sind nicht' Teil der WP:Autorenschaft, sondern junge Leute die aus völlig wikipediafernen Zusammenhängen, die bei WMDE angestellt wurden um einiges kreativ zu erproben. Diese Art von Telefon-Marketing ist seit langem modern und man kann sich gut vorstellen, dass es auch im Verein WMDE Stimmen gibt, die ein Ausprobieren durchaus befürworten. Abzuwägen ist das Nutzen-Ärger-Verhältnis. Also wie viel kommt rein, wie viele Leute verprelle ich damit? Diejenigen, die ich mit solchen Aktionen verprelle, sind als Kollateralschaden offenbar zu verkraften, denn das was ich an Zaster reinbekomme wiegt das dicke auf. Also wird das Callcenter-Unternehmen, das das für den Verein günstigste Angebot gemacht hat, mit der Sache betraut. Vereinsmitglieder, die ihre Telefonnummer angeben, wollen ja angerufen werden, sonst hätten sie ihre Nummer nicht angegeben. Unser Motzen hier auf der Kurierseite, wird in die Erwägungen natürlich auch mit einbezogen und ignoriert, das beruhigt sich ja sowieso irgendwann wieder, sind auch nie so viele, die hier meckern, dass man sich Gedanken machen muss. Was mich aber interessiert ist, ob das Kalkül aufgegangen ist. Was haben die Anrufe gebracht? Wie viele Vereinsmitglieder haben sich beschwert, und wie viele sind deswegen gar ausgetreten? Alles andere, wie unsere Befindlichkeiten hier, sind eher als die übliche Empörungsfolklore aufzufassen, und die kennen wir längst, nicht wahr? --Schlesinger schreib! 09:52, 21. Nov. 2015 (CET)
Ich schäme mich in Grund und Boden, diesem Verein (noch) anzugehören. Was mich interessieren würde: Kann der gute Till Mletzko solche Aktionen allein entscheiden? Inwieweit ist der geschäftsführende Vorstand @Christian Rickerts (WMDE): involviert? Gruß, Stefan64 (Diskussion) 09:59, 21. Nov. 2015 (CET)
Bei aller Freundschaft zum Verein: Telefonbettelei halte ich für ein NoGo! — Raymond Disk. 10:01, 21. Nov. 2015 (CET)
- Der Verein legt aus umwelt-ökologischen Gründen großen Wert darauf, dass der Wikipedianer zu Treffen mit der Bahn anreist. Solche Maßstäbe sollte der Verein auch an sein eigenes Verhalten legen, und deshalb halte ich diese Aktion aus moralisch-ökologischen Gründen für nicht vertretbar. --
 Nicola - Ming Klaaf 10:12, 21. Nov. 2015 (CET)
Nicola - Ming Klaaf 10:12, 21. Nov. 2015 (CET)
- Wenn man irgendwo Fördermitglied ist oder einmalig spendet, dann muss man damit rechnen, dass man ein Schreiben erhält mit der Bitte, nächstes Jahr wieder zu spenden. Dass man aber zum "Dank" mit Telefonwerbung belästigt wird... kein Verständnis. --Z. (Diskussion) 10:45, 21. Nov. 2015 (CET).
- Meine paar Kröten Mitgliedsbeitrag benötigt der Verein nicht mehr. -- Smial (Diskussion) 10:52, 21. Nov. 2015 (CET)
Service: Die Datenschutzrichtlinien von WMDE, das ist das einzige, worauf man außer der Satzung einen Hinweis erhält, wenn man online eine Mitgliedschaft abschliessen möchte (Fördermitglied ist – wen wundert’s – als Default eingestellt).
„Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte Zur Erfüllung unserer Aufgaben (Versand von Zuwendungsbestätigungen und Informationen) arbeiten wir mit externen Auftragnehmern zusammen, die in unserem Auftrag für diese Zwecke gegebenenfalls personenbezogene Daten verarbeiten. Diese Dienstleister sind vertraglich durch die Wikimedia Fördergesellschaft gebunden und dürfen personenbezogene Daten, die sie in diesem Zusammenhang erhalten, nur für die jeweils vereinbarten Zwecke verwenden.
Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Besucherdaten Personenbezogene Daten werden auf dieser Webseite im technisch notwendigem und zweckmäßigem Umfang erhoben. In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft. Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die von uns im Rahmen dieser Website erhobenen Nutzungsdaten.
Log-Files: Bei der Nutzung dieses Angebots werden die von Ihrem Browser an den Server übermittelten Daten erfasst und gespeichert. Dies umfasst üblicherweise Informationen über den Typ und die Version des von Ihnen verwendeten Browsers, das verwendete Betriebssystem, die Referrer URL (die Webseite, von der aus Sie zu dieser Website gelangt sind), den Hostnamen des zugreifenden Rechners (die IP-Adresse) sowie die Uhrzeit der Serveranfrage. Als Daten werden diese Informationen ausschließlich für statistische Zwecke und zur Optimierung unseres Internet-Angebots verwendet. Sie können der Nutzung dieser Daten per Email, Fax, Brief oder Telefon widersprechen.
Cookies: Diese Website verwendet an mehreren Stellen Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Browser speichert und die dazu dienen, die Benutzung einer Website einfacher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an, nehmen minimalen Speicherplatz in Anspruch und enthalten keine Viren.
Wikimedia Donor Privacy Policy Als Wikimedia-Länderverein unterstützen und befolgen wir die Wikimedia Donor Privacy Policy. Hier können Sie sich die Datenschutzerklärung der Wikimedia Stiftung ansehen.“
Als Datenschutz-Verantwortlicher wir Till Mlezko aufgeführt. --Varina (Diskussion) 11:02, 21. Nov. 2015 (CET)
Hmmm... Vielleicht sollten wir an dieser Stelle mal daran denken, dass wir, die WP-Community, lange Zeit darauf gedrängt haben, dass der Verein nur unterstützend in der WP tätig wird, nicht aktiv die Themen zu steuern versucht. In diesem Punkt hat sich in den letzten Jahren, aus meiner Sicht zumindest, sehr viel verbessert. Es gibt eine Reihe von Unterstützungsangeboten und von abrufbaren Hilfen, die der Verein auf Anfrage an aktive Editoren der Projekte vermittelt. Ich nenne an dieser Stelle zum Beispiel die lokalen Büros in einigen Städten, für die der Verein die Betreiberkosten übernommen hat und die von Aktiven, die nicht zwingend Verensmitglieder sein müssen, betrieben werden. Oder als Beispiel für die Übernahme von Organisation die Bücherstipendien inzwischen mehrerer Verlage, die den Editoren angeboten werden und sie auf Anfrage unterstützen. Also: In Bezug auf die Förderung der Editoren hat sich m.E. einiges Positive getan. Bleibt zu überlegen, was der Verein mit der restlichen Zeit und Energie anfängt. Dass Fundraising für derartige Projekte betrieben wird gehört inzwischen nicht mehr ein auf die USA beschränktes Verhalten; ich werde täglich in der Fußgängerzone meines Wohnortes von Fundraisern der WWF, des ASB, Kinderschutzorganisatonen etc. belästigt. Dass der Verein auf diesen Zug ebenfalls aufspringt ist zumindest nachvollziehbar. Dies gilt um so mehr, als die Wikimedia eben nicht nur die Wikipedia unterstützt, sondern einerseits auch die anderen Projekte, die nicht so sehr im Rampenlicht stehen, und auch Netzpolitik betrieben wird. All das ist auch Vereinsziel; wer's näher wissen möchte sollte sich bitte auf der Seite des Vereins ein wenig informieren. Da die Wikipedia das mit Abstand bekannteste Projekt ist, das der Verein betreibt, wird natürlich auch von dem Geld, das hier eingetrieben wird, an weniger "lukrative" Projekte "abgegeben". In Kurzform: Das Geld wird benötigt, das Geld wird den Vereinszielen entsprechend genutzt. Und wer seine Telefonnummer nicht angegeben hat bekommt eben auch keinen Anruf.
Allerdings muss ich zugeben, dass gerade die Telefonaquise ziemlich unschön ist. Ich halte schon die Fundraiser auf der Straße für nervig, aber telefonisch hat sich noch niemand bei mir einen einzigen Cent verdient (im Gegenteil: ich kenne die Adresse der Bundesnetzagentur und habe in einem Fall auch schon ein fünfstelliges Strafgeld mitbewirkt). Das wird auch so bleiben. Ob der Verein den mit dieser Form des Fundraising verbundenen Imageverlust in Kauf nehmen mag ist seiner eigenen Beurteilung zu überlassen. Das ist eigentlich aber eine Frage der Mitgliederversammlung etc., nicht der Kurierleser. Korrekt?
Fazit: Kopfschütteln mögen die Mitglieder des Vereins an geeigneter, vereinsinterner Stelle. Hier an dieser Stelle ist dagegen ein deutliches Abkühlen der erhitzten Gemüter sinnvoll. Freundlicher Gruß, --Unscheinbar (Diskussion) 11:31, 21. Nov. 2015 (CET)
- @Unscheinbar: Wenn ich mit der Wahl dieses Forums daneben gegriffen habe, tut es mir Leid. Da der Anrufer sich als "Wikipedia-MA" vorstellte, habe ich hier nach einer Stelle gesucht, die mir Aufschluss geben könnte. Wo soll's denn bitte das nächste Mal sein?
- Eigentlich bin ich mit Telefonaquise vertraut und selbst Kaltanrufe sind mir nicht neu sondern nur ärgerlich. Als direkt Betroffener bin ich jedoch im höchsten Maße darüber enttäuscht, dass gerade die Organisation, der ich als letzte eine solche Aktion zugetraut hätte, mich damit belästigt. Dass dann auch noch unter der "Tarnung" Wikipedia statt offen Wikimedia agiert hat mich besonders getroffen. Dieses zweifach unseriöse Vorgehen - Kaltanruf und Tarnung - kann durch keine noch so gut gemeinte Zielsetzung gerechtfertigt werden. Es sollte bessere Möglichkeiten geben, als einen auf Provisionsbasis agierenden Dienstleister mit der Ansprache von Mitgliedern zu beauftragen. Ich bin tief enttäuscht von meinem eigenen Verein. - MaxxL - Disk 11:53, 21. Nov. 2015 (CET)
- Das ist Bürokraten-Strategie: "Wir sind nicht zuständig." --
 Nicola - Ming Klaaf 12:07, 21. Nov. 2015 (CET)
Nicola - Ming Klaaf 12:07, 21. Nov. 2015 (CET)
- @MaxxL:, Du hast natürlich nicht danebengegriffen, an dieser Stelle zu informieren. Ganz im Gegenteil möchte ich Dir danken, einen Blick hinter die Kulissen dessen, was der Verein im Namen dieses Projektes treibt, zu erhalten. Gerade, dass sich ein angeheuerter Callcenter-Telefonist, der vermutlich nie im Leben auch nur einen Edit beigetragen hat, als "Wikipedia-MA" (nicht wenigstens "Wikimedia-MA") vorstellt, ist eine Frechheit, und der potentielle Image-Verlust ist keine vereinsinterne Sache, sondern er betrifft die Wikipedia und alle, die hier ohne kommerzielle Motive mitarbeiten. --Magiers (Diskussion) 12:10, 21. Nov. 2015 (CET)
- Das ist Bürokraten-Strategie: "Wir sind nicht zuständig." --
- (Nach BK) Na ja, "daneben gegriffen" würde ich nun auch nicht unbedingt sagen, insbesondere wegen des Mitarbeiters des Callcenters, der sich falsch meldete. Aber hier, auf der Disku des Kuriers, gleiten derartige Hinweise sehr oft ein wenig ab. In meinen Augen ist das unbedingt ein Thema für den Verein, für die Wikipedia eher eine randständige Anmerkung. Dementsprechend halte ich eine Thematisierung innerhalb des Vereins und seiner Organe durchaus für sinnvoll, aber in der Wikipedia ist das eigentlich nicht so sinnvoll. Hier sollten wir die Zuständigkeiten etwas mehr trennen und nicht ständig alles nur auf die WP-Community beziehen, wo es größere Zusammenhänge gibt, die die WP nur einbeziehen, aber nicht ausschließlich betreffen. Freundlicher Gruß, --Unscheinbar (Diskussion) 12:12, 21. Nov. 2015 (CET)
- Ich würde liebend gerne zwischen Verein und Projekt trennen. Nur es ist genau der Verein, der diese Trennung regelmäßig verwischt, und zwar vorzugsweise dann, wenn's ums Geld geht. Wenn sich der Callcenter-Anrufer als "Wikimedia-MA" vorgestellt hätte, wäre das eine Sache des Vereins, wenn er sich als "Wikipedia-MA" vorstellt nicht. Warum macht er das? Entweder ist er schlecht informiert (dann wäre es traurig, wenn der Verein nicht mal externe Firmen über diese Trennung aufklären könnte) oder er realisiert sehr schnell, dass mit dem Hinweis auf die Unterschiede zwischen Projekt und Verein klein Blumentopf zu gewinnen ist. Genau deswegen werden diese Unterschiede in den Spendenkampagnen regelmäßig verwischt und das Thema ist ein dauerndes Ärgernis, und zwar für die unentgeltlichen Mitarbeiter hier, in deren Namen Geld eingetrieben wird. --Magiers (Diskussion) 12:26, 21. Nov. 2015 (CET)
- Ich stimme Dir zu, dass die Trennung zwischen Verein und WP verbesserungsfähig ist. Allerdings bewegt sich da, zumindest nach meiner Einschätzung, die Tendenz in die richtige Richtung - von Seiten des Vereins. Innerhalb der WP wird der Verein dagegen meist noch immer als "Zuarbeiter der WP" verstanden, und genau das ist er eben nicht. Daher mein Trennungs-Hinweis oben. Dass der Callcenter-Mitarbeiter Mist gebaut hat, als er sich als "Wikipedia-Mitarbeiter" ausgegab, ist unstrittig. Die Frage ist allerdings, wie weit dies dem Verein anzulasten ist. Ich persönlich vermute einen ungeschickten Anrufer, kein unzureichendes Briefing des Vereins. Das entnehme ich der Nachfrage Tills am Beginn dieses Threads, zusammen mit seiner Aussage, dass es hier eine klare, anderslautende Vereinbarung mit dem Callcenter gäbe. Wie gesagt, die eigentliche Frage ist m.E., ob eine derartige Form der Aquise sinnvoll, notwendig oder vertretbar ist. Aber da dies der Verein initiierte ist dies auch eine Frage, die der Verein besprechen muss. Freundliche Grüße, --Unscheinbar (Diskussion) 12:35, 21. Nov. 2015 (CET)
- Das assoziiert man doch extern immer miteinander. Extern ist WMDE Wikipedia. Also fällt alles was dort passiert auf Wikipedia und Schwesterprojekte zurück - wie auch anders herum. Marcus Cyron Reden 12:41, 21. Nov. 2015 (CET)
- Das Telefongespräch begann mit folgendem Satz: "Guten Tag Herr ..., die Wikipedia möchte sich heute bei Ihnen bedanken." Da solche Texte wortwörtlich mit dem Auftraggeber abgestimmt werden, kann ich hier absichtliche Verschleierung des wahren Auftraggebers unterstellen. -- MaxxL - Disk 12:45, 21. Nov. 2015 (CET)
- Na ja, das mag man so annehmen oder eben auch nicht. Da wir Beide den Wortlaut dieser Vereinbarung nicht kennen ist es uns nur möglich, darüber zu spekulieren. Ich für meinen Teil halte diese Formulierung eben nicht für eine solche, dann tatsächlich hochproblematische, Vorgabe. Hier stimmen meine Erfahrungen mit derartigen Organisationen im Allgemeinen und der WMF im Besonderen mit meinem AGF überein. Was aber, zugegeben, wiederum eine Form von Spekulation ist. Gruß, --Unscheinbar (Diskussion) 12:53, 21. Nov. 2015 (CET)
- Man muss schon sehr naiv sein, um soviel AGF in die Runde zu werfen und davon auszugehen, dass ausgerechnet MaxxL das Pech hatte, an einen Volltrottel von Callcenter-Mitarbeiter zu geraten, der besonders schlau sein wollte und sich entgegen des Briefings und auch auf mehrfaches Nachfragen hin als Mitarbeiter der WP ausgegeben hat. Der Anrufer hatte wahrscheinlich seinen ersten Callcenter-Arbeitstag und hat sich skrupellos und vermessen bessere Chancen ausgerechnet, beim Angerufenen seriöser zu erscheinen und ihm dadurch ein paar mehr Euros aus den Rippen schneiden zu können. Als dieser regelwidrige Alleingang des neuen Mitarbeiters bekannt wurde, ist er bestimmt gleich entlassen worden, der Callcenter wurde mit sehr ernster Ansprache von WMDE abgemahnt und es wurde mit Entzug des Auftrags gedroht. Das war aber alles nicht so schlimm, denn die 21 auf WMDE-Mitgieder angesetzten Callcenter-Agenten sollten ja eh nur eine kleine Anzahl Anrufe durchführen und hatten sie mit 21 Kollegen bestimmt eh innnerhalb eines Tages erledigt.
- Als jemand, der selbst schon Aufträge an Callcenter vergeben und mit diesen Projekte durchgeführt hat, weiß ich, wie genau der Wortlaut solcher Anrufe vorab mit dem Auftraggeber und dann auch im Briefing der Anrufer besprochen wird. Das die überwiegende Anzahl der angerufen denkt, da meldet sich jemand von WP (und nicht von WMDE (denn die kennt der Großteil der Spender wahrscheinlich gar nihct, die meisten denken meiner Meinung nach, sie spende für die Wikipedia) oder gar jemand aus einem Callcenter ist meiner Meinung und Erfahrung nach so zu 100% beabsichtigt!--
 13:44, 21. Nov. 2015 (CET)
13:44, 21. Nov. 2015 (CET)
- Vielleicht sollte man nicht Naivität voraussetzen, wenn jemand wie ich eine die Aussage tätigt, dass ein Mitarbeiter gegen die Vorgaben seiner Auftraggeber und/oder Vorgesetzten handelt, sondern eher Erfahrung? Ich denke nämlich, die habe ich. Ich bin seit einigen Jahren in der konzerninternen Fachausbildung von Mitarbeitern tätig und habe einen netten Erfahrungsschatz gesammelt, welche Unterschiede zwischen (vorzugsweise intensiv) vermittelten Vorgaben und den tatsächlichen Handlungsweisen der Mitarbeiter bestehen. Nein, ich halte diese Vorstellung nicht für naiv, sondern für realistisch. Und da ich zudem dem Verein durchaus nicht unkritisch gegenüber stehe sehe ich auch in diesem Punkt keine Voreingenommenheit 'für das Verhalten des Callcenter-Mitarbeiters für gegeben an. Allerdings halte ich es für sinnvoll, die Kirche im Dorf zu lassen und statt dessen die Fehlentwicklungen zu identifizieren und zu thematisieren. Und zwar dort, wo sie zu Änderungen bei den Verantwortlichen führen. Also nicht hier. Sondern in den Vereinsorganen. Dass Telefonaquisen von mir abgelehnt werden - unabhängig von der Organisation, die dahinter steht - habe ich weiter oben bereits deutlich gemacht. Aber das war eben eine Aktion der WMDE, nicht der WP. Also muss man das bei den Organisatoren hinterlegen. Und dafür plädiere ich weiterhin. Gerade solcher Beiträge wie Deines wegen. Emotionen sind m.E. eine schlechte Grundlage für Richtungsentscheidungen. Freundlicher Gruß, --Unscheinbar (Diskussion) 14:03, 21. Nov. 2015 (CET)
- Das mit der Diskrepanz zwischen Vorschrift oder Schulung und dem, was der Mitarbeiter dann tatsächlich tut, ist wohl korrekt. Ich kann mir zudem X Gründe vorstellen, warum der Callcenter-Mensch von „Wikipedia" gesprochen hat. Von schlichter Inkompetenz (sowas solls ja auch hin und wieder geben), über Nervosität, Konfusion (ich hatte neulich einen Marketing-Anruf bei dem der Typ auf der anderen Seite Null Durchblick hatte und komplett wirres Zeug erzählt hat) oder schlicht der Erfahrung, daß ihn 42 Leute gefragt haben was denn dieses Wikimedia sei und bei denen erst beim Wort Wikipedia der Groschen gefallen ist – dann nimmt mal als Mitarbeiter (der u. U. pro geführtem Telefonat bezahlt wird!) halt den direkten Weg, redet gleich von Wikipedia und spart sich 2 Minuten Aufklärungsgefasel über Wikimedia und -pedia. --Henriette (Diskussion) 14:28, 21. Nov. 2015 (CET)
- Vielleicht sollte man nicht Naivität voraussetzen, wenn jemand wie ich eine die Aussage tätigt, dass ein Mitarbeiter gegen die Vorgaben seiner Auftraggeber und/oder Vorgesetzten handelt, sondern eher Erfahrung? Ich denke nämlich, die habe ich. Ich bin seit einigen Jahren in der konzerninternen Fachausbildung von Mitarbeitern tätig und habe einen netten Erfahrungsschatz gesammelt, welche Unterschiede zwischen (vorzugsweise intensiv) vermittelten Vorgaben und den tatsächlichen Handlungsweisen der Mitarbeiter bestehen. Nein, ich halte diese Vorstellung nicht für naiv, sondern für realistisch. Und da ich zudem dem Verein durchaus nicht unkritisch gegenüber stehe sehe ich auch in diesem Punkt keine Voreingenommenheit 'für das Verhalten des Callcenter-Mitarbeiters für gegeben an. Allerdings halte ich es für sinnvoll, die Kirche im Dorf zu lassen und statt dessen die Fehlentwicklungen zu identifizieren und zu thematisieren. Und zwar dort, wo sie zu Änderungen bei den Verantwortlichen führen. Also nicht hier. Sondern in den Vereinsorganen. Dass Telefonaquisen von mir abgelehnt werden - unabhängig von der Organisation, die dahinter steht - habe ich weiter oben bereits deutlich gemacht. Aber das war eben eine Aktion der WMDE, nicht der WP. Also muss man das bei den Organisatoren hinterlegen. Und dafür plädiere ich weiterhin. Gerade solcher Beiträge wie Deines wegen. Emotionen sind m.E. eine schlechte Grundlage für Richtungsentscheidungen. Freundlicher Gruß, --Unscheinbar (Diskussion) 14:03, 21. Nov. 2015 (CET)
- Na ja, das mag man so annehmen oder eben auch nicht. Da wir Beide den Wortlaut dieser Vereinbarung nicht kennen ist es uns nur möglich, darüber zu spekulieren. Ich für meinen Teil halte diese Formulierung eben nicht für eine solche, dann tatsächlich hochproblematische, Vorgabe. Hier stimmen meine Erfahrungen mit derartigen Organisationen im Allgemeinen und der WMF im Besonderen mit meinem AGF überein. Was aber, zugegeben, wiederum eine Form von Spekulation ist. Gruß, --Unscheinbar (Diskussion) 12:53, 21. Nov. 2015 (CET)
- Das Telefongespräch begann mit folgendem Satz: "Guten Tag Herr ..., die Wikipedia möchte sich heute bei Ihnen bedanken." Da solche Texte wortwörtlich mit dem Auftraggeber abgestimmt werden, kann ich hier absichtliche Verschleierung des wahren Auftraggebers unterstellen. -- MaxxL - Disk 12:45, 21. Nov. 2015 (CET)
- Das assoziiert man doch extern immer miteinander. Extern ist WMDE Wikipedia. Also fällt alles was dort passiert auf Wikipedia und Schwesterprojekte zurück - wie auch anders herum. Marcus Cyron Reden 12:41, 21. Nov. 2015 (CET)
- Ich stimme Dir zu, dass die Trennung zwischen Verein und WP verbesserungsfähig ist. Allerdings bewegt sich da, zumindest nach meiner Einschätzung, die Tendenz in die richtige Richtung - von Seiten des Vereins. Innerhalb der WP wird der Verein dagegen meist noch immer als "Zuarbeiter der WP" verstanden, und genau das ist er eben nicht. Daher mein Trennungs-Hinweis oben. Dass der Callcenter-Mitarbeiter Mist gebaut hat, als er sich als "Wikipedia-Mitarbeiter" ausgegab, ist unstrittig. Die Frage ist allerdings, wie weit dies dem Verein anzulasten ist. Ich persönlich vermute einen ungeschickten Anrufer, kein unzureichendes Briefing des Vereins. Das entnehme ich der Nachfrage Tills am Beginn dieses Threads, zusammen mit seiner Aussage, dass es hier eine klare, anderslautende Vereinbarung mit dem Callcenter gäbe. Wie gesagt, die eigentliche Frage ist m.E., ob eine derartige Form der Aquise sinnvoll, notwendig oder vertretbar ist. Aber da dies der Verein initiierte ist dies auch eine Frage, die der Verein besprechen muss. Freundliche Grüße, --Unscheinbar (Diskussion) 12:35, 21. Nov. 2015 (CET)
- Ich würde liebend gerne zwischen Verein und Projekt trennen. Nur es ist genau der Verein, der diese Trennung regelmäßig verwischt, und zwar vorzugsweise dann, wenn's ums Geld geht. Wenn sich der Callcenter-Anrufer als "Wikimedia-MA" vorgestellt hätte, wäre das eine Sache des Vereins, wenn er sich als "Wikipedia-MA" vorstellt nicht. Warum macht er das? Entweder ist er schlecht informiert (dann wäre es traurig, wenn der Verein nicht mal externe Firmen über diese Trennung aufklären könnte) oder er realisiert sehr schnell, dass mit dem Hinweis auf die Unterschiede zwischen Projekt und Verein klein Blumentopf zu gewinnen ist. Genau deswegen werden diese Unterschiede in den Spendenkampagnen regelmäßig verwischt und das Thema ist ein dauerndes Ärgernis, und zwar für die unentgeltlichen Mitarbeiter hier, in deren Namen Geld eingetrieben wird. --Magiers (Diskussion) 12:26, 21. Nov. 2015 (CET)
- (Nach BK) Na ja, "daneben gegriffen" würde ich nun auch nicht unbedingt sagen, insbesondere wegen des Mitarbeiters des Callcenters, der sich falsch meldete. Aber hier, auf der Disku des Kuriers, gleiten derartige Hinweise sehr oft ein wenig ab. In meinen Augen ist das unbedingt ein Thema für den Verein, für die Wikipedia eher eine randständige Anmerkung. Dementsprechend halte ich eine Thematisierung innerhalb des Vereins und seiner Organe durchaus für sinnvoll, aber in der Wikipedia ist das eigentlich nicht so sinnvoll. Hier sollten wir die Zuständigkeiten etwas mehr trennen und nicht ständig alles nur auf die WP-Community beziehen, wo es größere Zusammenhänge gibt, die die WP nur einbeziehen, aber nicht ausschließlich betreffen. Freundlicher Gruß, --Unscheinbar (Diskussion) 12:12, 21. Nov. 2015 (CET)
- @Markus: Nach meiner Beobachtung stimmt das nur eingeschränkt. Gerade in Bezug auf Netzpolitik wird die Wikimedia offenbar durchaus als eigenständige Organisation wahrgenommen. In Bezug auf die Popularität der Projekte der Wikimedia ist allerdings der Glanz des "Flagschiffs" WP immer noch so groß, dass er die anderen Projekte überstrahlt. Mein persönliches, subjektives Verständnis dieses Punktes ist, dass wir von der - sehr naheliegenden, aber eben falschen - Egozentrik des "wichtigsten Projektes" Abstand gewinnen müssen. Ich denke, dass wir die Position des Vereins in der Öffentlichkeit ein wenig verzerrt wahrnehmen. Da hat sich in den letzten zwei, drei Jahren Erhebliches geändert. My 2¢. Freundlicher Gruß, --Unscheinbar (Diskussion) 12:48, 21. Nov. 2015 (CET)
- @Unscheinbar: Nach meiner Erfahrung haben die allermeisten, auch netzpolitisch interessierten bis engagierten Leute, mit denen ich über die Wikipedia und über Wikimedia gesprochen habe, sofern sie nicht gerade selbst im engeren Umkreis von Wikimedia-Projekten tätig sind, keine Ahnung vom Unterschied zwischen Wikipedia und Wikimedia, und wenn sie überhaupt mal von Wikimedia gehört haben, dann ist das für sie die Organisation, die Wikipedia betreibt. Wenn das Wissen so weit geht, dann ist das schon mal sehr viel. Wikimedia und die Wikimedia-Chapters ihrerseits sollten sich sehr bewusst sein, dass die allermeisten Spenden nicht irgendwie breit definiertem "freiem Wissen" zugute kommen sollen, sondern ganz konkret als Unterstützung der Wikipedia, eventuell noch ihrer Schwesterprojekte gemeint sind. Und genau darauf baut das Fundraising ja auch regelmässig auf - gemäss dem, was wir hier von MaxxL erfahren haben, auch diese Telefonkampagne ("Guten Tag Herr ..., die Wikipedia möchte sich heute bei Ihnen bedanken.") Gestumblindi 00:45, 22. Nov. 2015 (CET)
- Wieder ein Grund mehr nicht Vereinsmitglied zu sein/zu werden. Peinlich und igitt. 89.204.130.41 12:18, 21. Nov. 2015 (CET)
- Oder vielleicht eben gerade deswegen? Denn wenn man etwas ändern möchte, dann kann man es am Besten vom Inneren des Systems aus. Der "Gang durch die Instanzen", den die Grünen vor dreißig Jahren begannen, hat jedenfalls zu tiefgreifenden Änderungen unseres Staates geführt. Warum sollte dies hier anders sein? Wobei ich die dreißig Jahre allerdings gerne unterschreiten würde... --Unscheinbar (Diskussion) 13:28, 21. Nov. 2015 (CET)
- Die Mitglieder haben gegen die Hauptamtlichen keine Chance. Erstens sind letztere in vielen Fällen auch selbst Mitglied und stimmen mit ab, zweitens wird nach Kräften versucht, Anträge, die nicht aus dem direkten Umfeld von Präsidium und Geschäftsstelle kommen, zu verhindern (bzw. gibt es beim Wirtschaftsplan de facto keine Möglichkeit der Mitbestimmung, er wird immer als Gesamtpaket präsentiert und abgenickt) und drittens werden Beschlüsse der Mitgliederversammlung regelmäßig ignoriert oder nur halbherzig umgesetzt. Eine Mitgestaltung der Mitglieder ist nicht erwünscht, was aus Sicht der Hauptamtlichen auch eine durchaus nachvollziehbare Position ist, sichert es doch die eigene Arbeitsstelle.--Cirdan ± 14:04, 21. Nov. 2015 (CET)
- Kennst Du den Satz "Wer nicht kämpft hat schon verloren"? Ich habe nicht ohne Grund den "Gang durch die Institutionen" als Beispiel gewählt. Der schien nämlich zu Beginn auch völlig sinnlos. Freundlicher Gruß, --Unscheinbar (Diskussion) 14:15, 21. Nov. 2015 (CET)
- Klar, kenne ich, und es ist ja durchaus nicht so, dass ich und viele andere es nicht versucht hätten. Aber ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass mir persönlich meine Lebenszeit zu schade dafür ist, mich belügen zu lassen bzw. mich als Mitglied regelmäßig über hanebüchene Aktionen wie diese hier aufregen zu müssen. Ein Gang durch die Institutionen ist nur möglich, wenn es die entsprechenden Institutionen bzw. allgemeiner gesprochen Hebel auch gibt, was wir in der Bundespolitik mit Bundestag und Verfassungsgericht auch haben. De facto ist die Mitgliederversammlung von WMDE ein recht machtloses Gremium. Werden Entscheidungen nicht umgesetzt, gibt es keinerlei Möglichkeit, „hart“ gegen die Hauptamtlichen vorzugehen, d.h. Konsequenzen zu erwirken. Falls du in der unglücklichen Lage bist, noch Vereinsmitglied zu sein, schau dir nur mal die Liste der beschlossenen Anträge an. Wie viele davon wurden umgesetzt? Welche Konsequenzen hatte die Nicht-Umsetzung für die Verantwortlichen?--Cirdan ± 14:46, 21. Nov. 2015 (CET)
- Ja, die Listen kenne ich, natürlich. Und tatsächlich bin ich seit einigen Wochen im Verein Mitglied. Jepp, ganz neu, ganz frisch und sehr bewusst. Weil ich den Verein schon so lange kenne und beobachte und den Zeitpunkt für gegeben halte, nun tätig zu werden. Wie gesagt, wer etwas ändern möchte muss an den richtigen Stellen damit anfangen. Das muss nicht zwingend eine Fesstelle sein, das geh auch auf Mitgliedsebene. Aber es stimmt, was Du sagst: Man muss eben am Ball bleiben. Und natürlich sollte man sich dabei möglichst wenig frustrieren lassen. Nach meinen Erfahrungen in der WP ist es allerdings ziemlich schwierig geworden, dass ich mich frustriert zeige, wenn mal wieder ein Ziel nicht erreicht wurde. Es ist nur ein Grund, einen anderen Weg zu suchen. Mit freundlichem Gruß, --Unscheinbar (Diskussion) 14:57, 21. Nov. 2015 (CET)
- Ich wünsche dir – ganz ernsthaft – viel Erfolg dabei und hoffe, dass du eine Änderung bewirken kannst (oder im Zweifelsfall erkennst, wann es Zeit ist, aufzugeben, um nicht komplett den Spaß am Wikiversum zu verlieren). Aus meiner Sicht ist die einzige Möglichkeit (von „Hoffnung“ mag ich da natürlich nicht sprechen), dass der Verein mal so richtig vor die Wand fährt und dann mit kleinem Budget neu aufgebaut wird, ohne die gleichen Fehler zu wiederholen.--Cirdan ± 16:21, 21. Nov. 2015 (CET)
- Ich danke Dir herzlich, Cirdan. Ich denke, dass es möglich - wenn auch schwer erträglich - ist, Niederlagen einzustecken, wenn man ein Ziel vor Augen hat, das man als Wesentlich ansieht. Im vorliegenden Fall ist es mein Wunsch, eine möglichst breite, möglichst einfach zugängliche Wissensbasis zu schaffen, die gut fundierte, zuverlässige und aktuell gehaltene Informationen darbietet. "Freies Wissen" eben. Dafür ist die m.E. derzeit einflussreichste Organisation die Wikimedia, das bekannteste Projekt die Wikipedia. An beiden beteilige ich mich. Aber das Ziel ist eben, freies Wissen zu schaffen, nicht, Wikimedia oder Wikipedia unter allen Umständen die Fahne zu halten. Sie sind Mittel zum Zweck. Wenn es nicht diese beiden Projekte sind, die mich meinen Zielen näher bringen, dann werden es eben andere sein. Das verringert den Frustlevel erheblich. (Glaube mir, das hat lange gedauert, bis ich diese Sichtweise angenommen habe). Es ist das alte Spiel: Nur wer ein Ziel hat kann es aktiv erreichen. Und über seine Ziele sollte man sich im Detail klar sein, sonst wird man automatisch frustriert statt motiviert. Freundliche Grüße, --Unscheinbar (Diskussion) 16:47, 21. Nov. 2015 (CET)
- Ich wünsche dir – ganz ernsthaft – viel Erfolg dabei und hoffe, dass du eine Änderung bewirken kannst (oder im Zweifelsfall erkennst, wann es Zeit ist, aufzugeben, um nicht komplett den Spaß am Wikiversum zu verlieren). Aus meiner Sicht ist die einzige Möglichkeit (von „Hoffnung“ mag ich da natürlich nicht sprechen), dass der Verein mal so richtig vor die Wand fährt und dann mit kleinem Budget neu aufgebaut wird, ohne die gleichen Fehler zu wiederholen.--Cirdan ± 16:21, 21. Nov. 2015 (CET)
- Ja, die Listen kenne ich, natürlich. Und tatsächlich bin ich seit einigen Wochen im Verein Mitglied. Jepp, ganz neu, ganz frisch und sehr bewusst. Weil ich den Verein schon so lange kenne und beobachte und den Zeitpunkt für gegeben halte, nun tätig zu werden. Wie gesagt, wer etwas ändern möchte muss an den richtigen Stellen damit anfangen. Das muss nicht zwingend eine Fesstelle sein, das geh auch auf Mitgliedsebene. Aber es stimmt, was Du sagst: Man muss eben am Ball bleiben. Und natürlich sollte man sich dabei möglichst wenig frustrieren lassen. Nach meinen Erfahrungen in der WP ist es allerdings ziemlich schwierig geworden, dass ich mich frustriert zeige, wenn mal wieder ein Ziel nicht erreicht wurde. Es ist nur ein Grund, einen anderen Weg zu suchen. Mit freundlichem Gruß, --Unscheinbar (Diskussion) 14:57, 21. Nov. 2015 (CET)
- Klar, kenne ich, und es ist ja durchaus nicht so, dass ich und viele andere es nicht versucht hätten. Aber ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass mir persönlich meine Lebenszeit zu schade dafür ist, mich belügen zu lassen bzw. mich als Mitglied regelmäßig über hanebüchene Aktionen wie diese hier aufregen zu müssen. Ein Gang durch die Institutionen ist nur möglich, wenn es die entsprechenden Institutionen bzw. allgemeiner gesprochen Hebel auch gibt, was wir in der Bundespolitik mit Bundestag und Verfassungsgericht auch haben. De facto ist die Mitgliederversammlung von WMDE ein recht machtloses Gremium. Werden Entscheidungen nicht umgesetzt, gibt es keinerlei Möglichkeit, „hart“ gegen die Hauptamtlichen vorzugehen, d.h. Konsequenzen zu erwirken. Falls du in der unglücklichen Lage bist, noch Vereinsmitglied zu sein, schau dir nur mal die Liste der beschlossenen Anträge an. Wie viele davon wurden umgesetzt? Welche Konsequenzen hatte die Nicht-Umsetzung für die Verantwortlichen?--Cirdan ± 14:46, 21. Nov. 2015 (CET)
- Kennst Du den Satz "Wer nicht kämpft hat schon verloren"? Ich habe nicht ohne Grund den "Gang durch die Institutionen" als Beispiel gewählt. Der schien nämlich zu Beginn auch völlig sinnlos. Freundlicher Gruß, --Unscheinbar (Diskussion) 14:15, 21. Nov. 2015 (CET)
- Die Mitglieder haben gegen die Hauptamtlichen keine Chance. Erstens sind letztere in vielen Fällen auch selbst Mitglied und stimmen mit ab, zweitens wird nach Kräften versucht, Anträge, die nicht aus dem direkten Umfeld von Präsidium und Geschäftsstelle kommen, zu verhindern (bzw. gibt es beim Wirtschaftsplan de facto keine Möglichkeit der Mitbestimmung, er wird immer als Gesamtpaket präsentiert und abgenickt) und drittens werden Beschlüsse der Mitgliederversammlung regelmäßig ignoriert oder nur halbherzig umgesetzt. Eine Mitgestaltung der Mitglieder ist nicht erwünscht, was aus Sicht der Hauptamtlichen auch eine durchaus nachvollziehbare Position ist, sichert es doch die eigene Arbeitsstelle.--Cirdan ± 14:04, 21. Nov. 2015 (CET)
- Oder vielleicht eben gerade deswegen? Denn wenn man etwas ändern möchte, dann kann man es am Besten vom Inneren des Systems aus. Der "Gang durch die Instanzen", den die Grünen vor dreißig Jahren begannen, hat jedenfalls zu tiefgreifenden Änderungen unseres Staates geführt. Warum sollte dies hier anders sein? Wobei ich die dreißig Jahre allerdings gerne unterschreiten würde... --Unscheinbar (Diskussion) 13:28, 21. Nov. 2015 (CET)
Die Penetranz mit der in letzter Zeit massiv Spenden eingefordert werden ist peinlich. Schlimm, wie tief WM gesunken ist -- - Majo Senf - Mitteilungen an mich 12:48, 21. Nov. 2015 (CET)
Was meiner persönlichen Erfahrung nach auch recht wirksam ist: Jedem Bekannten, der mir erzählt, er habe schon mal für Wikipedia gespendet oder plane das zu tun, schicke ich ein paar Links auf diverse WMF/WMDE Seiten zur finanziellen Lage und der Mittelverwendung. --Varina (Diskussion) 15:04, 21. Nov. 2015 (CET)
- Hallo allerseits, ich bin ehrlich. Mich hat es sehr überrascht, wie stark hier die Ablehnung und Kritik ist, die zum Teil substantieller ist als das übliche Fundraising-Bashing. Da das Telefonfundraising von vielen großen Organisationen in ihrer Unterstützerkommunikation erfolgreich eingesetzt wird, wollten wir mit dieser Aktion schlicht herausfinden, ob diese Art der Kommunikation zum Zwecke der Diversifizierung der Fundraising-Maßnahmen auch für uns funktioniert. Die Aktion wird nächste Woche auslaufen. Ich kann euch versichern, dass diese große Ablehnung hier in unsere Bewertung der Maßnahme einfließen wird. Gruß, Till Mletzko (WMDE) (Diskussion) 15:56, 21. Nov. 2015 (CET)
- Ich hatte gerade heute überlegt, Mitglied von WMDE zu werden - aber dieses Verhalten von Seiten des Vereins stößt mich so ab, dass das in der nächsten Zeit wohl nichts werden wird. Wenn Ihr mit diesem Proteststurm richtig umgehen wollt, so kann das m.E. nur heißen: Am Montag wird die Aktion gestoppt!--Lutheraner (Diskussion) 20:02, 21. Nov. 2015 (CET)
- +1 gut. Danke, Till --Pankoken (Diskussion) 15:59, 21. Nov. 2015 (CET)
- Danke Dir für die Rückmeldung, Till. Freundlicher Gruß, --Unscheinbar (Diskussion) 16:09, 21. Nov. 2015 (CET)
- Es ist nur zu begrüßen, dass das dringend nötige Krisenmanagement bereits am Wochenende einsetzt, schon damit nicht im Kollateralgeschehen diejenigen WMDE-Mitarbeiter, die nach meinen Eindrücken ausgezeichnete Arbeit leisten, samt ihrem anerkennenswerten Wirken, wie zum Beispiel hier, gleich mit unter die Räder geraten. Die Sache selbst wird aber auch noch gemeinsam aufgearbeitet werden müssen, damit sich Ähnliches künftig nicht noch einmal wiederholt.
-- Barnos (Post) 18:39, 21. Nov. 2015 (CET)
- Es ist nur zu begrüßen, dass das dringend nötige Krisenmanagement bereits am Wochenende einsetzt, schon damit nicht im Kollateralgeschehen diejenigen WMDE-Mitarbeiter, die nach meinen Eindrücken ausgezeichnete Arbeit leisten, samt ihrem anerkennenswerten Wirken, wie zum Beispiel hier, gleich mit unter die Räder geraten. Die Sache selbst wird aber auch noch gemeinsam aufgearbeitet werden müssen, damit sich Ähnliches künftig nicht noch einmal wiederholt.
- Ich kann mich auch gern bei Till für seine Reaktion bedanken. Das Gefühl im Bauch bleibt jedoch, es ist mir eben unbegreiflich, dass so etwas zustande kam. Insbesondere auch, weil die Reaktion der Gemeinschaft doch (ja, das meine ich) absehbar war. -jkb- 18:48, 21. Nov. 2015 (CET)
- Die Schreckschwelle der Fassungslosigkeit muß man bei WMDE wohl stetiglich höher ansetzen. Aktueller Stand: Um bei den einfachen Vereinsmitgliedern höhere Beiträge bzw. zusätzliche Spenden zu aquirieren, haben Vorstand oder Geschäftsführung (Anmerkung: der feine Unterschied zwischen beiden geht mir gerade ziemlich irgendwo vorbei) eine professionelle Firma beauftragt, die Aquise durchzuführen und zu diesem Zweck besagter Firma einschlägige Daten der Mitgliederschaft, zumindest aber Namen plus Telefonnummern übermittelt. Die Aquise wird über ein Callcenter abgewickelt.
- Da das Kind (wie so oft) bereits in den Brunnen geplumst ist, Fragen an @Till Mletzko (WMDE):
- * Welche Daten genau wurden an den Auftragnehmer bzw. Aquise-Durchführer übermittelt? Nur die Telefonnummern oder zusätzlich weitere personenbezogene Daten?
- * Wurden neben den Daten von Vereinsmitglieder(inne)n zusätzlich Daten weiterer in den Datenbeständen von WMDE enthaltener Personen an den Aquise-Durchführer übermittelt (etwa Teilnehmer von Workshops, aus Projektanträgen, Bezuschussungsanträgen usw.)?
- * Hat WMDE mit der beauftragten Firma eine Vereinbarung getroffen im Hinblick auf eine rein projektbezogene Verwendung der übergebenen Personendaten? Umgekehrt gefragt also: eine Weiterverwendung oder gar Weiterveräußerung der Daten vertraglich ausgeschlossen? Oder wurden flankierend zu der in Auftrag gegebenen Telefonaquise auch frei weiterverwendbare Datensätze an den Auftragnehmer oder Dritte veräußert?
- Ich bin zwar kein Mitglied von WMDE. Über eine Beantwortung der aufgeführten Fragen würde ich mich jedoch auch in meiner Eigenschaft als Artikelautor in de:WP sehr freuen. --Richard Zietz 18:59, 21. Nov. 2015 (CET)
- Ich bin schon in einem anderen Verein Mitglied, was völlig reicht, aber mal was anderes: Jetzt, wo die Antelefonierfirma ja einen recht ordentlichen Bestand an Telefonnummern von WMDE-Fördermitgliedern hat, stellt sich die Frage, was die jetzt damit machen. Mir schwebt da ja so einiges vor...:-) --Schlesinger schreib! 19:51, 21. Nov. 2015 (CET)
- Ich bin zwar kein Mitglied von WMDE. Über eine Beantwortung der aufgeführten Fragen würde ich mich jedoch auch in meiner Eigenschaft als Artikelautor in de:WP sehr freuen. --Richard Zietz 18:59, 21. Nov. 2015 (CET)
Hier schwappt nun doch mal eine kleine Welle von Fassungslosigkeit über die Gier eines Wikipediaausbeutungsapparats entlang aber Fundraiser Till Mletzko ist sehr überrascht. Sollen wir jetzt die Frage diskutieren ob er sich nur dumm stellt oder einfach generell in einem anderen Universum zu hause ist? Dieses Universum wäre wohl als das eines grosskapitalistischen Unternehmens anzunehmen, das eine Marke besitzt, die es so selbstverständlich ausbeutet wie jeder andere Global Player. In diesem Universum sind wir hier die lustigen kleinen muppets, die freiwillig und unentgeltlich erarbeiten was Wikimedia dann vermarktet. --![]() itu (Disk) 19:52, 21. Nov. 2015 (CET)
itu (Disk) 19:52, 21. Nov. 2015 (CET)
- Mein ich glaube wirklich, das Till überrascht ist, weil so meine Gedanke, er nicht mit bekommen hat, was für ein Geheimis die Adressdaten mal waren, also eine Gruppe Mitglieder die Adressdaten für eine Umfrage haben wollte und die Begründung warum das so einfach nicht ging. Resultat für mich, immer aufpassen wo man Adresse und eine Telefon Nr hinterlässt. Für mich jedefalls auch ein NoGo, wenn man die ganzen Geschichten von früher (Datenschutz) noch in Erinnerung hat. Tschüß --Ra Boe --watt?? -- 23:20, 21. Nov. 2015 (CET)
- Du wirst aber zugestehen, daß es schon einen Unterschied macht, ob ich Privatpersonen einen Stapel persönlicher Daten übergebe (damals gings um Namen und Adressen, oder? war das die Geschichte mit der außerordentlichen MV?) oder einer Firma, die mit mir einen Vertrag abschließt, der selbstverständlich auch den vertraulichen Umgang mit den Daten beinhaltet (soz. single purpose und nach der Telefonaktion zu vernichten). Das „Daten an jemand anderen übergeben" im Grunde auch so eine wenn-die-Zahnpasta-aus-der-Tube-raus-ist-kriegt-man-sie-nicht-wieder-rein-Nummer ist, ist natürlich unbenommen. --Henriette (Diskussion) 23:55, 21. Nov. 2015 (CET)
- Vor zwei Jahren hatte uns schon mal jemand erzählt, sie hätten sich nichts dabei gedacht. Benutzer:Raboe001 saß mir damals gegenüber, links von mir saß Benutzer:Artmax und rechts von mir Benutzer:Jensbest. Und ich nehme an, bei WMDE ist jetzt, zwei Jahre später schon, niemand mehr beschäftigt, der sich überhaupt noch daran erinnern kann. Förderverein ohne Gedächtnis.--Aschmidt (Diskussion) 12:17, 22. Nov. 2015 (CET)
- @Henriette, ja natürlich, es ging mir eher um das "WIE" @ Aschmidt neue Besen hinterlassen auch mal Kratzspuren im frischen Linoleum. ;) Oder auch, das Rad muss zum dritten Mal neu erfunden werden. Tschüß --Ra Boe --watt?? -- 17:09, 22. Nov. 2015 (CET)
Zusammenfassend kann man wohl festhalten, dass beim Thema Fundraising dieses Jahr einiges aus dem Ruder gelaufen und nicht mit Auftreten dem vereinbar ist, was wir als Wikipedianer und auch die Öffentlichkeit von dieser Enzyklopädie und ihrem Förderverein erwarten. Wie schon an anderer Stelle geschrieben ist die aggressive Form des Fundraisings, wie sie mit dieser Telefonkampagne aber auch mit dem monströsen Spendenbanner betrieben wird, geeignet die Marke Wikipedia zu beschädigen. Das aktuelle Spendenziel von 8,9 Mio. € ist kaum noch jemandem plausibel zu erklären und spätestens, wenn dann nächstes Jahr (bei anhaltendem Anstieg) 10 Mio. als Ziel ausgegeben und entsprechend aggressiver eingeworben werden bekommen, wir echt ein akutes Glaubwürdigkeitsproblem. Und das bedroht dann auch mittel bis langfristig die von WMDE und der WMF aufgestellten Spendenziele selbst.
Ich kann nachvollziehen warum Till Mletzko und seine Kollegen dieses Jahr so aggressiv vorgehen - anders dürfte diese erneut ernormgesteigerte Summe kaum einzuwerben sein. Ich kann es jedoch in keinster Weise gut heißen. Hier wurde offensichtlich ein Partikularziel festgelegt, dass nur dann zu erreichen ist, wenn man dem eigentlichen Ziel unseres Projekts schadet. Und das ist nicht in Ordnung.
Meiner Meinung nach gefährdet das Fundraising in seiner jetzt Form die Glaubwürdigkeit der Wikimedia/Wikipedia. Und Glaubwürdigkeit, ist das wertvollste Kapital, dass wir in diesem Projekt haben. Darauf müssen wir (und das meine ich jetzt als Vereinsmitglied) deutlich besser aufpassen. // Martin K. (Diskussion) 00:38, 22. Nov. 2015 (CET)
- @Martin Kraft: der Öffentlichkeit zu erklären, in welchen rechtlichen/wirtschaftlichen Verhältnis Wikimedia und Wikipedia stehen ist meines Erachtens nicht sonderlich schwer. Beim Fußball weiß auch jeder, dass engagierte Mitarbeit in der Kreisliga nichts mit dem DFG Vorstand zu tun hat. Wenn also die WMDE öffentlich völlig den Bach runter geht, heißt das bei weitem nicht, das die öffentliche Nutzung der WP (des Produkts) darunter auch nur im mindesten leidet. Aus Sicht WP ist die Welt solange in Ordnung, wie der Betrieb der Server gesichert ist (und wegen mir noch etwas mehr). Und selbst für den allerschlimmsten Fall, das die Einnahmen unter die Ausgaben für den Serverbetrieb sinken ist keine Panik angesagt. Die Daten zu sichern, die Autorenschaft zusammen zu halten und einen neuen Verein zu gründen ist immer möglich. Wir sollten als Autorenschaft sowohl der Öffentlichkeit wie auch dem Verein sehr selbstbewusst sagen was wir von Spenden(aktionen) halten. Als Autorenschaft haben wir nicht zu befürchten - ganz im Gegenteil: wenn der Verein mal 10, 20 oder 30% weniger einnimmt, wäre das sicher keine übertriebene Abspeckkuhr. Letztendlich muss man die allseits beschworene Trennung zwischen Autorenschaft und Verein konsequent ausleben. -- Summer • Streicheln •
Note17:11, 22. Nov. 2015 (CET)
- @Summer ... hier!: Ich befürchte da irrst Du Dich. Dass weder Journalisten noch Spender zwischen der Wikipedia und Wikimedia unterscheiden können (oder wollen) ist offensichtlich; dafür gibt es unzählige Belege. Lies Dir nurmal die Spenderkommentare oder einen beliebigen Artikel zu Wikimedia durch. Dort werden WIkipedia und Wikimedia genauso häufig in einen Topf geworfen, wie bei dem was wir im Support-Team so mitbekommen. Uns kann es daher nicht egal sein, wenn WMDE etwas tut, was unser gemeinsames Image ramponiert.
- Gleichzeitig halte ich es weder für angemessen noch für produktiv diesen Konflikt direkt nach außen zu tragen so lange noch nicht alle Einflussmöglichkeiten ausgeschöpft sind, die wir als Autoren und Vereinsmitglieder haben. Ich halte es daher für wesentlich sinnvoller, die jetzigen Probleme im konstruktiven Dialog mit WMDE zu klären. Nur muss WMDE und insbesondere die Fundraising-Abteilung endlich mal Problembewusstsein an den Tag legen. Einfach den alljährlichen Shitstorm auszusitzen, nur um dann im darauffolgenden Jahr beim Spendeneinwerben noch aggressiver aufzutreten, ist nicht in Ordnung! // Martin K. (Diskussion) 20:44, 22. Nov. 2015 (CET)
- @Martin Kraft: Man muss zwischen Produkt und "Firma" unterscheiden. Das Produkt kommt beim Leser hervorragend an (man kann von einer Monopolstellung sprechen). Nach derzeitigen Stand ist das Produkt unkaputtbar (Gefahren sehe ich eher in Konflikten innerhalb der Community). Zum Beispiel wird das Produkt Fußball überleben ... egal wie viele Manager ins Gefängnis gehen. Ob der Konsument dabei exakt zwischen Produkt und "Firma" differenzieren kann ist belanglos. Er reicht wenn er kapiert: „die Artikel sind gut aber am Kopf stinkt es“. Er wird weiter konsumieren und weniger Spenden. Solange den Autoren die Mittel (hauptsächlich Server u. ein bisschen mehr) bleiben wird es das Produkt geben und eifrig genutzt werden.
- Ohne eine Rundum Kapitalismuskritik anzubringen: das System WMde ist auf Wachstum angelegt. Das ist nicht weil die Macher böse sind - das liegt in der Natur. Bestenfalls ein Kleingartenverein kann im Jahresbericht anführen „im letzten Jahr blühten die Blümchen genauso schön wie im Vorletzten“. WMde ist auf Erfolg getrimmt. Und Erfolg heißt u.a mehr Mittel zu Aquirieren. Und letztlich sind wir auch alle selbst schuld. Wir alle stellen Forderungen und freuen uns wenn wir sie durchgesetzt haben. Jeder von uns findet 3/4 der Mittelverausgabung unnötig. Nur bei dem 1/4 das wir für sinnvoll halten sind wir unerbittlich. Dumm nur, dass jeder ein anders 1/4 für sinnvoll hält. Letztendlich wird es irgendwann zum großen Knall kommen ... Dialog und Kompromiss zögern das nur hinaus.
- Abhilfe könnten nur sehr eng formulierte Ziele schaffen. Klare Grenzen. Ein Genug ist Genug. Aber davon sind wir meilenweit entfernt. -- Summer • Streicheln •
Note00:03, 23. Nov. 2015 (CET)- @Summer ... hier!: „das System WMde ist auf Wachstum angelegt. Das ist nicht weil die Macher böse sind - das liegt in der Natur.“ – das sehe ich anders. Bei jeglicher Art von Kapitalgesellschaft hast Du völlig Recht, denn hier ist das Unternehmensziel quasi immer die Maximierung des Gewinns, denn das ist es, das die Anteilseigner unterm Strich mittelfristig erwarten. Bei einem gemeinnützigen Verein ist das anders. Du hast zwar Recht, dass der Status Quo zu sein scheint, dass Kennzahlen, auch und insbesondere Wachstumskennzahlen, zu irgendeiner Art Bedürfnisbefriedigung zu dienen scheinen. Auf WMDE wird sicherlich ein Druck seitens der WMF ausgeübt, sei es nun explizit oder nur implizit durch das Damoklesschwert, die Spenden noch selbst eintreiben zu dürfen. Aber dass die WMF so dermaßen auf Wachstum und Kennzahlenoptimierung getrimmt ist, ist kein Problem irgendeines Systems, sondern allein ein selbstauferlegtes. Die Foundation und auch alle Chaptervereine könnten in ihrer Größe stagnieren, solange sie ihr Ziel – die Aufrechterhaltung des Betriebs und Unterstützung der Autoren – erreichen. Viele der angewandten Kennzahlen sind da ohnehin irrsinnig; Unterstützung lässt sich oft nicht messen. Yellowcard (D.) 01:08, 23. Nov. 2015 (CET)
- @Yellowcard: der Begriff System trifft es nicht - das war (m)ein Fehler. Ich meine eher die Natur der WMde. Das betrifft Struktur, Ziele, Mitarbeiter, einfach alles. Wenn bei Zielen keine Grenze eingezogen ist, verselbstständigen sie sich. Menschen sind auf Bestätigung und Erfolg ausgelegt (das ist Natur). Habe ich etwas gut gemacht, muss ich es in Zukunft besser machen. Konkurrenz gegenüber meiner eigenen Vergangenheit - natürlich auch gegenüber Kollegen. Habe ich eine Praktikantin eingestellt die eine neues Projekt betreuen soll suche ich nach Finanzmitteln um ihr eine befristete Stelle zu geben wenn sie ihren Job gut macht. Läuft das Projekt gut, versuche ich eine unbefristete Stelle zu organisieren (vielleicht kommen soziale Verantwortung hinzu - wenn ich z.B. weiß das die ehm. Praktikantin wegen einer Schwangerschaft auf den Job angewiesen ist).
- Menschen legen sich nicht ins Bett wenn Ziele erreicht sind. Man will mehr. Wir alle. Und wenn ein Kollektiv agiert, wird kann es zum Molloch werden wenn von außen Applaus und Geld kommt. Das ist nicht böse, das ist menschlich (oder natürlich).
- Die Welt ist voll von Projekten, Organisationen etc. die zu groß geworden sind. Ich habe das Beispiel Fußball genannt. Ursprünglich in der besten Absicht angelegt, Fußballfreunden ihr Vergnügen zu organisieren. Ist erstmal eine prima Sache. Inzwischen hat sich eine irrsinniges Maß an Macht gebildet. Der ADAC ist ursprünglich nur eine nette Pannenhilfe. Nenn mir nur ein Argument, warum sich die WMF/WMde nicht in die gleiche Richtung entwickeln sollte.
- Den einzigen Faustpfand den wir haben ist die Lizenz. Der WMde gehört nicht, was sie verwaltet. Im Prinzip kann die Communitie jederzeit „danke, das war's“ sagen. Was übrigens gegen ein „danke, das war's“ spricht, ist die Verzahnung der Daten (wikidata, commons; ein „danke, das war's“ erfordert mehr Organisation je mehr Verzahnung gegeben ist). Und man sollte der WMde hin und wieder sagen, das wir den Faustpfand haben. Nur mit selbstbewussten Auftreten können wir Einfluss nehmen. Aber letztendlich bin ich sehr skeptisch was unseren Einfluss den Molloch zu verhindern angeht. --Summer • Streicheln •
Note02:54, 23. Nov. 2015 (CET)
- @Summer ... hier!: „das System WMde ist auf Wachstum angelegt. Das ist nicht weil die Macher böse sind - das liegt in der Natur.“ – das sehe ich anders. Bei jeglicher Art von Kapitalgesellschaft hast Du völlig Recht, denn hier ist das Unternehmensziel quasi immer die Maximierung des Gewinns, denn das ist es, das die Anteilseigner unterm Strich mittelfristig erwarten. Bei einem gemeinnützigen Verein ist das anders. Du hast zwar Recht, dass der Status Quo zu sein scheint, dass Kennzahlen, auch und insbesondere Wachstumskennzahlen, zu irgendeiner Art Bedürfnisbefriedigung zu dienen scheinen. Auf WMDE wird sicherlich ein Druck seitens der WMF ausgeübt, sei es nun explizit oder nur implizit durch das Damoklesschwert, die Spenden noch selbst eintreiben zu dürfen. Aber dass die WMF so dermaßen auf Wachstum und Kennzahlenoptimierung getrimmt ist, ist kein Problem irgendeines Systems, sondern allein ein selbstauferlegtes. Die Foundation und auch alle Chaptervereine könnten in ihrer Größe stagnieren, solange sie ihr Ziel – die Aufrechterhaltung des Betriebs und Unterstützung der Autoren – erreichen. Viele der angewandten Kennzahlen sind da ohnehin irrsinnig; Unterstützung lässt sich oft nicht messen. Yellowcard (D.) 01:08, 23. Nov. 2015 (CET)
Das Problem sitzt viel tiefer, ist aber tivial: wo mehr Geld ist als unbedingt nötig ist, werden Projekte gestartet die dann ihrerseits Geld fordern. Die Spirale geht nach oben. Und igendwann landen alle gemeinützigen Organisationen da, wo momentan der Fußball steht. Der WP stehen mit absoluter Sicherheit übelste (Schmier)Geld Skandale bevor. Es ist nur eine Frage der Zeit. -- Summer • Streicheln • Note 00:41, 22. Nov. 2015 (CET)
Letztlich ist diese Art des (professionalisierten) Spendensammeln ein weiteres Symptom einer "Kapitalisierung" echter oder auch nur vermeintlicher gemeinnütziger Organisationen, was auch gerne mit dem Begriff "Spendenindustrie" bezeichnet wird. Ein Kennzeichen dafür ist, dass die Spendengenerierung sich personell und strukturell immer stärker vom eigentlichen/ursprünglichen Projekt abtrennt. Die Spenden werden nicht mehr von normalen Mitgliedern aufgebracht/eingesammelt/mitorganisiert, stattdessen hat man eine spezialisierte Abteilungen, die Spendenprofis einstellt, die dann wiederum ein (Groß)teil an kommerzielle Unternehmen outsourcen. Dabei entfernt man sich in jedem Schritt weiter vom ursprünglichen Projekt bis man man bein Callcenter-Angestellten landet, der mit dem ursprünglichen gemeinnützigen Projekt nicht mehr zu tun hat und nach ganz eigenen ökonomischen Vorgaben und Zwängen agiert. Wenn man sich bei der Professionalisierung erst einmal auf einer Ebene ist, die weit genug vom eigentlichen Projekt entfernt, wird dann eben auch agiert wie im "normalen Wirtschaftsleben" mit allen Unsitten auf die man dort öfter trifft, wenn es um das Geld geht. Insbesondere tritt dann auch die oben beschriebene Spirale immer stärker hervor.
Nun ist man bei der WMDE noch ganz am Rande der Spendenindustrie, aber die Entfernung eigentlichen Projekt (WM-Community-Mitglied->WMDE-Mitgied (oft auch kein aktives Community Mitglied (mehr)->Spendenabteilung->professioneller Spendensammler->Outsourcing/Call-Center) ist schon deutlich gewachsen und vermutlich steht auch irgendwann die Frage im Raum, falls die Telefonaktion unter Vereinsmitgliedern erfolgreich war, ob man Telefonaktionen (oder Briefaktionen) auch nicht (wiederum outgesourct) auf potenzielle Spender außerhalb des Vereins ausdehnt. Bei den externen die Arbeit ausführen wird dann vermutlich auch Addresshandel irgendwann im Raum.
Man muss sich als Community und Verein fragen, wie weit man diese "Professionalisierung" treiben und wie weit man sich den "üblichen" Markzmechaismen und Praktiken aussetzen will. Auch stellt sich die Frage inwieweit ständig steigende Spendeneinnahmen, deren sinnvolle und wirklich projektbezogene Ausgabe wohl auch immer schwieriger wird, überhaupt sinnvoll bzw. erstrebenswert sind.--Kmhkmh (Diskussion) 01:21, 22. Nov. 2015 (CET)
- @Benutzer:Till Mletzko (WMDE) Die Aktion wird nächste Woche auslaufen. Wie viel Mitglieder sollen nächste Woche noch angerufen werden? Warum wird die Aktion nicht sofort gestoppt? Es wäre schön nach der Aktion zu erfahren wie viel Austritte es gab. --Mauerquadrant (Diskussion) 04:17, 22. Nov. 2015 (CET)
- Und wie viele Anrufe wurden insgesamt getätigt? Um mal eine Vorstellung zu bekommen, was in den Augen von WMDE eine veruschweise kleine Anzahl von Anrufen ist.--
 22:21, 22. Nov. 2015 (CET)
22:21, 22. Nov. 2015 (CET)
- Und wie viele Anrufe wurden insgesamt getätigt? Um mal eine Vorstellung zu bekommen, was in den Augen von WMDE eine veruschweise kleine Anzahl von Anrufen ist.--
Mit Habermas könnte man sagen: Es findet eine „Kolonialisierung der Lebenswelt“ Wikipedia statt, z.B. in Form von plump gemachten PR-Artikeln, denen wir uns aber ganz gut erwehren, indem wir diesen Artikeln und Akteuren unsere Handlungslogik aufzwingen, die der Lebenswelt Wikipedia als der Welt der Artikel und Wikipedianer. Durch das Wachstums- und Quantitätsimperativen folgende Fundraising erfolgt ebenfalls eine solche Kolonisierung. Wie man aber ihr unsere Handlungslogik aufzwingt, das ist mir noch nicht klar. Atomiccocktail (Diskussion) 11:58, 22. Nov. 2015 (CET)
- Ein Tip an Kollege Habermas: Es geht um Macht. Macht nichts.--Aschmidt (Diskussion) 12:07, 22. Nov. 2015 (CET)
- Frankfurter Weisheiten: "Es gibt keinen richtigen Anschluss in der falschen U-Bahn." -- Andreas Werle (Diskussion) 16:02, 22. Nov. 2015 (CET)
- Oder: Es gibt keinen richtigen Edit im valschen.--Aschmidt (Diskussion) 17:05, 22. Nov. 2015 (CET)
- Frankfurter Weisheiten: "Es gibt keinen richtigen Anschluss in der falschen U-Bahn." -- Andreas Werle (Diskussion) 16:02, 22. Nov. 2015 (CET)
Na Leute, wieder mal die Nase gestrichen voll von WMDE? Wieder mal am Punkt angekommen, an dem nur noch mit dem Austritt gedroht werden kann? Aber Vorsicht: nur, wer Mitglied des Vereins ist, kann auch mit dem Austritt drohen oder gar tatsächlich austreten. Also, immer die korrekte Reihenfolge beachten: erst eintreten und dann mit dem Austritt drohen! ![]() --Holder (Diskussion) 16:55, 22. Nov. 2015 (CET)
--Holder (Diskussion) 16:55, 22. Nov. 2015 (CET)
- Die Drohung mit dem Austritt ist stark rückläufig, seit immer weniger Mitglied sind. Vielleicht hatte man auch gar nicht damit gerechnet, daß unter den Angerufenen überhaupt noch jemand war, der die Sache in den Kurier tragen würde. Neu hinzugekommen ist dagegen die Drohung mit dem Nicht-(Wieder-)Eintritt. Das ist wohl die derzeit häufigste Variante.--Aschmidt (Diskussion) 17:05, 22. Nov. 2015 (CET)
- Bei 20.000+ Mitgliedern sind denen ein paar Austritte von kritichen Mtgliedern nicht nur wumpe, sondern vermutlich sogar lieb. Das einzige, was den Vereinsmeiern wirklich wehtut, ist schlechte Presse, die zu Spendenrückgang führt. --Martina Disk. 17:43, 22. Nov. 2015 (CET)
- Na, wieder mal nicht die (längliche) Diskussion gelesen? Die "Drohung" gegenüber der WMDE, die oben im Raum stand war ein Autorenaufruf nicht zu spenden, dass benötigt weder Ein- noch Austritt.--Kmhkmh (Diskussion) 17:41, 22. Nov. 2015 (CET)
- Ach doch, natürlich habe ich das gelesen. Mal wieder ein höchst amüsantes Unterhaltungsprogramm, viel besser als Fernsehen. Aber im Ernst: Ich wundere mich etwas über den Vorschlag, zum Spendenboykott aufzurufen. Wahrscheinlich würde das da draußen sowieso niemanden interessieren, aber stellt Euch mal vor, das hätte wirklich Erfolg und die Spenden an Wikipedia blieben (gar dauerhaft?) aus, dann würde dieses ganze Projekt hier an die Wand fahren (Ihr wisst schon, Enzyklodingsbums und so ...). Das kommt mir ein wenig vor wie die «Unistreiks» von Studenten: am Ende schadet man sich vor allem selbst damit. Viel interessanter wäre als Druckmittel auf WMDE meines Erachtens ein Aufruf an die Foundation dem deutschen Chapter den Geldhahn abzudrehen, schließlich wollen die Leute in der Regel „an die Wikipedia“ spenden und nicht an irgendeinen Berliner Verein. Wie schnell wäre WMDE weg vom Fenster, wenn die Spenden in Zukunft nicht mehr über den Verein liefen, sondern direkt an die WMF gingen, und von dort auch nicht mehr an den Verein zurückflössen sondern direkt an Projekte von Wikipedia-AutorInnen ausgeschüttet würden? --Holder (Diskussion) 18:04, 22. Nov. 2015 (CET)
- Ja, das ist das Unterhaltungsprogramm mit dem vorweihnachtlichen Cliffhanger zum Ende der 15. Staffel. Mitte Januar beginnt dann die sechzehnte. Bin schon sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Habe vorhin ins Programm geschaut: Über die Feiertage kommen wieder lauter Wiederholungen.--Aschmidt (Diskussion) 18:31, 22. Nov. 2015 (CET)
- Vielleicht solltest du dir mal genauer anschauen was sich aufgrund von Studentenstreiks (auch) verändert hat.
- Was würde passieren, wenn die WMDE tatsächlich weniger Geld hat? Sie würde vermutlich mehr im Sinne der Community agieren und "sinnlose" Ausgaben reduzieren. Ein Anruf zur direkten Spende an die WMF, ist mehr oder weniger nur eine Variation des oben angedachten. Wie so oft bewegen sich Dinge immer dann, wenn es um Geld geht.
- Das eigentlich Interessante an der Diskussion ist aber aus meiner Sicht weniger der Popcorn-Aspekt der dich so zu begeistern scheint, sondern ein Nachdenken über Maßnahmen und Strukturen mit denen sich bestimmte unschöne Entwicklungen vielleicht auch eindämmen lassen. Dazu gehören mMn. auch ein ständiges Wachstum des "Unternehmen" Wikipedia mit einem ständig steigenden Finanz- bzw. Spendenbedarf.--Kmhkmh (Diskussion) 19:01, 22. Nov. 2015 (CET)
- Kmhkmh: ich würde mir ja gerne genauer anschauen, ob die Studentenstreiks tatsächlich jemals etwas bewirkt haben, aber die Informationen in unserem Artikel hierzu sind äußerst dürftig. --Holder (Diskussion) 05:25, 23. Nov. 2015 (CET)
- Na, wenn das Nachschlagen von de.WP abhängt, dann muss der Artikel wohl herhalten und der ist zweifelsohne sehr dürftig. Aber wenn man ihn schon heranzieht, dann gibt doch sein letzter Satzeinen Einblick in das (vermeintliche oder reale) Potenzial von Studentenstreiks.--Kmhkmh (Diskussion) 05:36, 23. Nov. 2015 (CET)
- @Holder: Als damals in Berlin Beteiligter und daher Original Research: Die Übernahme der FDP ist grandios gescheitert - es sind zwar etliche Studis eingetreten, nach dem anfänglichen Aktionismus ist allerdings alles im Sande verlaufen (und wir sind alle sehr kleinlaut wieder ausgetreten; die einzige parteipolitische Station meines Lebens, wie peinlich ...). Die Studenproteste insgesamt: Da sie sich vor allem gegen den Stellenabbau in den Unis und gegen Studiengebühren wendeten, hatten sie natürlich (kurfristigen) Erfolg - sogar die damals eingezogenen Studiengebühren wurden zurückerstattet - on the long run wurden danach jedoch Bachelar-/Master-Studiengänge eingeführt und es kam zu massiven Umstrukturierungen etc. Ob es mittlerweile wieder Studiengebühren in Berlin gibt, keine Ahnung ... Gruß -- Achim Raschka (Diskussion) 13:36, 24. Nov. 2015 (CET)
- Wurde eigentlich jemals eine Uni im Zuge eines Studentenprotests geforkt? --
 itu (Disk) 01:28, 24. Nov. 2015 (CET)
itu (Disk) 01:28, 24. Nov. 2015 (CET)
- Ja: Volks-Uni.--schreibvieh muuuhhhh 09:33, 24. Nov. 2015 (CET)
- Zählt die FU auch? Grüße vom Sänger ♫ (Reden) 09:41, 24. Nov. 2015 (CET)
- Ja: Volks-Uni.--schreibvieh muuuhhhh 09:33, 24. Nov. 2015 (CET)
- Kmhkmh: ich würde mir ja gerne genauer anschauen, ob die Studentenstreiks tatsächlich jemals etwas bewirkt haben, aber die Informationen in unserem Artikel hierzu sind äußerst dürftig. --Holder (Diskussion) 05:25, 23. Nov. 2015 (CET)
- Ach doch, natürlich habe ich das gelesen. Mal wieder ein höchst amüsantes Unterhaltungsprogramm, viel besser als Fernsehen. Aber im Ernst: Ich wundere mich etwas über den Vorschlag, zum Spendenboykott aufzurufen. Wahrscheinlich würde das da draußen sowieso niemanden interessieren, aber stellt Euch mal vor, das hätte wirklich Erfolg und die Spenden an Wikipedia blieben (gar dauerhaft?) aus, dann würde dieses ganze Projekt hier an die Wand fahren (Ihr wisst schon, Enzyklodingsbums und so ...). Das kommt mir ein wenig vor wie die «Unistreiks» von Studenten: am Ende schadet man sich vor allem selbst damit. Viel interessanter wäre als Druckmittel auf WMDE meines Erachtens ein Aufruf an die Foundation dem deutschen Chapter den Geldhahn abzudrehen, schließlich wollen die Leute in der Regel „an die Wikipedia“ spenden und nicht an irgendeinen Berliner Verein. Wie schnell wäre WMDE weg vom Fenster, wenn die Spenden in Zukunft nicht mehr über den Verein liefen, sondern direkt an die WMF gingen, und von dort auch nicht mehr an den Verein zurückflössen sondern direkt an Projekte von Wikipedia-AutorInnen ausgeschüttet würden? --Holder (Diskussion) 18:04, 22. Nov. 2015 (CET)
ich sehe diese diskussion erst jetzt, habe ausschließlich die ersten kommentare gelesen und möchte dennoch festhalten: ein abtelefonieren von spendern/fördermitgliedern, um nach einer spendenerhöhung zu fragen, ist für mich ein no-go, wie es kaum ein größeres geben kann. würde ich angeklingelt diesbezüglich, so wäre es ganz sicher auch das allerletzte mal gewesen, da auch nur einen penny abgegeben zu haben. hammer. --JD {æ} 17:48, 22. Nov. 2015 (CET)
Wäre eigentlich langsam mal Zeit, dass man der WMDE hier keine Werbefläche mehr bietet. Oder hat sie sich dieses Recht von der WMF vertraglich zusichern lassen? DestinyFound (Diskussion) 19:33, 22. Nov. 2015 (CET)
- Meinst du mit Werbefläche das Spendenbanner? --Schlesinger schreib! 20:23, 22. Nov. 2015 (CET)
- Früher™ hätte es noch Admins gegeben, die sowas hätten abschalten können.--Aschmidt (Diskussion) 21:25, 22. Nov. 2015 (CET)
- Nein, nicht der Banner. Die Textbox auf der Hauptseite: "Derzeit läuft die aktuelle Spendenkampagne. Gespendet werden kann direkt an den Betreiber, die Wikimedia Foundation, und an die als gemeinnützig anerkannten Vereine Wikimedia Deutschland, Wikimedia CH und Wikimedia Österreich." DestinyFound (Diskussion) 21:26, 22. Nov. 2015 (CET)
- Früher™ hätte es noch Admins gegeben, die sowas hätten abschalten können.--Aschmidt (Diskussion) 21:25, 22. Nov. 2015 (CET)
auch ich stoße gerade dazu und bin schwer beeindruckt: die WMDE begibt sich hier auf ein niveau der billigsten klitschen samt ihren angeheuerten call-zentren. wer in berlin kam auf diese abgrundtief fowle idee? b) die meisten meiner journalistenkollegen wissen natürlich nicht, was der unterschied zwischen wikipedia, wikimedia, geschweige wiki commons ist. wie auch? das ist angesichts der namensnähe ganz schwer. Maximilian (Diskussion) 21:15, 22. Nov. 2015 (CET)
@DestinyFound: Dann könnten doch die Admins den Text in der Hauptseitenrubrik Wikipedia aktuell, oben links, in dem für die derzeitige Spendenkampagne geworben wird, entfernen. Zumindest solange, bis WMDE glaubhaft Besserung gelobt hat. Ich bin dafür. --Schlesinger schreib! 08:40, 23. Nov. 2015 (CET)
- und WMAT und WMCH werden gleich mitbestraft, zur sicherheit oder wie? --kulacFragen? 08:52, 23. Nov. 2015 (CET)
- Gleich bestraft? Interessante Terminologie. Egal. WMAT und WMCH können ja auf WMDE einwirken, die Telefonaquise sofort einzustellen. Geht WMDE darauf ein, ist die Sache erledigt. Geht WMDE aber nicht darauf ein, wird eben der Werbetext so verändert, dass WMDE dort nicht mehr aufscheint, sondern nur noch CH und AT. --Schlesinger schreib! 09:04, 23. Nov. 2015 (CET)
- aus sicht von WMAT ist der hinweis der einzige in der wp auf das lokale fundraising. alle bannerklicks aus AT gehen ansonsten in die USA, darum meine diktion. wenn du nur WMDE entfernen willst, will ich nichts gesagt haben, wenngleich nur WMCH und AT im text sich aber auch etwas merkwürdig lesen würde. ich billige das telefonfundraising im übrigen ebensowenig wie der rest der diskutanten hier. ich sehe jedoch keine möglichkeit, über den thread hier hinaus irgendwie einfluss diesbezüglich auf WMDE nehmen zu können. das hat schon bei weniger wichtigem nur schwer funktioniert. lg, --kulacFragen? 10:40, 23. Nov. 2015 (CET)
- @Schlesinger: WMAT und WMCH hier in Sippenhaft zu nehmen fände ich auch in höchstem Maße unangebracht. Es handelt sich hier um ein Problem mit WMDE (und bestenfalls noch der WMF). Und da wäre es geradezu kontraproduktiv und unglaubwürdig andere Chapter zu bestrafen, die dieses problematische Verhalten selbst überhaupt nicht an den Tag legen. // Martin K. (Diskussion) 11:49, 23. Nov. 2015 (CET)
- aus sicht von WMAT ist der hinweis der einzige in der wp auf das lokale fundraising. alle bannerklicks aus AT gehen ansonsten in die USA, darum meine diktion. wenn du nur WMDE entfernen willst, will ich nichts gesagt haben, wenngleich nur WMCH und AT im text sich aber auch etwas merkwürdig lesen würde. ich billige das telefonfundraising im übrigen ebensowenig wie der rest der diskutanten hier. ich sehe jedoch keine möglichkeit, über den thread hier hinaus irgendwie einfluss diesbezüglich auf WMDE nehmen zu können. das hat schon bei weniger wichtigem nur schwer funktioniert. lg, --kulacFragen? 10:40, 23. Nov. 2015 (CET)
- Gleich bestraft? Interessante Terminologie. Egal. WMAT und WMCH können ja auf WMDE einwirken, die Telefonaquise sofort einzustellen. Geht WMDE darauf ein, ist die Sache erledigt. Geht WMDE aber nicht darauf ein, wird eben der Werbetext so verändert, dass WMDE dort nicht mehr aufscheint, sondern nur noch CH und AT. --Schlesinger schreib! 09:04, 23. Nov. 2015 (CET)
Also man darf schon mal wieder einige Dinge mit Abstand und Vernunft betrachten. WMDE sammelt das Geld quasi für die WMF ein. Allein deshalb könnt ihr hier über irgendwelche Verbote oder sonst was nachdenken, es wird nicht passieren. Die WMF als Betreiber wird weiter sein Geld sammeln. Und bei aller berechtigten Kritik an WMDE - was die WMF mit ihrem Geld macht halte ich für weitaus bedenklicher. Davon kommt nun wirklich kaum noch etwas bei den Autoren an. Dann ist es mir lieber, wenn es bei WMDE landet, da wird immerhin ein größerer Teil zurück an die Autoren gegeben. Mir immernoch zu wenig, immernoch zu viel Selbsterhalt. Aber besser als an vielen anderen Stellen. Davon zu trennen ist die Telefonaquise, um die es hier eigentlich geht. Es wurde ja der Auftrag ausgegeben, unabhängiger von den Spendengeldern zu werden - und von der WMF, mit der es derzeit Verträge zum Geldsammeln und Teilen gibt. Und da versucht man offensichtlich neue Wege zu betreten. Und der Weg über dieses Telefonmarketing ist das, worum es hier geht. Und das ist eben nicht akzeptabel, denn es fällt auf unser ganzes Projekt zurück. Das ist deshalb fatal, weil es nicht nur eine nervige Sache ist, sondern möglicherweise rechtlich bedenklich. Moralisch in meinen Augen auf alle Fälle. Deshalb ist es durchaus das gute Recht von uns, gegen derart aktive Vorgänge zu protestieren. Das passive Geld sammeln - sollen sie halt machen (wenn bitte auch nicht in der Form wie derzeit - je aufdringlicher, desto inakzeptabler). Aber der Rückfluss dürfte ein anderer sein. Das oberste und zentrale Ziel kann einfach nicht der Erhalt der Geschäftsstelle mit den Mitarbeitern sein. Marcus Cyron Reden 09:21, 23. Nov. 2015 (CET)
- Ich vermute eher, dass Direktspenden aus so einer Telefonaktion unter WMDE-Mitgliedern gerade nicht für die WMF gesammelt werden, sondern direkt an WMDE gehen. --Ailura (Diskussion) 15:14, 23. Nov. 2015 (CET)
- Sollte aus meinem Text der Eindruck entstehen, das würde ich anders sehen oder Darstellen, ist das ein Fehler meinerseits im Text. Ich dachte, ich hätte das deutlich genug gemacht, daß ich das ja gerade für einen Teil der Unabhängigkeitsstrategie halte. Hoffe mit dem Zusatz jetzt wird das klarer. Marcus Cyron Reden 21:33, 23. Nov. 2015 (CET)
- Ich vermute eher, dass Direktspenden aus so einer Telefonaktion unter WMDE-Mitgliedern gerade nicht für die WMF gesammelt werden, sondern direkt an WMDE gehen. --Ailura (Diskussion) 15:14, 23. Nov. 2015 (CET)
- Was mich neben der Telefonaquise so richtig verärgert, ist der Umgang mit persönlichen Daten von Mitgliedern. Es scheint sich zum wiederholten Mal zu zeigen, dass in Teilen der Geschäftsstelle ein anderes Verständnis oder lockeres Verhältnis dazu besteht. Ich suche seit geraumer Zeit nach dem Link / Häkchen, durch das man die Weitergabe von persönlichen Daten / zur Aufnahme telefonischen oder Emailkontakts usw. explizit befürworten oder ablehnen kann, wenn man Vereinsmitglied wird. Das ist doch nun bei allen Organisationen, Vereinen, Versicherungen ein Mindeststandard. Ich finde auch einen nachträgliches opt-In dazu mehr als hilfreich und angebracht. Ich erwarte, dass man in der Geschäftsstelle das Vorgehen noch einmal kritisch hinterfragt und entsprechende Maßnahmen für die Zukunft ergreift. Ich habe selbstverständlich auch mit vielen Mitarbeitern der Geschäftsstelle zu tun gehabt, die sehr sorgsam mit den privaten Daten umgehen, aber diese Aktion hat mal wieder viel Vertrauen gekostet. Geolina mente et malleo ✎ 12:06, 23. Nov. 2015 (CET)
- +1. Maximilian (Diskussion) 14:56, 23. Nov. 2015 (CET)
- +1 - Was ich mir darüberhinaus gewünscht hätte, wäre dass eine solche Aktion vorher der Mitgliedschaft hier im Kurier angekündigt wird, damit man nicht wie vom Blitz durch eine Kaltaquise getroffen wird. Bin ich eigentlich der Einzige oder gibt es weitere Opfer dieser Aktion? Läuft sie immer noch weiter? - MaxxL - Disk 12:17, 23. Nov. 2015 (CET)
- Du bist Sicherlich einer der wenigen, da die wenigsten Fördermitglieder auch Wikipedianer sein dürften. Die spenden Geld weil sie Wikipedia gut finden und glauben, dass eine Spende "an den Wikipedia-Verein" für den erhalt des lexikons gebraucht wird. WM wird einen teufel tun ihnen zu erklären wo genau die mehrheit des geldes versackt :D ... ...Sicherlich Post 12:54, 23. Nov. 2015 (CET) schon klar; steht ja alles in den Berichten die online sind usw. daher hat WM stets seine Pflicht getan und sehr genau informiert .oO
Eintreten statt austreten! - Man kann natürlich aus dem Verein austreten weil man mit den methoden und der geldverschwendung nichts zu tun haben will.
vielleicht ist es aber klüger einzutreten und auf einer MV (die nächste ist dieses Wochenende!) mal zu klären was das soll. - denn WM wird so oder so weiter mit Wikipedia werben und geld verdienen. Ob dort überhaupt noch ein Autor drin ist oder nicht wird davon nicht berührt.
Wie gesagt, nächsten Sonnabend von 9:30 bis 18:00 ist die MV in Berlin, Eventpassage am Bahnhof Zoo, Kantstr. 8 ...Sicherlich Post 12:57, 23. Nov. 2015 (CET)
- Naja, extra einem Verein beizutreten, um Stunk zu machen ist wohl ein wenig kontraproduktiv nehme ich an. Aber der Verein WMDE hat doch ein gewähltes Präsidium, in dem, oh Wunder, auch ein paar gestandene Wikipedianer sitzen. Also, das Megafon der Autorendemo nach Berlin gerichtet: Hallo hallo, Präsidium! Hier spricht die Basis. Wir hätten jetzt gern sofort ein aussagefähiges Statement zu der Sache mit der Telefoniererei, denn nicht wenige finden das gar nicht so dolle! --Schlesinger schreib! 13:19, 23. Nov. 2015 (CET)

- Nicht mit dem Austritt, nein, mit dem Eintritt drohen, das kommt mir irgendwie bekannt vor! Wir müssten ja nur 20.000 Wikipedianer zusammenbekommen, die Mitglied von WMDE werden wollen, dann haben wir die Mehrheit ... --Holder (Diskussion) 13:47, 23. Nov. 2015 (CET)
- Danke, ihr bringt mich auf so gute Ideen. Ich plane jetzt meinen Eintritt bei der Bundeswehr mit dem Ziel eines Umbaus zu einer Friedensarmee. Man muss einfach was tun, statt immer nur rumzujammern. Von alleine wird die Welt ja nicht besser. --
 itu (Disk) 00:38, 24. Nov. 2015 (CET)
itu (Disk) 00:38, 24. Nov. 2015 (CET)
- weil ein soldat mitbestimmen kann so wie es ein vereinsmitglied tun kann? Hinken ist bei dem vergleich ja kaum noch ein ausdruck!?...Sicherlich Post 00:45, 24. Nov. 2015 (CET)
- Das ist am Ende alles eine Frage der Durchsetzungsfähigkeit. --
 itu (Disk) 01:34, 24. Nov. 2015 (CET)
itu (Disk) 01:34, 24. Nov. 2015 (CET)
- Das ist am Ende alles eine Frage der Durchsetzungsfähigkeit. --
- weil ein soldat mitbestimmen kann so wie es ein vereinsmitglied tun kann? Hinken ist bei dem vergleich ja kaum noch ein ausdruck!?...Sicherlich Post 00:45, 24. Nov. 2015 (CET)
- Danke, ihr bringt mich auf so gute Ideen. Ich plane jetzt meinen Eintritt bei der Bundeswehr mit dem Ziel eines Umbaus zu einer Friedensarmee. Man muss einfach was tun, statt immer nur rumzujammern. Von alleine wird die Welt ja nicht besser. --
- Früher™ gabs schon mal einen ähnlichen Vorschlag: Alle sollten sich Aktien kaufen und dann zur Hauptversammlung gehen und als Kapitaleigner gegen „das Kapitel“ abstimmen. SCNR ;) --Aschmidt (Diskussion) 00:55, 24. Nov. 2015 (CET)
- und keiner hats gemacht weil "einer allein kann ja nicht" und wer bin ich schon usw.?! ... man muss es halt auch tun wenns einen wirklich interessiert. ... ist natürlich mit aufwand verbunden dieses blöde demokratische dingensding .oO - von daher ist das wehklagen hier schon besser. stimmt. ...Sicherlich Post 01:04, 24. Nov. 2015 (CET)
- Früher™ gabs schon mal einen ähnlichen Vorschlag: Alle sollten sich Aktien kaufen und dann zur Hauptversammlung gehen und als Kapitaleigner gegen „das Kapitel“ abstimmen. SCNR ;) --Aschmidt (Diskussion) 00:55, 24. Nov. 2015 (CET)
- 20.000 Wikipedianer? Wegen der Zahl der Vereinsmitglieder? Guck mal wie die Teilnehmerzahlen bei einer MV sind. Die meisten Mitglieder sind karteileichen. Die sind weder auf einer MV noch tun sie sonstwas. die sind nur für die zahlenwixerei von WMD. Also da reichen viel weniger. ...Sicherlich Post 14:23, 23. Nov. 2015 (CET)
- Ich bringe zu dem Thema einen Dringlichkeits-Antrag ein. Wer also zur MV kommt, kann über das Thema diskutieren und darf auch mit dafür sorgen, dass die Aktion ein einmaliger Unfall bleibt. --DaB. (Diskussion) 15:32, 23. Nov. 2015 (CET)
Ich würde gerne grundsätzlich, als Wikipedianer und als - wenn man will - Bewohner eines Haushaltes etwas dazu sagen. Ich persönlich halte derartige Telefonanrufe grundsätzlich für eine üble Belästigung, über die ich mich sehr ärgere. Es mag wenige Ausnahmen geben, zum Beispiel wenn der Schatzmeister eines Vereines, in dem man Mitglied ist, anruft, um eine Formalie zu klären. Wenn er aber anfängt nach dem Motto: "Wärst Du bereit, eventuell 10 Euro mehr zu geben", dann wäre ich sauer. Ich frage mich tatsächlich, wie so eine Entscheidung zustande kommt. Wären in dem Gremium Menschen, die aus der Perspektive des Mitgliedes/Verbrauchers denken können, dürfte so eine Entscheidung gar nicht zustande kommen. --Norbert Bangert (Diskussion) 15:11, 23. Nov. 2015 (CET)
- die WMDE will heute eine offizielle stellungnahme im kurier veröffentlichen. ich bin gespannt. Maximilian (Diskussion) 15:27, 23. Nov. 2015 (CET)
Hallo alle, wir sind eure Anmerkungen und Fragen durchgegangen. Ich beantworte sie hier gesammelt. Vorab: Weiter oben schrieb ich, dass wir die Aktion diese Woche auslaufen lassen werden. Die Anrufe werden nun ab sofort eingestellt.
Warum haben wir diesen Test gestartet? Es ist in den letzten Jahren unter anderem der Wunsch der Mitgliederversammlung gewesen, das Fundraising zu diversifizieren. Telefonaktionen sind erprobte Mittel anderer NGOs, weshalb wir darauf jetzt zurückgegriffen haben. Im Mittelpunkt stand für uns ganz klar die Zufriedenheit der Angerufenen. Es ist natürlich nicht in unserem Sinn, wenn Fördermitglieder nach so einem Anruf unzufrieden sind. Konkret abgefragt wurden im Gespräch deshalb unter anderem Änderungen von Adressdaten und sonstige Wünsche des jeweiligen Mitglieds. Bis Sonntag wurden 108 Fördermitglieder angerufen, von denen 44% sich für eine Beitragserhöhung entschieden haben.
Zu den gesammelten Fragen:
- Es wurden bisher 108 Fördermitglieder angerufen, in einem Pool von bis zu 3.000 Menschen. Das bis zu ist wichtig, weil wir die Rückmeldungen laufend überprüfen, je nach Reaktion/Zufriedenheit, bevor weiter angerufen wird. Daher auch die bisher kleine Zahl von 108 Erreichten.
- Das Briefing an den Dienstleiter lautete, sich im Auftrag von Wikimedia Deutschland zu melden, nicht in Vertretung der Wikipedia o. Ä.
- Es wurden ausschließlich Fördermitglieder angerufen, keine dritten Personen.
- Neben Namen und Telefonnummer wurden im Gespräch wie oben gesagt die Adressdaten abgeglichen und ggf. die Kontoverbindung falls gewünscht. Eine Weiterverwendung der Daten per Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung ist natürlich ausgeschlossen.
Gruß, Till Mletzko (WMDE) (Diskussion) 15:34, 23. Nov. 2015 (CET)
- danke für die erläuterungen, till! a) offen bleibt, wie so etwas entschieden wurde und in zukunft entschieden werden würde. b) nicht angesprochen wurde, wie der datenfluss passierte und welche seriosität das callcenter hat. Maximilian (Diskussion) 20:29, 23. Nov. 2015 (CET)
- Es ist der WDME also gelungen, ein richtig effizient arbeitendes Call-Center zu finden, in dem 21 Mitarbeiter es geschafft haben, 108 Fördermitglieder zu erreichen. Selbst wenn pro erreichtem Mitglied zwei nicht erreicht wurden, komme ich da auf ca. 15 Anrufe pro Mitarbeter (von denen 2/3 vielleicht eine Minute gedauert haben, weil ja keiner erreicht wurde). Wie lange haben denn bitte die 21 Mitarbeiter für die fünf erfolgreichen Anrufe pro Mitarbeiter gebraucht? Und was hat der ganze Spass gekostet, sprich: was wurde dafür an das Call-Center gezahlt? Wenn es wirklich um so wenige Anrufe ging, wieso hat sich da nicht einer der WMDE-Mitarbeiter mal einen Tag ans Telefon gesetzt und ausprobiert?--
 09:52, 24. Nov. 2015 (CET)
09:52, 24. Nov. 2015 (CET) - Das ist mal ne echt gute Frage… ^^ Ich vermute, dass man nur einoder zwei Callcenter-Mitarbeiter darauf angesetzt hat; wo dann der Sinn liegt, ist natürlich die Frage. --MGChecker – (📞| 📝|
 ) 20:06, 24. Nov. 2015 (CET)
) 20:06, 24. Nov. 2015 (CET)
- +1. @Till Mletzko (WMDE): gibt es antworten auf die fragen nach Deinem zusammenfassenden posting? Maximilian (Diskussion) 23:48, 24. Nov. 2015 (CET)
- Offenbar hat @Till Mletzko (WMDE): seit dem 24. November Urlaub, oder wieso erhalten wir hier keine Antwort?--
 11:21, 2. Dez. 2015 (CET)
11:21, 2. Dez. 2015 (CET)
- Offenbar hat @Till Mletzko (WMDE): seit dem 24. November Urlaub, oder wieso erhalten wir hier keine Antwort?--
- +1. @Till Mletzko (WMDE): gibt es antworten auf die fragen nach Deinem zusammenfassenden posting? Maximilian (Diskussion) 23:48, 24. Nov. 2015 (CET)
- Es ist der WDME also gelungen, ein richtig effizient arbeitendes Call-Center zu finden, in dem 21 Mitarbeiter es geschafft haben, 108 Fördermitglieder zu erreichen. Selbst wenn pro erreichtem Mitglied zwei nicht erreicht wurden, komme ich da auf ca. 15 Anrufe pro Mitarbeter (von denen 2/3 vielleicht eine Minute gedauert haben, weil ja keiner erreicht wurde). Wie lange haben denn bitte die 21 Mitarbeiter für die fünf erfolgreichen Anrufe pro Mitarbeiter gebraucht? Und was hat der ganze Spass gekostet, sprich: was wurde dafür an das Call-Center gezahlt? Wenn es wirklich um so wenige Anrufe ging, wieso hat sich da nicht einer der WMDE-Mitarbeiter mal einen Tag ans Telefon gesetzt und ausprobiert?--
Update: Die Mitgliederversammlung hat beschlossen, über meinen Antrag zwar zu diskutieren aber abzulehnen nicht abzustimmen. Damit kann Wikimedia Deutschland auch weiterhin solche Telefon-Aktionen durchführen. --DaB. (Diskussion) 17:00, 28. Nov. 2015 (CET)
- Aha, das heißt dann, dass wir uns bei der nächsten Spendenkampagne auch wieder so richtig schön aufregen dürfen? Prima! --Schlesinger schreib! 17:10, 28. Nov. 2015 (CET) :-)
- Gab's Diskussionen und Begründungen für dieses imho komplett unakzeptable Vorgehen als Telefonspammer? Grüße vom Sänger ♫ (Reden) 17:27, 28. Nov. 2015 (CET)
- Die Hauptbegründung war, dass die Aktion ja bereits eingestellt sei – man habe auch nicht vorhersehen können, dass wir Wikipedianer damit ein Problem haben könnten. Außerdem war die Test-Aktion wohl recht erfolgreich (also in finanzieller Hinsicht). Es wurde auch daraufhingewiesen, dass eine vergangene Mitgliederversammlung mal gebeten habe, auch andere Formen der Spendeneinnahmen auszuprobieren; und das sei nun eben ein solcher Versuch gewesen. Ein Präsidiums-Mitglied riet noch dazu, bei WMDE die Löschung der Telefon-Nummer zu beantragen, wenn man nicht angerufen werden möchte. --DaB. (Diskussion) 19:09, 28. Nov. 2015 (CET)
- Gab's Diskussionen und Begründungen für dieses imho komplett unakzeptable Vorgehen als Telefonspammer? Grüße vom Sänger ♫ (Reden) 17:27, 28. Nov. 2015 (CET)
Hm. Komme gerade nach Hause und lese hier. Ich tröste mich mit der Hoffnung, dass meine Stimme das Ergebnis wohl nicht hätte anders werden lassen, es ging nun mal wirklich nicht. Schade. Grüße -jkb- 19:15, 28. Nov. 2015 (CET)
WMF: Fundraising-Update
Siehe auch Fundraising-Update von Megan Hernandez und die Ergebnisse der unlängst in den Vereinigten Staaten durchgeführten Online-Umfrage zu den Spendenbannern (pdf-Dokument hier, Diskussion hier auf Meta).
Immerhin ist positiv zu vermerken, dass der Wortlaut "Wikipedia online und werbefrei halten" jetzt der Vergangenheit angehört. Die Umfrage kommt hinsichtlich der beurteilten englischen Banner zu dem Schluss, dass die meisten Teilnehmer nicht (mehr?) das Gefühl haben, hier gehe es darum, eine drohende Finanzkrise abzuwenden.
Aktuelle englische Spendenbanner-Designs kann man hier finden:
Das oben besprochene Telefonfundraising von Wikimedia Deutschland wird in der kommenden Ausgabe des Signpost besprochen. Andreas JN466 20:41, 23. Nov. 2015 (CET)
- Dass vom Wortlaut "Wikipedia online und werbefrei halten" Abstand genommen wird, kann man leider auch anders als nur positiv interpretieren .... --
 itu (Disk) 00:45, 24. Nov. 2015 (CET)
itu (Disk) 00:45, 24. Nov. 2015 (CET)

- Falls noch ein Bildchen von der Mitgliederstruktur fehlt. Derzeit zählt der Verein 23.875 Mitglieder. Davon sind 1.969 Aktive Mitglieder und 21.906 Fördermitglieder. Es gibt natürlich einen handfesten Grund, warum WMDE so stark (im Wikipedia Spendenbanner, am Telefon) um Fördermitglieder wirbt.
- 2013-2014 Plan: Revenue source Membership fees 410,000 € (As of September 6, 2013 we had 6.917 members (1.705 active and 5.212 sustaining members).)
- 2015-2016 Plan: Membership dues 1,260,000 € Estimate based on previous years (Revenue expectations based on current number of members)
- Es geht um Geld, klar. Vor allem aber muss WMDE seine Fördermitgliedsbeiträge nicht erst nach Übersee transferieren und dann zurückbetteln, wie bei den "normalen" Bannerspenden, afaik. --Atlasowa (Diskussion) 13:38, 24. Nov. 2015 (CET)
- Falls noch ein Bildchen von der Mitgliederstruktur fehlt. Derzeit zählt der Verein 23.875 Mitglieder. Davon sind 1.969 Aktive Mitglieder und 21.906 Fördermitglieder. Es gibt natürlich einen handfesten Grund, warum WMDE so stark (im Wikipedia Spendenbanner, am Telefon) um Fördermitglieder wirbt.
Warum sehen die Banner so aus?
- Wer entwirft eigentlich diese Banner? Von der Designabteilung der WMF ist man eigentlich Professionellers gewohnt.
- Warum haben die (abgesehen von der Illu im Lightbulb-Banner) wirklich so überhaupt nichts mit dem übrigen Erscheinungsbild der Wikimedia zu tun? Wenn man sein eigenes Corporate Design ignoriert, wirkt das doch nur unseriös.
- Warum gibt es in keinem der Banner irgendeinem Link über den man erfahren kann, was wirklich mit dem Geld passiert? Z.B. sowas wie der Punkt "Wohin geht meine Spende?" unter spenden.wikimedia.de
- Warum sind sämtlich Banner mit einem Fließtext mit einer Texthierachie vollgeklatscht, der für eine schnelle Wahrnehmbarkeit eindeutig zu lang ist. Das liest doch kein Mensch.
- Wer hat diese Farben aus gesucht? Das abgetönte Taubenblau und Grau, war vielleicht vor 10 Jahren mal modern. Diese schwarzen Flächen sehen aus wie Traueranzeigen.
- Warum wird hier gegen die einfachsten UX-Prinzipien verstoßen. Die die optisch auffälligsten Elemente (darunter auch sowas wie ein Button) sind nicht klickbar. Es gibt Icons (wie dieses i) ohne jede Funktion, dafür aber keinen klaren Call-to-Action im Formular. Es gibt viel zu viel Text. Usw.
- Warum haben weder der Text noch die Motive etwas mit den Benefits der Wikipedia zu tun? Die Kaffee-Tasse ist als Key-Visual ja kaum an Beliebigkeit zu überbieten.
Ehrlich gesagt frag ich mich ob an diesen Bannern überhaupt mal irgendwer mit einer gestalterischen Ausbildung gearbeitet hat. Sieht für mich eher so aus, als hätten das irgendwelche Fundraiser- oder Marketingmenschen selbst zusammengeschuster. Das mag jetzt hart klingen (und ist definitiv nicht persönlich gemeint) aber keiner dieser Banner hätte bei uns im Agenturalltag auch nur die erste Korrekturrunde überlebt..
P.S.: Bevor jetzt wieder das Argument kommt, dass sei alles ausführlich getestet worden: Auch solche Test ersetzen weder eine ordentliche Konzeption noch einen vernünftigen Text- und Layout-Entwurf. Wenn beide zur Auswahl stehenden Varianten Murks sind, kann auch bei einem A/B-Text nichts Vernünftiges rauskommen. // Martin K. (Diskussion) 22:36, 23. Nov. 2015 (CET)
- Reminder @Till Mletzko (WMDE):: Diese Fragen waren übrigens nicht (nur) rhetorisch gemeint: Mich würde es interessieren, warum die Dinger so aussehen, wie sie aussehen und wer dafür gestalterisch verantwortlich ist. // Martin K. (Diskussion) 15:50, 1. Dez. 2015 (CET)
- Reminder @Till Mletzko (WMDE):: Ich nerve ja wirklich ungern, würde mir aber trotzdem Wünschen, dass Du mal irgendwie auf die hiesigen Fragen reagierst, bevor dieser Abschnitt weg archiviert wird. //Martin K. (Diskussion) 20:08, 3. Dez. 2015 (CET)
- Reminder @Till Mletzko (WMDE): (Sicher nicht nur) ich warte hier immer noch auf irgendeine Reaktion. // Martin K. (Diskussion) 14:33, 9. Dez. 2015 (CET)
- Reminder @Till Mletzko (WMDE):: Ich nerve ja wirklich ungern, würde mir aber trotzdem Wünschen, dass Du mal irgendwie auf die hiesigen Fragen reagierst, bevor dieser Abschnitt weg archiviert wird. //Martin K. (Diskussion) 20:08, 3. Dez. 2015 (CET)
- Reminder @Till Mletzko (WMDE):: Diese Fragen waren übrigens nicht (nur) rhetorisch gemeint: Mich würde es interessieren, warum die Dinger so aussehen, wie sie aussehen und wer dafür gestalterisch verantwortlich ist. // Martin K. (Diskussion) 15:50, 1. Dez. 2015 (CET)
- ich finde die Banner zwar auch furchtbar, aber ich weiß gar nicht ob ich das schlecht finde. gute banner würde WM noch mehr Geld in die kasse spülen ohne das wikipedia et al. davon besser würden.
- schräg finde ich auch wohin geht meine Spende-Seite die im zweiten Schritt zu finden ist.
- Ein Tortendiagramm in blautönen?! - Farbe alle? Wohl aber absicht damit man nicht merkt wo das geld versickert?
- "Nur" 14 % in Verwaltung; klingt gut! Ist aber der größte Posten vom WMD-Budget und wohl nicht zufällig ganz unten angeordnet! und 34 % wären ehrlicher; der anteil am WMD-Budget. Denn das WMF-Budget ist wohl auf grund technischer Gründet nicht weiter ausgeführt und enthält ja auchnochmal einen relevanten anteil verwaltung ...Sicherlich Post 00:07, 24. Nov. 2015 (CET)
- @Sicherlich: Naja, eine monochrome Farbwahl ist ja nicht unbedingt ein Kennzeichen von gestalterischem Unvermögen (eher im Gegenteil). „Viel hilft viel“ ist gerade im Hinblick auf Farben sicherlich nicht immer zielführend. In dieser Grafik scheint es ja vor allem darum zu gehen, wieviel % der Spenden an die WMF gehen und wie viel bei WMDE bleibt (und da funktionieren Grün und Blau schon ganz gut). Die Zuordnung der Einzelposten bei WMDE zu den einzelnen Diagrammsegmenten ist natürlich ausbaufähig. Aber ganz im Gegensatz zu den Bannern, wurde diese Grafik offensichtlich von jemandem mit gestalterischen Kenntnissen erstellt. // Martin K. (Diskussion) 17:37, 24. Nov. 2015 (CET)
- +1 Martin K., die Banner sind schrecklich, wobei mich als Leser vor allem (zu 95%) deren Größe stört und die Tatsache, dass sie nach 3 Sekunden Artiken-Anlesen ohne Vorwarnung von oben reingerasselt kommen wie ein plötzlich brutal herruntergelassener Fensterrolladen, und das zu kleine Schließen-x. Ich lese Wikipedia auch auf dem Tablet und dort normalerweise unangemeldet, weil Cookies kaum einen Tag lang erhalten bleiben. Da wird mir (und sicher nicht nur mir) Wikipedia alljährlich zur Vorweihnachtszeit durch die verdammten Spendenbanner verleidet. Wenn sie nach einmal x-Drücken weg blieben für den Rest des Jahres, wäre es etwas anderes. Als angemeldeter User habe ich natürlich den Bannerblock aktiv. Aber auf Mobil- und Tabletgeräten ist es mit dem Angemeldetbleiben ein technisches Problem, wodurch einem dann die Banner wieder, wie jedem unangemeldeten Wikipedia-Leser, richtig weh tun. --Neitram ✉ 15:45, 1. Dez. 2015 (CET)
- Die Banner sehen so aus, weil sie so die meisten Spenden generieren. Wikimedia Deutschland lässt sich gut beraten, siehe z.B. Storytelling-Kampagne 2010/2011. Viele Banner, die nett anzuschauen sind und auf der viele User gerne und lange verweilen, verleiten potentiell Geldgebende nicht zum Spenden. Irgendwelche theoretischen Richtlinien und modernen Farbvarianten werden in dem Moment irrelevant, in dem die praktischen Tests andere Ergebnisse zeigen. −Sargoth 16:28, 1. Dez. 2015 (CET)
- Werden die nicht zentral in Meta erstellt, also hier z.B.? Grüße vom Sänger ♫ (Reden) 16:43, 1. Dez. 2015 (CET)
- Nicht die DE-Banner, glaub ich. Das wird aber in enger Abstimmung gemacht. Es ist nun mal so, dass jeder Test auf Wikipedia durch die hohe Zahl der Besuchenden dermaßen quantitativ signifikante Ergebnisse zeigt, dass wahrscheinlich jede NGO gut beraten ist, sie für ihre Website einfach 1=1 zu kopieren. Selbst kleinste Satzteiländerungen führen im Live-Test zur Erhöhung oder Verringerung der (zahlreichen) Klein- oder (seltenen) Großspenden, zum Wegklicken oder Spenden. Ich kann keine Antwort auf einzelne Fragen geben, aber die Antwort auf generelle Frage im Titel lautet "weil sie wirken". Die WMF hat übrigens eine andere Spenderstruktur als WMDE, das muss selbstverständlich immer nach regionalen Kultur- und Geschmacksmustern angepasst werden (wieder mit Tests). Ich bin übrigens ziemlich sicher, dass Till auf die schlimmsten Augenkrebsbanner verzichtet, auch wenn diese 0,3 Cent mehr in der Stunde bringen. Grüße −Sargoth 16:52, 1. Dez. 2015 (CET)
- Werden die nicht zentral in Meta erstellt, also hier z.B.? Grüße vom Sänger ♫ (Reden) 16:43, 1. Dez. 2015 (CET)
- Die Banner sehen so aus, weil sie so die meisten Spenden generieren. Wikimedia Deutschland lässt sich gut beraten, siehe z.B. Storytelling-Kampagne 2010/2011. Viele Banner, die nett anzuschauen sind und auf der viele User gerne und lange verweilen, verleiten potentiell Geldgebende nicht zum Spenden. Irgendwelche theoretischen Richtlinien und modernen Farbvarianten werden in dem Moment irrelevant, in dem die praktischen Tests andere Ergebnisse zeigen. −Sargoth 16:28, 1. Dez. 2015 (CET)
- Dass die Banner so sch*** aussehen müssten um möglichst viel Geld zu generieren, ist eine immer wieder verbreitete, empirisch aber in keinster Weise bewiesen Behauptung. Da meines Wissens in den letzten Jahren überhaupt keine echten Alternativen getestet, sondern immer nur kleinste Details an diesem Text-Wüsten-Banner variiert wurden, ist die Behauptung, ein erfolgreicher Banner könne nur genau so (und nicht anders) aussehen, schlicht unseriös.
- Wahrscheinlicher ist, dass sich auf Grund der immer immer weiter in die Höhe geschraubten Spenden-Ziele im Fundraising-Team niemand mehr traut, ein Risiko ein zugehen. Und deshalb nimmt man einfach weiterhin das, von dem man aus dem Vergangen Jahr weiß, dass es halbwegs funktioniert hat und schaltete es noch größer und noch brachialer (irgendwoher müssen die 10% Steigerung ja kommen). Das viel gerühmte A/B-Testing beschränkt sich meines Wissens auf minimalste Abwandlungen des ewig Selben und dient neben der Optimierung dieses einen Banners sicher auch dazu der Community genau das zu vermitteln, was Sargoth oben geschrieben hat: die Illusion von Alternativlosigkeit.
- Ich bestreite ja gar nicht, dass das Prinzip „mehr Spenden durch Penetranzsteigerung“ eine Zeit lang funktionieren kann. Aber eine Zeit lang dachten auch die VW-Ingenieure, sie hätte Ihrem Unternehme mir diesem Abgaswert-Trojaner einen großen Dienst erwiesen...
- Nachhaltig ist anders...
- P.S.: Selbst wenn Inhalt, Aufbau und Größe wirklich „alternativlos“ wären, sollte es übrigens möglich sein, auf dieser Basis einen Banner konform zum Wikimedia Erscheinungsbild zu gestalten. Auf spenden.wikimedia.de bekommt man das ja auch irgendwie hin. // Martin K. (Diskussion) 17:21, 1. Dez. 2015 (CET)
- Lieber Martin K., wenn Du Dir die Mühe gemacht hättest, meinen Links zu folgen, hättest Du gesehen, dass Sie 2010/2011 noch komplett anders aussahen (ein einziger Satz mit Kopffoto, verlinkend auf eine sog. "Story". Zu dieser Zeit hat übrigens Godfather Jimbo die meisten Spenden ergeben, auch wenn die Story bestimmter Autoren lieber gelesen wurden [Verweildauer]). Ich kann in Deinem Rant daher keine Stringenz oder Substanz erkennen und antworte auch nur, um Dich zu bitten, etwas freundlicher zu formulieren. Macht so keinen Spaß. Ich wollte nur etwas Helligkeit ind Dunkel bringen und habe keinerlei Interesse daran, stellvertretend für Forschung und Entwicklung der Wikimedia-Fördergesellschaft beschimpft zu werden. Grüße −Sargoth 17:50, 1. Dez. 2015 (CET)
- P.S.: Selbst wenn Inhalt, Aufbau und Größe wirklich „alternativlos“ wären, sollte es übrigens möglich sein, auf dieser Basis einen Banner konform zum Wikimedia Erscheinungsbild zu gestalten. Auf spenden.wikimedia.de bekommt man das ja auch irgendwie hin. // Martin K. (Diskussion) 17:21, 1. Dez. 2015 (CET)
- Danke, Ich kann mich gut an die 2010/11-Kampagne erinnern. Und wenn Du da mehr weißt, wüsste ich doch gerne, warum Du diese Kampagne als Misserfolg und als Beleg dafür interpretierst, dass diese Form glaubwürdiger und Community-naher Spendenwerbung nicht funktioniert. In der Spendenstatistik kann ich 2010/11 jedenfalls weder einen Einbruch noch eine Stagnation der Spendenentwicklung entdecken.
- Meine Kritik bezog sich auch nicht auf diese Kampagne, sondern auf die in den Jahren danach, in denen vorwiegend mit reinen Textbannern gearbeitet und meines Wissens keine grundsätzlich anderen Bannerkonzepte mehr getestet wurden. So unterscheiden sich z.B. die Banner von 2013 inhaltlich nicht nennenswert von dem, was wir heute noch in abgemilderter Farbe aber dafür deutlich gesteigerter Größe unseren Lesern zumuten. Der Banner in der mobilen Version dürfte mit den Bannern von damals sogar fast identisch sein. Und ich finde es dann doch sehr gewagt, dass nach fünf(!) Jahren damit zu begründen, man habe ja schon mal was anderes probiert und das hier funktioniere eben besser.
- Nein, mir geht es hier auch nicht um einen sinnlosen Rant, sondern um die echte und berechtigte Sorge darüber, dass dieses Holzhammer-Fundraising unseren Ruf nachhaltig beschädigt und damit mittel- bis langfristig genau dem Projekt schadet, dem es eigentlich dienen soll. Bei mir persönlich haben sich (via OTRS und privat) jedenfalls schon genug Leute über den Banner beschwert. Und die Zweifel daran, ob das ein authentischer Wikimedia-Banner oder ein Pishingversuch ist, lassen sich wirklich gut nachvollziehen.
- Ich hatte (wie viele andere auch ) den Banner bereits letztes und vorletztes Jahr kritisiert, Probleme konkret und sachlich benannt und Veränderungswünsche/Verbesserungsvorschläge geäußert. Es wurde mehr fach versprochen, dass nächstes Jahr alles Besser würde, dass man darüber reden könne, wenn die Kampagne mal vorbei ist, dass es eine Session auf der WikiCon geben solle. Passiert ist davon de facto NICHTS. Auch dieses Jahr gab es (meines Wissens) keinerlei Vorabstimmung des Banners mit der Community und statt die Kritik von letztem Jahr aufzunehmen wurde der Banner noch größer und noch nerviger. Ich habe (wie wahrscheinlich die meisten anderen auch) den Banner mehr durch Zufall entdeckt, als ich Wikipedia an einem anderen Rechner öffnete. Man muss hier wirklich niemandem was böses wollen, um zu vermuten, dass dieser Ausschluss angemeldeter Nutzer vom Banneranzeige eher dem Versuch geschuldet ist, Konflikten mit der Community aus dem Weg zugehen, in dem man unter deren Radar bleibt. // Martin K. (Diskussion) 18:33, 1. Dez. 2015 (CET)
- Hm, die WikiCon wurde auf der WMDE-Versammlung angesprochen, ich glaube, im Zusammenhang mit dem Fundraising. Die Einreichung wurde wohl nicht angenommen (mangels breiterem Interesse ?). Siehe Wikipedia:WikiCon_2015/Programmvorschläge Nr. 45. Das auch wieder nur rein Infomäßig
 −Sargoth 18:51, 1. Dez. 2015 (CET)
−Sargoth 18:51, 1. Dez. 2015 (CET)
- Hm, die WikiCon wurde auf der WMDE-Versammlung angesprochen, ich glaube, im Zusammenhang mit dem Fundraising. Die Einreichung wurde wohl nicht angenommen (mangels breiterem Interesse ?). Siehe Wikipedia:WikiCon_2015/Programmvorschläge Nr. 45. Das auch wieder nur rein Infomäßig
- Das hat Till mir auch schon geschrieben. Meines Erachtens darf die Tatsache, dass man im ersten Programmentwurf fehlt, kein Grund sein, das einfach fallen zulassen. Wenn man sich da etwas dahinter geklemmt hätte, wäre da sicher noch was möglich gewesen - zur Not in einem der freien Räume, die ja extra für spontane Sessions und Treffen vorgesehen waren.
@Paulae: kannst Du aufklären, warum diese Session auf der WikiCon rausgefallen ist? Eigentlich fand da doch überhaupt kein Voting statt?!. - So oder so sehe ich hier WMDE (und insbesondere die Fundraising-Abteilung) in der Bringschuld gegenüber der Community. Und wenn die Community nicht von alleine kommt, dann muss man eben aktiv auf sie zugehen. Schließlich ist das Banner ein erheblicher Eingriff in das Erscheinungsbild der Website und die direkte Monetarisierung unser aller Arbeit. Da kann und sollte man schonmal die Meinung derer einholen, die hier das ganze Jahr über aktiv sind und nicht nur die zwei Fundraising-Monate. // Martin K. (Diskussion) 19:21, 1. Dez. 2015 (CET)
- Ja, ich kann sagen, warum die Session nicht zustande kam. Till Mletzko hat auf meine Nachfragen nie reagiert und den Referentenfragebogen nie ausgefüllt. Irgendwann hab ich das Programm dann ohne seinen Beitrag gebaut bzw. bauen müssen, weil ich schlichtweg keinerlei Info zu Zeiten, Datum und Technik etc. bekommen habe. --Paulae 22:41, 2. Dez. 2015 (CET)
- Sowas hatte ich fast vermutet.
- Natürlich kann jeder mal eine Mail übersehen. Aber die Tatsache, dass auch später niemand mal bei der WikiCON-Orga nachgehakt oder alternativ einen anderen Weg der Community-Beteiligung gesucht hat, zeigt dann doch deutlich, dass dieses Thema bei WMDE offensichtlich nicht die nötige Priorität hatte. // Martin K. (Diskussion) 23:00, 2. Dez. 2015 (CET)
- Ja, ich kann sagen, warum die Session nicht zustande kam. Till Mletzko hat auf meine Nachfragen nie reagiert und den Referentenfragebogen nie ausgefüllt. Irgendwann hab ich das Programm dann ohne seinen Beitrag gebaut bzw. bauen müssen, weil ich schlichtweg keinerlei Info zu Zeiten, Datum und Technik etc. bekommen habe. --Paulae 22:41, 2. Dez. 2015 (CET)
- Das hat Till mir auch schon geschrieben. Meines Erachtens darf die Tatsache, dass man im ersten Programmentwurf fehlt, kein Grund sein, das einfach fallen zulassen. Wenn man sich da etwas dahinter geklemmt hätte, wäre da sicher noch was möglich gewesen - zur Not in einem der freien Räume, die ja extra für spontane Sessions und Treffen vorgesehen waren.
Artikel zum Spendenbanner in der Washington Post: Wikipedia has a ton of money. So why is it begging you to donate yours? --Andreas JN466 10:16, 3. Dez. 2015 (CET)
WaPo über Fundraising-Kampagne
Info: Caitlin Dewey: Wikipedia has a ton of money. So why is it begging you to donate yours?. In: Washington Post. 2. Dezember 2015. And if the community doesn’t want what’s best for Wikipedia long-term? Well, it’s just a matter of time until we see inside that particular can of worms. Leaving aside Wikipedia’s other well-documented problems, there’s already evidence that donations might be due for a fall-off. Page views are down across most editions of the site, and more people than ever read Wikipedia on their phones, where they’re far less likely to donate.--Aschmidt (Diskussion) 21:05, 3. Dez. 2015 (CET)
- Bissig: "an annual Internet tradition as reliable as year-end lists and April Fool’s fakes" ;-) Gestumblindi 21:39, 3. Dez. 2015 (CET)
- Mal auf DACH übertragen: Wir müssen uns darüber im klaren sein, daß die Aussage im diesjährigen DE-Banner, es fehlten acht Millionen Euro, wahr ist; sie stammt nur nicht von uns. Selbst wenn der eine oder die andere community-gefördert übers Wochenende im Laufe des kommenden Jahres mal irgendwohin fährt, kostet das zzgl. dem Betrieb der Website nicht im ganzen gesehen acht Millionen Euro für die gesamte Community. Und der Rest ist erst recht nicht acht Millionen Euro wert. Aber die Aussage ist trotzdem wahr. Diejenigen, die sie formulieren, denen fehlen acht Millionen Euro.--Aschmidt (Diskussion) 22:06, 3. Dez. 2015 (CET)
Die European Science Photo Competition-Initiative aus dem Osten
Schade. Wenn man erst hinterher davon hört, kann man schwerlich mitmachen. Marcus Cyron Reden 12:42, 2. Dez. 2015 (CET)
- Hast du alle Banner abgeschaltet? :) --Regiomontanus (Diskussion) 01:51, 3. Dez. 2015 (CET)
- Wer etwas nur über Banner ankündigt sollte eigentlich wissen das er dadurch einen großen Teil der aktiven Nutzer nicht erreicht. --Mauerquadrant (Diskussion) 02:03, 5. Dez. 2015 (CET)
- Eine interessante Feststellung, die ich mir für die nächste European Science Photo Competition vormerken werde. Und wie erreicht man die Wikipedianer, die sich dafür interessieren dann? Mit einem Artikel im Kurier, wenn gerade keine wichtige Russland-Artkeldiskussion auf der Hauptseite stattfindet? --Regiomontanus (Diskussion) 02:36, 5. Dez. 2015 (CET)
- Hier nochmals die Links: Commons:European Science Photo Competition 2015 und European Science Photo Competition 2015. --Regiomontanus (Diskussion) 02:47, 5. Dez. 2015 (CET)
- Ich kann hier nur von mir sprechen ich habe im Jahre 2006 #fundraising und im Jahre 2007 #siteNotice Bei mir über das CSS ausgeblendet. (Das war beides in einem Vorgängeraccount) Wenn ich mich recht erinnere gab es damals noch keine Schließen-Button. Eine einzeilige unaufdringliche Benachrichtigung würde ich akzeptieren alles was größer ist nicht. Wenn ich mir die aktuellen Spenden-Banner anschaue wird sich daran so schnell nichts ändern. Die Banner sind vor fast 10 für Benachrichtigungen durch übermäßige Nutzung unbrauchbar geworden. Lies einfach mal in die FZW-Archiv wenn gerade neu Banner geschaltet wurden. (Beispiel) --Mauerquadrant (Diskussion) 09:35, 5. Dez. 2015 (CET)
- Soviel ich der obigen Spenden-Diskussion entnommen habe, wird das Spendenbanner für angemeldete User nicht eingeblendet. Aber der Rest ist mir schon klar und ich werde das demnächst, wenn wieder ein Fotowettbewerb angekündigt wird, berücksichtigen. Danke für den Hinweis. MfG --Regiomontanus (Diskussion) 03:48, 8. Dez. 2015 (CET)
- Ich kann hier nur von mir sprechen ich habe im Jahre 2006 #fundraising und im Jahre 2007 #siteNotice Bei mir über das CSS ausgeblendet. (Das war beides in einem Vorgängeraccount) Wenn ich mich recht erinnere gab es damals noch keine Schließen-Button. Eine einzeilige unaufdringliche Benachrichtigung würde ich akzeptieren alles was größer ist nicht. Wenn ich mir die aktuellen Spenden-Banner anschaue wird sich daran so schnell nichts ändern. Die Banner sind vor fast 10 für Benachrichtigungen durch übermäßige Nutzung unbrauchbar geworden. Lies einfach mal in die FZW-Archiv wenn gerade neu Banner geschaltet wurden. (Beispiel) --Mauerquadrant (Diskussion) 09:35, 5. Dez. 2015 (CET)
- Hier nochmals die Links: Commons:European Science Photo Competition 2015 und European Science Photo Competition 2015. --Regiomontanus (Diskussion) 02:47, 5. Dez. 2015 (CET)
- Eine interessante Feststellung, die ich mir für die nächste European Science Photo Competition vormerken werde. Und wie erreicht man die Wikipedianer, die sich dafür interessieren dann? Mit einem Artikel im Kurier, wenn gerade keine wichtige Russland-Artkeldiskussion auf der Hauptseite stattfindet? --Regiomontanus (Diskussion) 02:36, 5. Dez. 2015 (CET)
- Wer etwas nur über Banner ankündigt sollte eigentlich wissen das er dadurch einen großen Teil der aktiven Nutzer nicht erreicht. --Mauerquadrant (Diskussion) 02:03, 5. Dez. 2015 (CET)
#gld15
"Wikipedia ist kein Lehrmittel" war Konsens in dem Video. Ich habe mir schon manchmal die Frage gestellt, wie ein Wikipedia-Artikel aussehen müsste, damit er als Lehrmittel besser taugt. Die im Video benannte Länge mancher Artikel möchte ich jedenfalls nicht ändern, denn manche Themen sind nicht kurz abzuhandeln, wenn sie vollständig sein wollen. --Goldzahn (Diskussion) 07:44, 6. Dez. 2015 (CET)
- Es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Lehrbuch und einer Enzyklopädie: Ein Lehrbuch geht (wie eine Vorlesung oder Unterrichtsreihe auch) von einem bestimmten Kenntnisstand aus und baut dann schrittweise Wissen zu einem Thema auf, eine Enzyklopädie gibt einen umfassenden, vollständigen Überblick. Sehr gut sieht man das bei vielen mathematisch-naturwissenschaftlichen Artikeln, wo entweder Grundlagen in diversen Artikeln immer wieder neu präsentiert werden oder aber ein Kenntnisstand vorausgesetzt wird, den man sich auch durch das Lesen anderer Wikipedia-Artikel nicht erarbeiten kann. Analog trifft das aber auf einen Großteil der Artikel zu, schließlich kann man nicht in jeder Biografie die politische Lage zu einem gewissen Zeitpunkt referieren und muss voraussetzen, dass der Leser beispielsweise weiß, wodurch die 1920er Jahre in Europa geprägt waren. Schwierig wird es natürlich dort, wo es um Kulturkreise und Regionen geht, die den meisten deutschsprachigen Lesern wenig vertraut sind (z.B. China in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts). Dort überall scheitert das „Konzept Universalenzyklopädie“ als Lehrbuch und Lernmittel.--Cirdan ± 12:10, 6. Dez. 2015 (CET)
- Information, Bildung, Aufklärung: Wikipedia ist ein Medium, das immer auch dazu anhalten sollte, sich des eigenen Verstandes zu bedienen. -- Barnos (Post) 12:34, 6. Dez. 2015 (CET)
- Das ist schon so, wir sind das Ziel, nicht der Startpunkt. Wir können die Leute nicht abholen, da kann in der Regel übrigens auch ein Lehrbuch nicht. Das aneignen von Wissen geschieht immer individuell, und braucht höchstens Anleitung, die duch eine einer Lehrperson geschehen kann. Dazu kommt, wir sind auch keine Kinder- oder Jugendenzyklopädie, wo mit einem beschränktem Wortschatz gearbeitet werden muss. Man kann es niemals allen Recht machen. Man kann nicht bei allen Themen die fachlich korrekten Begriffe verwenden, und zugleich für ein Grundschüler (Oder sonst jemand mit noch beschränktem Wortschatz) verständlich schrieben. Das geht schlichtweg nicht, da der Grundschüler die Fachbergiffe zuerst erlernen muss. Wenn ich alle Fachbegriffe in jedem Fachartikel erkläre, macht das diese Artikel kaum besser, sondern er wird langathmig. Wenn ich englisch von Gund auf erlernen will, lese ich sicher nicht als erstes Macbeth oder sonst ein literarisches Werk auf englisch, sondern fange auch mit Alltagssätzen an. Erlerne die Begrüssungsfloskeln, fange an über das Wetter, Familie usw. zu reden. Das ist auch in der Schule nicht anders. Der Ansatz einer Lehrnhilfe ist ein ganz anderer als bei einem enzyklopädie Artikel. Die Lehrnhilfe muss sich klar begrenzen und auch ein Weg vorgeben, auf dem sich dann aufbaut. --Bobo11 (Diskussion) 12:52, 6. Dez. 2015 (CET)
- Eine erfolgreiche Methode der Wissensvermittlung scheint das Auswendiglernen zu sein, was z.B. durch Wiederholen ermöglicht wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man den Wissensstand eines Lesers mit Fragen ermitteln und damit die Lernschritte planen kann. Leider kann ein WP-Artikel nicht mit dem Leser kommunizieren und auch den Artikel an den Leser anpassen geht nicht. Im Video schlug der eine Prof vor die Wikipedia als Steinbruch des Wissens zu nutzen, was aber kaum in unserem Interesse sein könnte. Irgendwie scheint mir die Situation unbefriedigend zu sein. Goldzahn (Diskussion) 15:37, 6. Dez. 2015 (CET)
- @Goldzahn: Warum möchtest du nicht, dass wir ein „Steinbruch des Wissens“ sind? Wenn wir hier das Wissen der MenschheitTM sammeln, können wir kaum erwarten, dass ein einzelner Mensch mehr als Bruchstücke davon liest. Auch Artikel werden häufig nicht von Anfang bis zum Ende linear gelesen, sondern man springt direkt zu dem Abschnitt oder Absatz, in dem die gesuchten Informationen zu finden sind und klickt sich dann mit Links weiter. Trotzdem ist es nicht falsch, einen Wikipedia-Artikel als ein Ganzes zu denken: Nur in einem gut gegliederten Artikel (wie in einem gut gegliederten Buch) kann sich der Leser schnell zurechtfinden und es ermöglicht den Autoren, zu überprüfen, ob eine umfassende und vollständige Darstellung gelungen ist.--Cirdan ± 19:51, 6. Dez. 2015 (CET)
- Eine erfolgreiche Methode der Wissensvermittlung scheint das Auswendiglernen zu sein, was z.B. durch Wiederholen ermöglicht wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man den Wissensstand eines Lesers mit Fragen ermitteln und damit die Lernschritte planen kann. Leider kann ein WP-Artikel nicht mit dem Leser kommunizieren und auch den Artikel an den Leser anpassen geht nicht. Im Video schlug der eine Prof vor die Wikipedia als Steinbruch des Wissens zu nutzen, was aber kaum in unserem Interesse sein könnte. Irgendwie scheint mir die Situation unbefriedigend zu sein. Goldzahn (Diskussion) 15:37, 6. Dez. 2015 (CET)
- Das ist schon so, wir sind das Ziel, nicht der Startpunkt. Wir können die Leute nicht abholen, da kann in der Regel übrigens auch ein Lehrbuch nicht. Das aneignen von Wissen geschieht immer individuell, und braucht höchstens Anleitung, die duch eine einer Lehrperson geschehen kann. Dazu kommt, wir sind auch keine Kinder- oder Jugendenzyklopädie, wo mit einem beschränktem Wortschatz gearbeitet werden muss. Man kann es niemals allen Recht machen. Man kann nicht bei allen Themen die fachlich korrekten Begriffe verwenden, und zugleich für ein Grundschüler (Oder sonst jemand mit noch beschränktem Wortschatz) verständlich schrieben. Das geht schlichtweg nicht, da der Grundschüler die Fachbergiffe zuerst erlernen muss. Wenn ich alle Fachbegriffe in jedem Fachartikel erkläre, macht das diese Artikel kaum besser, sondern er wird langathmig. Wenn ich englisch von Gund auf erlernen will, lese ich sicher nicht als erstes Macbeth oder sonst ein literarisches Werk auf englisch, sondern fange auch mit Alltagssätzen an. Erlerne die Begrüssungsfloskeln, fange an über das Wetter, Familie usw. zu reden. Das ist auch in der Schule nicht anders. Der Ansatz einer Lehrnhilfe ist ein ganz anderer als bei einem enzyklopädie Artikel. Die Lehrnhilfe muss sich klar begrenzen und auch ein Weg vorgeben, auf dem sich dann aufbaut. --Bobo11 (Diskussion) 12:52, 6. Dez. 2015 (CET)
- Information, Bildung, Aufklärung: Wikipedia ist ein Medium, das immer auch dazu anhalten sollte, sich des eigenen Verstandes zu bedienen. -- Barnos (Post) 12:34, 6. Dez. 2015 (CET)
- Warte mal das dritte Video ab, da realtiviert sich das mit dem Lehrmittel. Marcus Cyron Reden 15:12, 6. Dez. 2015 (CET)
Zum Lernen war / ist doch wohl Wikiversity gedacht. --tsor (Diskussion) 15:44, 6. Dez. 2015 (CET)
- Nunja, lernen kann man ja auf mehr als nur eine Art. Marcus Cyron Reden 17:47, 6. Dez. 2015 (CET)
@cirduan: Ich kann nicht sehen warum WP im Falle der Mandschu-Dynastie (mehr) scheitern sollte als in den anderen Fällen. Ich habe manchmal den Eindruck diverse Außenstehende treten an WP mit den Vorstellungen einer eierlegenden Wollmilchsau heran. WP soll auf einmal diverse Dinge leisten, die man meist nie von einer traditionellen Enzyklopädie erwartet hätte.
Generell stellt bei den Lehrmitteln immer Frage Lehrmittel für was genau. Natürlich kann WP immer als Lehrmittel verwenden, selbst wenn man es nur Beispiel nimmt, wie man es nicht macht oder auch im Sinne eines Wissenssteinbruchs. Man kann es natürlich nicht einfach Lehrbuch oder gar Unterrichtsersatz betrachten.
Außerdem sollte man bei den Vorträgen und Schlüssen darauf achten, dass sie offenbar überwiegend oder auch nur aus der Sicht der Geschichtsdidaktik erfolgen und sich keinesfalls so einfach auf Wikipedia als Lernmittel in anderen Bereichen verallgemeinern lassen. Im Bereich Mathematik und Informatik wird insbesondere im universitären Bereich teilweise recht ausgiebig auf WP zurückgegriffen (sofern einigermaßen vertretbarer Eintrag existiert) und WP-Inhalte gerne für Hintergrundinformationen verlinkt.
Generell kann ich in Bezug auf die oben erwähnte "unbefriedigende Situation" nur sagen, dass ich Tsors Verweis auf Wikiversity vollkommen zu stimme. WP ist ein Enzyklopädieprojekt und kein Lehrmittelprojekt, es nicht Wikiversity und eierlegende Wollmilchsau für Didaktiker. Natürlich spricht nicht dagegen nichts, dass externe WP als Lehrmittel verwenden bzw. verwenden wollen, nur wie sie sie WP dort einsetzen oder einbinden ist ein Problem bzw. Aufgabe der Lehrenden und nicht von WP. Natürlich kann man die ein oder andere Anregung eventuell aufgreifen, aber wir können nicht die grundsätzliche Projektausrichtung verändern.--Kmhkmh (Diskussion) 19:29, 6. Dez. 2015 (CET)
- @Kmhkmh: Volle Zustimmung zu deinen Ausführungen! Wikipedia scheitert nicht als Enzyklopädie, aber sie scheitert als (einführendes) Lehrbuch – was sie aber, wie du auch schreibst, gar nicht sein möchte. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es (jedenfalls aus meiner Sicht) wenig überraschend ist, dass sich eine Universalenzyklopädie, die in vielen Themenbereichen notgedrungen eher eine Fachenzyklopädie ist (warum, habe ich oben beschrieben), sich nur schlecht als Lehr- und Lernmittel eignet.--Cirdan ± 19:44, 6. Dez. 2015 (CET)
- Wikiversity kann man vergessen. Es ist auch eins dieser völlig gescheiterten Wikimediaprojekte, die mal groß anfingen und nun in Vergessenheit geraten sind. --Schlesinger schreib! 19:48, 6. Dez. 2015 (CET)
- Ich vermute die Leute kommen zu Wikipedia, weil sie glauben hier etwas lernen zu können. Der Brockhaus jedenfalls war noch zu Lebzeiten tot. Meine Eltern hatten so ein mehrbändiges Ding irgendwann mal gekauft und ich habe wohl keine zehn mal da rein gesehen. Aber ehrlich gesagt nutze ich selber Wikipedia auch nur als Steinbruch des Wissens, so wie ich andere in Bing gefundene Webseiten auch nutze. Für Schüler wäre Wikipedia heute dann ähnlich interessant wie der Brockhaus für mich damals. Anders sieht es dagegen für Autoren aus, vielleicht ist Wikipedia aus dieser Sicht positiver zu sehen? Erinnert sich noch jemand an Lernen durch Lehren (Jean-Pol Martin)? Die Berichte nach denen Wikipedia in akademischen Schreibkursen erfolgreich genutzt wird, klingen ja ganz anders als das was die Geschichtsdidaktiker im Video berichteten. Vielleicht macht WP nur für Prosumer Sinn, was Schüler heute wegen des weitgehenden Ausbaus nicht mehr sein können, anders als vor zehn Jahren. --Goldzahn (Diskussion) 22:07, 6. Dez. 2015 (CET)
- Wikiversity kann man vergessen. Es ist auch eins dieser völlig gescheiterten Wikimediaprojekte, die mal groß anfingen und nun in Vergessenheit geraten sind. --Schlesinger schreib! 19:48, 6. Dez. 2015 (CET)
@Goldzahn: "Ich habe mir schon manchmal die Frage gestellt, wie ein Wikipedia-Artikel aussehen müsste, damit er als Lehrmittel besser taugt" - ist das nicht die falsche Frage? Das falsche Projekt? Die Wikipedia will doch eine Universalenzyklopädie sein, kein Lehrbuch, wie andere schon angesprochen haben. Auch die hervorragendsten ausführlichen Artikel aus der Macropædia der Encyclopædia Britannica würden sich zu diesem Zweck weniger anbieten. @Marcus Cyron: "selten habe ich so viel über U-Boote erfahren wie hier" - diese oder jene U-Boote? ;-) Gestumblindi 22:13, 6. Dez. 2015 (CET)
- Quantitative Vergleiche über deutsche U-Boote im 2. Weltkrieg. Marcus Cyron Reden 23:14, 6. Dez. 2015 (CET)
- Ich hatte hier ein Erlebnis gehabt, als auf der Disk eines von mir geschriebenen Artikels wohl ein Schüler verzweifelt um Hilfe nachfragte. Ich recherchierte damals und musste den großen Unterschied zwischen meinem Artikel und dem was im Netz sonst darüber zu finden war, erkennen. Das war so ähnlich wie beim Verhältnis zwischen der Quantentheorie und dem Bohrschen Atommodell. Ich gab ihm damals einen Link zu einer Webseite, die das alles ganz vernünftig aber sehr einfach erklärte.
- Ich glaube Wikipedia wurde im Bildungsbereich von der Foundation aus US-steuerlichen Gründen positioniert. Bin da aber nicht sicher. Eigentlich entstand WP nämlich als Fanprojekt von Jimmy Wales, der die Britannica sehr liebte. Ich erinnere mich auch an Bildungsgeschichten aus dem englischsprachigen Raum, wonach Leute ohne Bildung jeden Tag einen Lexikonartikel lesen, um sich weiter zu bilden. In diesem Sinne ist ein Lexikon sehr wohl ein Lehrbuch, aber vielleicht ein wenig wirksames. Und dann ist da noch der Ansatz, dass vorgekautes Wissen keine Herausforderung und damit kein Lernanreiz ist. Geht ja auch niemand freiwillig zur Schule, die bekanntlich den Lernwillen zerstört.
- Aber egal, das Thema ist eh nur ein Sonntagsthema. --Goldzahn (Diskussion) 22:43, 6. Dez. 2015 (CET)
- Ich finde, dass Wikipedia ein sehr gutes Lehrmittel ist - für mich selbst als Autorin. --
 Nicola - Ming Klaaf 22:46, 6. Dez. 2015 (CET)
Nicola - Ming Klaaf 22:46, 6. Dez. 2015 (CET) - Eigentlich entstand WP nämlich als Fanprojekt von Jimmy Wales, der die Britannica sehr liebte. - das ist aber eine interessante neue Erkenntnis, die die Geschichte der Wikipedia auf ganz neue Füße stellt ;). Marcus Cyron Reden 23:17, 6. Dez. 2015 (CET)
- Man kann WP natürlich wie auch jedes andere Lexikon als Lehrbuch verwenden, wenn man es unbedingt möchte [ein berühmter Fall aus der Wissenschaftgeschichte, der mal sowas ähnliches gemacht hat ist übrigens S. Ramanujan). Das ändert aber nichts daran das WP primär nicht als Lehrbuch oder Lehrmittel konzipiert ist und in diesem Sinne auch erst einmal keines sein will.--Kmhkmh (Diskussion) 23:57, 6. Dez. 2015 (CET)
- en:Encyclopædia Britannica#Reputation --Goldzahn (Diskussion) 07:07, 7. Dez. 2015 (CET)
- ??? Marcus Cyron Reden 14:46, 7. Dez. 2015 (CET)
- Das sind historische Beispiele für Weiterbildung durch Lesen von Lexika. Wobei ich mir vorstellen kann, dass das Ziel damals keine akademische Bildung war. Zum Thema "Konversationslexika" findet sich in der de.WP folgendes: "Es behandelte zeitgenössische Themen über Politik und Gesellschaft, um eine gebildete Unterhaltung in einer sozial durchaus gemischten Gruppe zu ermöglichen" "Es" war ein 1808 von Brockhaus aufgekauftes Konversationslexikon. Keine Ahnung, vielleicht war damit gemeint in einem literarischen Salon zu jedem Thema etwas beitragen zu können. Eines der Stärken der WP ist das schnelle Verfügbarmachen von Hintergrundinformationen zu aktuellen Ereignissen. Im Grunde eine Hilfestellung für die Allgemeinheit in der globalisierten Welt. Das letzte das ich in der WP nachgeschlagen habe, war Info zur Allgemeinen Relativitätstheorie zum 100jährigen einzusehen. Nicht das ich die Theorie jetzt verstanden hätte, aber etwas mehr als zuvor weiß ich schon. So kenne ich jetzt den Begriff Mannigfaltigkeit (auch wenn ich nicht wirklich weiß was das ist). Schöner wäre es allerdings schon, wenn ich nach dem Lesen des Textes ein Schwarzes Loch berechnen könnte. Vielleicht lässt sich der Begriff Bildung für die WP retten, wenn man Bildung nicht nur als akademische Bildung versteht, wobei das Beispiel mit der AR zeigt, dass die durch das Lesen von WP.Artikeln erreichte Weiterbildung wohl oft unter dem maximal Möglichen bleibt. PS: Das zweite Panel ist publiziert. --Goldzahn (Diskussion) 18:52, 7. Dez. 2015 (CET)
- Allerdings ist WP ja eben kein klassisches Konversationslexikon. Und auch Jimbo Wales hatte am Ende nur begrenzt Einfluss auf die Form dieses neuartigen Lexikons. Was eben gerade die Geschichte unserer Enzyklopädie zeigt. Wikipedia war nun mal das "Abfallprodukt", daß einen toten Vorgänger obsolet machte - dier wiederum, da hast du absolut recht, so etwas wie eine neue Britannica online war. Oder besser: werden sollte, aber nie wurde. Denn das Konzept taugte nur bedingt, war für das Internet-Zeitalter zu begrenzt. Marcus Cyron Reden 13:52, 9. Dez. 2015 (CET)
- Ich hatte mich mal durch die alten Mailingarchive der Wikipedia-Vorgänger geklickt, weil ich meinte, dass der interne Geschichtsartikel zur Wikipedia verbessert werden sollte. Es ist wirklich überraschend wie wenig Kontrolle Wales und Sänger über die Entwicklung hatten. Ich glaube es war ein Verdienst von Wales, dass er das gegen den Willen von Sänger so durchsetzte. Das Ergebnis war, dass die Wikipedia ein wirklich zeitgemäßes Produkt wurde. Allerdings auch schon etwa 15 Jahre alt. Ich habe gerade nachgesehen, tatsächlich sind es am 15. Januar 2016 genau 15 Jahre nach Gründung der enWP. Bei der deWP soll es am 16. März so weit sein. Bin mal gespannt, ob da irgend etwas gemacht wird. --Goldzahn (Diskussion) 19:10, 9. Dez. 2015 (CET)
- Wales' Verdienste in den ersten Jahren kann man schwerlich zu tief ansetzen. Es waren seine geschickte Politik, seine Werbetouren und zu Beginn auch sein Geld, die das alles am Laufen und ins Rollen brachten. Aber irgendwann war das so groß - größer als ein kleiner Mensch - nämlich wirklich eine Bewegung. Da hätte er Platz machen sollen, dann wäre er heute Gottgleich (in diesem Projekt). Leider konnte er nicht los lassen und nun sieht man eben auch immer wieder Kratzer im Lack. Obwohl man sagen kann, daß er zuletzt wieder souveräner ist. Wahrscheinlich, weil er sich meist eher zurück hält. Marcus Cyron Reden 00:07, 10. Dez. 2015 (CET)
- Selbstverständlich wird da nichts gemacht. Es gibt keinen Ausschuß, keinen Arbeitskreis und kein Budget. Die Zeiten, als man noch runde Geburtstage gefeiert hätte, sind lange vorbei. Fünf Jahre ist das schon her. Kinder, wie die Zeit vergeht! :) --Aschmidt (Diskussion) 19:29, 9. Dez. 2015 (CET)
- Wikipedia:10 Jahre Wikipedia --Goldzahn (Diskussion) 19:41, 9. Dez. 2015 (CET)
- Ja, früher™, da hatten wir auch einen Kaiser! :) --Aschmidt (Diskussion) 20:01, 9. Dez. 2015 (CET)
- Wikipedia:10 Jahre Wikipedia --Goldzahn (Diskussion) 19:41, 9. Dez. 2015 (CET)
- Ich hatte mich mal durch die alten Mailingarchive der Wikipedia-Vorgänger geklickt, weil ich meinte, dass der interne Geschichtsartikel zur Wikipedia verbessert werden sollte. Es ist wirklich überraschend wie wenig Kontrolle Wales und Sänger über die Entwicklung hatten. Ich glaube es war ein Verdienst von Wales, dass er das gegen den Willen von Sänger so durchsetzte. Das Ergebnis war, dass die Wikipedia ein wirklich zeitgemäßes Produkt wurde. Allerdings auch schon etwa 15 Jahre alt. Ich habe gerade nachgesehen, tatsächlich sind es am 15. Januar 2016 genau 15 Jahre nach Gründung der enWP. Bei der deWP soll es am 16. März so weit sein. Bin mal gespannt, ob da irgend etwas gemacht wird. --Goldzahn (Diskussion) 19:10, 9. Dez. 2015 (CET)
- Allerdings ist WP ja eben kein klassisches Konversationslexikon. Und auch Jimbo Wales hatte am Ende nur begrenzt Einfluss auf die Form dieses neuartigen Lexikons. Was eben gerade die Geschichte unserer Enzyklopädie zeigt. Wikipedia war nun mal das "Abfallprodukt", daß einen toten Vorgänger obsolet machte - dier wiederum, da hast du absolut recht, so etwas wie eine neue Britannica online war. Oder besser: werden sollte, aber nie wurde. Denn das Konzept taugte nur bedingt, war für das Internet-Zeitalter zu begrenzt. Marcus Cyron Reden 13:52, 9. Dez. 2015 (CET)
- Das sind historische Beispiele für Weiterbildung durch Lesen von Lexika. Wobei ich mir vorstellen kann, dass das Ziel damals keine akademische Bildung war. Zum Thema "Konversationslexika" findet sich in der de.WP folgendes: "Es behandelte zeitgenössische Themen über Politik und Gesellschaft, um eine gebildete Unterhaltung in einer sozial durchaus gemischten Gruppe zu ermöglichen" "Es" war ein 1808 von Brockhaus aufgekauftes Konversationslexikon. Keine Ahnung, vielleicht war damit gemeint in einem literarischen Salon zu jedem Thema etwas beitragen zu können. Eines der Stärken der WP ist das schnelle Verfügbarmachen von Hintergrundinformationen zu aktuellen Ereignissen. Im Grunde eine Hilfestellung für die Allgemeinheit in der globalisierten Welt. Das letzte das ich in der WP nachgeschlagen habe, war Info zur Allgemeinen Relativitätstheorie zum 100jährigen einzusehen. Nicht das ich die Theorie jetzt verstanden hätte, aber etwas mehr als zuvor weiß ich schon. So kenne ich jetzt den Begriff Mannigfaltigkeit (auch wenn ich nicht wirklich weiß was das ist). Schöner wäre es allerdings schon, wenn ich nach dem Lesen des Textes ein Schwarzes Loch berechnen könnte. Vielleicht lässt sich der Begriff Bildung für die WP retten, wenn man Bildung nicht nur als akademische Bildung versteht, wobei das Beispiel mit der AR zeigt, dass die durch das Lesen von WP.Artikeln erreichte Weiterbildung wohl oft unter dem maximal Möglichen bleibt. PS: Das zweite Panel ist publiziert. --Goldzahn (Diskussion) 18:52, 7. Dez. 2015 (CET)
- ??? Marcus Cyron Reden 14:46, 7. Dez. 2015 (CET)
- en:Encyclopædia Britannica#Reputation --Goldzahn (Diskussion) 07:07, 7. Dez. 2015 (CET)
- Ich finde, dass Wikipedia ein sehr gutes Lehrmittel ist - für mich selbst als Autorin. --
Bundestagsprojekt trägt Früchte?
Donnerwetter. Und das Ergebnis ist der allseits beliebte Nacktkalender etwa à la Pirelli? Interessant. Nur fehlt leider immer noch ein aussagekräfiges Foto des SPD-Abgeordneten Jakob Maria Mierscheid. --Schlesinger schreib! 13:29, 6. Dez. 2015 (CET) :-)
Das ist doch kein korrektes Deutsch: [2] ! --2A02:810D:1180:108:D8C6:D443:2851:ECC5 17:30, 6. Dez. 2015 (CET)
- Doch! "Von" ist eine Präposition, die stets den Dativ verlangt. Drei von fünf Leuten haben damit allerdings Probleme damit ;-) Alternativ könnte man auch sagen: "Zehn Kalenderblätter von zwölfen..." --Uwe Rohwedder (Diskussion) 17:47, 6. Dez. 2015 (CET)
- Danke, Uwe!--Cirdan ± 18:38, 6. Dez. 2015 (CET)
Und ein Großteil der Bilder stammt nicht vom Bundestagsprojekt, sondern von Landtagsprojekten oder anderen Fotoaktionen. Grüße, —DerHexer (Disk., Bew.) 18:14, 6. Dez. 2015 (CET)
Lizenzprobleme im Postillon
Ob die sich beim Postillion bewusst sind, dass sie mit diesem Montagen diesmal lizenzrechtlich ganz schön daneben gelangt haben?! Schließlich haben die CC-Photos alle samt eine SA-Lizenz (= same attribution = Veröffentlichung von Bearbeitungen unter denselben Bedingungen). Neben der (beim Postillion glücklicherweise) üblichen Nennung von Urheber und Lizenz sind sie daher eigentlich verpflichtet, ihre Bearbeitungen ebenfalls unter CC-BY-SA zu veröffentlichen. Da sie für diese Montage aber nicht nur Bilder mit kompatiblen Lizenzen sondern auch Fotolia-Stockphotos verwendet haben, deren proprietäre Lizenz ein CC-Veröffentlichung nicht hergibt, haben sie jetzt eigentlich ein Problem... //Martin K. (Diskussion) 22:23, 6. Dez. 2015 (CET)
- Naja, man könnte es als Collage betrachten. Zwar wäre es unmöglich die Collage am Ende unter eine Freie Lizenz zu stellen (wg. den unfreien Stockphotos) aber anddersrum (Freie Werke im unfreien Endwerk) könnte es gehen. --DaB. (Diskussion) 23:14, 6. Dez. 2015 (CET)
- @DaB.: Ne, sorry, das siehst Du falsch: Auch eine Collage wäre ein neues abgeleites Werk und muss als solches unter einer kompatiblen Lizenz veröffentlicht werden, wenn dafür ein Werk auf Basis von CC-SA-Lizenz verwendet wurde. Genau dieser Ansteckungseffekt und die damit verbundene virale Verbreitung der Freien Lizenzen ist ja das Grundprinzip von Copyleft. Nur bei Sammelwerken (also einer Zusammenstellung von Werken ohne Verschmelzung oder Bearbeitung) ist das nicht nötig, weil die Einzelteile ja wieder von einander gelöst und getrennt weiter genutzt werden könnten. // Martin K. (Diskussion) 23:37, 6. Dez. 2015 (CET)
- Das ist soweit ich weiß eher eine offene bzw. Einzelfall-Frage, die erst einmal gar nichts mit freien Lizenzen zu tun hat. Es geht nämlich darum, ob man eine Collage als eigenständiges Kunstwerke ansieht, die als Rohmaterial bis zu einem gewissen Grad urheberechtlich geschützte Werke verwenden dürfen (Stichwort: künstlerisches Zitaterecht).--Kmhkmh (Diskussion) 23:47, 6. Dez. 2015 (CET)
- @Martin Kraft:, mm, da lese ich die de-3.0-CC-Lizenz anders als du. Deren Definition eines Sammelwerkes trifft mMn. auf eine Collage zu: „unabhängig davon, ob […] einzeln zugänglich sind oder nicht.“ Interessanterweise ist die unported-Version da deutlich näher an deiner Definition.
- Viral ist bei den CC-Lizenzen auch nur die Bearbeitung des Werkes. Im Extremfall könnte ich ein CC-Bild unverändert in eine Collage übernehmen – dann gäbe es gar keine Bearbeitung. Die Frage ist nun, welche Veränderungen man vornehmen muss, damit aus einer Collage aus 2 (oder mehr) Einzelwerken ein neues, einzelnes Werk wird. Und ab wann man nur die Änderungen am CC-Bild wieder freigeben muss, und ab wann man das ganze Werk freigeben muss.
- Doof ist es aber auf jeden Fall ;-). --DaB. (Diskussion) 23:57, 6. Dez. 2015 (CET)
- Das ist soweit ich weiß eher eine offene bzw. Einzelfall-Frage, die erst einmal gar nichts mit freien Lizenzen zu tun hat. Es geht nämlich darum, ob man eine Collage als eigenständiges Kunstwerke ansieht, die als Rohmaterial bis zu einem gewissen Grad urheberechtlich geschützte Werke verwenden dürfen (Stichwort: künstlerisches Zitaterecht).--Kmhkmh (Diskussion) 23:47, 6. Dez. 2015 (CET)
- @DaB.: Ne, sorry, das siehst Du falsch: Auch eine Collage wäre ein neues abgeleites Werk und muss als solches unter einer kompatiblen Lizenz veröffentlicht werden, wenn dafür ein Werk auf Basis von CC-SA-Lizenz verwendet wurde. Genau dieser Ansteckungseffekt und die damit verbundene virale Verbreitung der Freien Lizenzen ist ja das Grundprinzip von Copyleft. Nur bei Sammelwerken (also einer Zusammenstellung von Werken ohne Verschmelzung oder Bearbeitung) ist das nicht nötig, weil die Einzelteile ja wieder von einander gelöst und getrennt weiter genutzt werden könnten. // Martin K. (Diskussion) 23:37, 6. Dez. 2015 (CET)
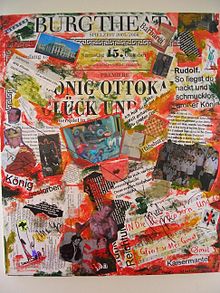
- Dem muss ich erneut widersprechen:
- Ein Sammelwerk ist ein von der Rechtsprechung klar definierter Begriff, der eine Montage, wie sie der Postillion hier vornimmt, nicht umfasst. Das hier ist ein abgeleitetes Werk!
- Du scheinst etwas anderes unter Collage zu verstehen, als die Kunstgeschichte. Eine Collage besteht nicht einfach aus ein paar Bildern die nebeneinander auf eine Blatt geklebt wurden, sondern aus deren Verbindung zu einem neuen Werk.
- Hinzukommt, dass allein das Freistellen des Kopfes schon eine Bearbeitung darstellt, die laut Lizenztext als solche gekennzeichnet müsste. Es gibt sogar Kommentatoren, die der Meinung sind, dass reicht das Beschneiden des Werkes so eine kennzeichnungspflichtge Bearbeitung ist.
- Wenn das, was der Postillion da macht, keine SA-pflichtige Bearbeitung bzw. Ableitung wäre, könnte man das mit dem SA auch direkt sein lassen, weil es dann eh keinerlei Ansteckungseffekt mehr gäbe. // Martin K. (Diskussion) 00:27, 7. Dez. 2015 (CET)
- Nur sprechen wir hier nicht vom „Sammelwerk“ im Gesetzlichem Sinne, sondern von dem Wort „Sammelwerk“ im Kontext der CC-Lizenzen. Und da ist es eben leicht anders definiert.
- Eine Collage ist eine Zusammenstellung von Einzelwerken in einen Context. Das kann so komplex wie das nebenstehende Bild sein, das kann aber auch so primitiv wie die berühmten Suppendosen von Warhold sein.
- Du bringst hier etwas durcheinander: Natürlich ist das Freistellen eine Veränderung an dem CC-Werk und daher ist diese Änderung wieder frei. Das bedeutet aber noch nicht automatisch, dass das bloße Einbinden dieses veränderten Werkes in eine Collage diese Collage auch frei gibt. Das „SA“ bedeutet: Alles, was du an diesem Bild veränderst, ist auch wieder frei; nicht: Alles, was das Bild berührt, ist auch frei.
- Bitte beachte auch, dass die Rechtslage rund um Collagen an sich (also ganz unabhängig von CC-Lizenzen) noch nicht endgültig geklärt ist. Bei der nebenstehenden Collage wurden wahrscheinlich auch nicht alle Text-Urheber um Erlaubnis gefragt – trotzdem ist es vermutlich keine URV. --DaB. (Diskussion) 03:15, 7. Dez. 2015 (CET)
- Dem muss ich erneut widersprechen:
- Entschuldige, aber Du konstruierst Dir da was zusammen, was so einfach nicht stimmt:
- Da eine Lizenz in erster Linie ein juristischer Text ist, ist es Unsinn so zu tun, als sei dort mit „Sammelwerk“ etwas anderes gemeint, als das, was sonst in der Rechtsprechung üblicherweise als „Sammelwerk“ bezeichnet wird.
- Außerdem ist die Definition im Lizenztext weitestgehend deckungsgleich mit der dechtlichen:
- Entschuldige, aber Du konstruierst Dir da was zusammen, was so einfach nicht stimmt:
„Der Begriff "Sammelwerk" im Sinne dieser Lizenz meint eine Zusammenstellung von literarischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Inhalten, sofern diese Zusammenstellung aufgrund von Auswahl und Anordnung der darin enthaltenen selbständigen Elemente eine geistige Schöpfung darstellt, unabhängig davon, ob die Elemente systematisch oder methodisch angelegt und dadurch einzeln zugänglich sind oder nicht.“
- Die Wikipedia z.B. ist so einen Zusammenstellung aus selbstständigen Werken (also Bilder und Texten), die Montage des Postillion definitiv nicht. Die in ihr enthalten Elemente sind nicht mehr selbstständig sondern Teil eines neue Ganzen. Es handelt sich also um ein neues auf anderen Werken basierendes abgeleitetes Werk.
- Die jeweils aus einen frei lizenzierten Portrait und einem Stockphoto zusammengebastelten Kalenderbilder des Positillion sind auch keine Collagen (weder im künstlerischen, noch Photo-Software-Sinn), sondern ganz klassische Photomontagen und als solche eindeutig Bearbeitungen der zu Grunde liegenden Werke.
- Es ist auch Blödsinn so zu tun, als wäre dem SA genüge getan, wenn man müsste dass da irgendwo ein freies Werk drin sei, das man sich dann (wie auch immer) wieder rausextrahieren könne. Der Ansteckungseffekt der SA-Lizenzen beruht ja gerade darauf, dass nicht nur das frie bleibt, was es eh schon ist (das ist auch bei CC-BY und sogar bei CC-0 der Fall), sondern dass auch das was bei einem neuen Werk hinzukommt ebenfalls unter einer freien Lizenz veröffentlich werden muss.
- Und genau hier liegt beim Postillion das Problem:
- Entweder verstoßen sie gegen CC-BY-SA, weil sie ihre Montage nicht ebenfalls unter einer freien Lizenz veröffentlichen.
- Oder sie verstoßen gegen die proprietäre Fotolia-Lizenz, die genau so eine CC-Veröffentlichung nicht umfasst.
- So, oder so begehen die mit dieser Montage eine Urheberrechtsverletzung. Wenn die SA-Klausel nicht eingehalten wird, verfällt schließlich die gesamte CC-Lizenz. Und da z.Z. keine Lizenz für das Gesamtwerk erkennbar ist, sind die Geschädigten aktuell die Wikipedianer.
- P.S.: Falls Du mir das nicht glaubst, können wir ja gerne mal einen unserer Juristen @Pajz, Gnom: um eine dritte Meinung bitten.
- P.P.S.: Auch Andy Warhol Campbell's Soup Cans bezeichnet man üblicherweise nicht als Collage, weil sie ja nicht einfach aus den Suppenetiketten zusammengeklebt wurden. Das ist eine Serie von Siebdrucken, die er auf Basis eines vorhandenen Produkts selbst entworfen hat. Ein Werk, dass andere Werke verarbeitet nennt man abgeleites Werk. Als Collage bezeichnet man üblicherweise nur solche Kunstwerke, die tatsächlich aus Fragmenten anderer Werke und Materialien zusammengeklebt wurden. // Martin K. (Diskussion) 10:58, 7. Dez. 2015 (CET)
- Martin, ich hatte die Passage aus der Lizenz oben zitiert (danke, dass du es jetzt nochmal gemacht hast). Und da steht eben, dass ein Sammelwerk auch etwas ist was NICHT EINZELN zugänglich ist! Daher kann auch eine Collage (ein Werk, dass aus mehreren Einzelwerken besteht) ein Sammelwerk im Sinne der Lizenz sein.
- Außerdem schreib ich auch schon, dass hier zusätzlich zur CC-Lizenz auch noch die Rechtsprechung zu Collagen an sich zu berücksichtigen ist. Und bei der ist es recht egal, ob die Teilwerke unter einer Freien Lizenz stehen oder nicht.
- Und nein, eine SA-Klausel ist nicht so ansteckend wie du es darstellst. So ist z.B. ein Buch nicht deswegen frei, weil irgendwo ein CC-Bild drin ist. Das gleiche für einen Film, der ein CC-Bild hat. Nur ABLEITUNGEN von einem Bild sind auch wieder frei. Sinn und Zweck des SA-Teils ist es, dass ein Werk frei bleibt, wenn man es verändert; nicht, dass mehr frei wird. Es gibt Lizenzen (z.B. die GPL) die diesen Effekt haben, aber bei den normalen CC-Lizenzen nicht der Fall (und bei der CC0 erst recht nicht).
- Um es auch noch mal zu sagen: Ich behaupte nicht, das meine Ansicht die alleinige Wahrheit ist (die wird eh nur ein Gericht klären können). Aber so absolut wie du es behauptest, ist dein Standpunkt auch nicht richtig. --DaB. (Diskussion) 12:47, 7. Dez. 2015 (CET)

- Du verstehst offensichtlich immer noch nicht den unterschied zwischen einem Sammelwerk und einen abgeleiteten Werk!
- Ein Buch, das CC-Abbildungen enthält, ist ein Sammelwerk, weil es in sich einzelne Werke zusammengestellt sind, die trotzdem noch für sich selbständig und als einzelnen Werk erkennbar sind. Wenn Du jemandem so ein Buch (oder einen Wikipediaartikel) vorlegst und ihn fragst wieviele Werke dieses enthält, wird er anfangen die einzelnen Bilder und Texte zu zählen...
- Bei der Photomontage des Postillions ist das nicht der Fall, weil die zu Grunde liegenden Werke so bearbeitet wurden, dass ein neues in sich eigenständiges abgeleitetes Werk entstand. Wenn Du jemandem bei dieser Montage nach der Anzahl der vorhanden Werke fragst, wird er ganz sicher nicht auf die Idee kommen dieses Bild in seine Einzelbestandteile zu zerlegen.
- Du verstehst offensichtlich immer noch nicht den unterschied zwischen einem Sammelwerk und einen abgeleiteten Werk!
„Der Begriff "Abwandlung" im Sinne dieser Lizenz bezeichnet das Ergebnis jeglicher Art von Veränderung des Schutzgegenstandes, solange die eigenpersönlichen Züge des Schutzgegenstandes darin nicht verblassen und daran eigene Schutzrechte entstehen. Das kann insbesondere eine Bearbeitung, Umgestaltung, Änderung, Anpassung, Übersetzung oder Heranziehung des Schutzgegenstandes zur Vertonung von Laufbildern sein. Nicht als Abwandlung des Schutzgegenstandes gelten seine Aufnahme in eine Sammlung oder ein Sammelwerk und die freie Benutzung des Schutzgegenstandes.“
- Daher nochmal: Wenn die SA-regelung tatsächlich so wirkungslos wäre, wie Du behauptest, wäre diese Klausel völlig überflüssig, weil auch CC-BY den Nachnutzer zwing, die Attribution für den freien Werkteil beizubehalten. Der ganze Sinn und Zweck der SA-Klausel besteht darin, denn Nachnutzer dazuzuwingen, selbst eine freie Lizenz zu vergeben, wenn er für das Schaffen seines neuen Werkes ein frei lizensiertes vewendet. Wer auf Basis einer freien Lizenz auf den Werken anderer Aufbauen kann, ist so gezwungen seine Weiterentwicklung/Abwandlung/Kombination dieser Werke selbst für die Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Genau das ist die Idee hinter Copyleft. // Martin K. (Diskussion) 13:14, 7. Dez. 2015 (CET)
- P.S.: Das mit dem „nicht einzeln zugänglich“ bezieht sich übrigens darauf, dass die Inhalte in einem Sammelwerk nicht zwingend klar strukturiert und einzeln aufrufbar sein müssen (wie das z.B. Wikipedia-Artikeln oder Kapitel in eine Aufsatzsammlung ) sondern auch einfach ohne direkte Struktur nebeneinander stehen können (wie z.B. Bilder innerhalb eines Wikipediaartikels, in einem Flyer oder Katalog). Ersetz' für Dich doch einfach den Begriff Sammelwerk, durch Werksammlung - dann wird es vielleicht klarer.
- Moin. Also wenn ich das richtig verstehe, wurden für diese Kalenderblätter Fotos von Politikern verwendet, die unter CC-Lizenzen mit SA-Baustein veröffentlicht wurden. Dann muss das Endprodukt, also das dertige Kalenderblatt, auch unter dieser CC-Lizenz veröffentlicht werden, weil eine "Abwandlung" im Sinne der Lizenz vorliegt. Bei der CC BY-SA 3.0-Lizenz steht zum Beispiel das in Ziff. 4. b. des Lizenzvertragstexts. Ob eine Abwandlung vorliegt, kann im Einzelfall schwer zu beurteilen sein, hier ist das aber ein klarer Fall. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen und das bringt die Diskussion weiter. Gruß, --Gnom (Diskussion) 22:55, 7. Dez. 2015 (CET)
- Sehe ich genauso. Zumal die Originalbilder (siehe Galerie) jetzt auch echt nicht so schwer zu finden sind. Die sind also originell genug, dass sie auch in den Montagen erkennbar bleiben. Als eigenständige Werke. --Martina Disk. 07:11, 8. Dez. 2015 (CET)
-
1/12
-
2/12
-
3/12
-
4/12
-
5/12
-
6/12
-
7/12
-
8/12
-
9/12
-
10/12
-
11/12
-
12/12
- @Gnom: Das mag so sein. In der Form, wie das als Konsens hier in dem Thread anklingt, ist das jedoch immer noch nicht mehr als der – in der Form stellvertretend, für die betroffenen Fotograf(inn)en eingenommene – Rechtsstandpunkt einer involvierten Partei. Mit anderen Worten: Das Gerede hier ist obsolet; weder irgendein Community-Mitglied (bzw. die dahinterstehenden rechtlichen Subjekte) noch WMDE noch die WMF hat die Klagemacht, um gegen den Postillon juristisch vorzugehen. Anders wäre es, wenn ein direkt betroffener Fotograf oder Fotografin dagegen vorgehen würde. Ich denke, in dem Fall würde der hier artikulierte „Rechtsstandpunkt“ auf die tatsächlichen Realitäten zurechtgestutzt beziehungsweise mit der – rechtlich ebenfalls garantierten – Kunstfreiheit verglichen. Fazit: Ob der Postillon wirklich ein Problem hat, weiß ich nicht. Mir persönlich erscheint es fraglich – insbesondere aufgrund der klar ersichtlichen Montage (= neue Aussage) sowie der satirischen Intention. Aber vielleicht tritt jemand aus der Deckung und zeigt in der Öffentlichkeit, wie kleingeistig und übelwillig die WP-Community de facto ist. Dann wüßten wir alle mehr und bräuchten nicht zu spekulieren. --Richard Zietz 06:43, 8. Dez. 2015 (CET)
- Ach, Richard: Ich glaube Du verkennst die Intention des oben geschriebenen.
Es ging (zumindest mir) keineswegs darum hier "Skandal, Skandal" zu schreien und die Postillion auf Millionen zu verklagen, sondern darum auf etwas hinzuweisen, was im Kontext der CC-Lizenz leider oft unterschlagen wird:
Nämlich dass das SA in CC-BY-SA eben nicht mit der Angabe von Urheber und Lizenz erledigt ist (die wäre bei CC-BY auch nötig), sondern dass das SA jeden Urheber, der in seinem Werk ein so lizenziertes Werk eines anderen verwendet, verpflichtet, sein neues Werk ebenfalls unter dieser Lizenz zu veröffentlichen. Dieser virale Effekt ist (so selten er in der Praxis zur Anwendung kommt) eminent wichtig für die Idee der Wissensallmende. Eine Allmende lebt eben nicht von den Leuten, die die Kartoffel essen, sondern von denen, die Sie anbauen und einen Teil der Ernte vom Vorjahr immer wieder einpflanzen. - P.S.: Da der Postillion eigentlich einer der wenigen etablierten Nachnutzer ist, der CC-Lizenzen konsequent richtig nutzt, halte ich es auch für kontraproduktiv, denen jetzt mit irgendwelche juristischen Keulen zu drohen. Aber ein wohlmeinender Hinweis wäre da schon angebracht.
- P.S.: Dass das erst mal zu einer Diskussion darüber führt, ob das hier nicht vielleicht doch ein Sammelwerk sein könnte, hätte ich nicht erwartet. Meines Erachtens war es ziemlich offensichtlich, dass wir es hier mit einem abgleiteten Werk zu tun haben, für dessen Veröffentlichung natürlich die Zustimmung von deren Urheber nötig ist (aka die Lizenzbedingungen eingehalten werden müssen).
- P.P.S.: Die Idee, die Kunstfreiheit würde das Urheberrecht aushebeln, ist zwar kreativ aber letztlich doch irgendwie paradox. Da urheberrechtlich geschützten Werken eigentlich per definitionem dem künstlerischen Bereich zuzuordnen sind, wäre davon ja jede Verarbeitung eines Werkes in einem anderen betroffen. (nicht signierter Beitrag von Martin Kraft (Diskussion | Beiträge) )
- Ach, Richard: Ich glaube Du verkennst die Intention des oben geschriebenen.
Kleine Freuden #3: „Bebiographierte“ sind manchmal nicht nur erfreut, sondern auch dankbar
Ist das ernstgemeint? Wir sollen potentiell relevanten Zeitgenossen nahelegen, dass sie für eine Biographie in WP auch mal was spenden könnten?--Kamsa Hapnida (Diskussion) 07:11, 7. Dez. 2015 (CET)
- Dann aber bitte an eine Organisation die das Geld dringend nötig hat. --Sakra (Diskussion) 10:37, 7. Dez. 2015 (CET)
- Eventuell ist auch nur die Formulierung unglücklich gewählt. Etwas seltsam kam mir der Beitrag zwar schon vor (klan nach Immer schön spenden, wäre doch schade um den Artikel.), da dies in der hiesigen Diskussion nicht weiter kommentiert wurde, hab ich es schulterzuckend zur Kenntnis genommen. -- 32X 22:57, 10. Dez. 2015 (CET)
Wikidata in der Diskussion
@Andreas: Irgendwie ist das alles kalter Kaffee, hier und an zahlreichen anderen Stellen schon tausend Mal durchgenudelt. Das macht die angesprochenen und bekannten Probleme von Wikidata sicher nicht weniger schlimm, aber was wäre nun Deine Empfehlung? Beim Lesen Deines Signpost-Artikels habe ich den Eindruck, Du würdest Wikidata lieber loswerden wollen, auch deshalb weil externe Nachnutzer wie Google die Daten nicht „korrekt“ nachnutzen. Das erscheint mir reichlich absurd, auch ein wenig so als würdest Du Dich ziemlich stark an der vermeintliche zu starken Verbindung zu Google festbeißen. Ich würde mich freuen, wenn Du (hier) etwas zu den aus Deiner Sicht vorhandenen Handlungsoptionen für an Wikidata involvierte Interessensgruppen schreiben würdest. —MisterSynergy (Diskussion) 23:23, 7. Dez. 2015 (CET)
- Mir wäre wohler, wenn Wikidata eine Attribution Licence hätte. Denny hat einmal gesagt, eine solche Änderung sei später durchaus möglich. Dadurch würde die Herkunft der Daten für den Endverbraucher transparent bleiben.
- Die Importverfahren müssen sich ändern: wenn was von Wikipedia importiert wird, sollte die in Wikipedia angegebene Quelle
- im Idealfall geprüft werden
- als Referenz in Wikidata angegeben und ggf. verlinkt werden (Archivlink)
- als absolutes Minimum wenigstens die Artikelversion verlinkt werden, aus welcher der Inhalt stammt. Eine lapidare Angabe wie „Latvian Wikipedia“ ist einfach keine Referenz.
- Wenn eine Aussage in Wikipedia komplett unbelegt ist, sollte auf den Import verzichtet werden.
- Das wäre ein möglicher Anfang. Die Google-Dimension lässt bei mir zusätzliche Alarmklingeln losgehen, und das kommuniziert sich wohl. :) Ich sehe es als sehr wichtigen Aspekt, weil über eine Milliarde von Leuten Google benutzen und diese Infos sehen werden. Wenn so viele Leute dieselbe Information bekommen, sollte Transparenz herrschen, woher die Info kommt und wie man sie ändern kann. Siehe hierzu Dario Taraborellis Präsentation "Wikipedia as the Front Matter to All Research" (Video, Slides) und Epsteins und Robertsons "The search engine manipulation effect (SEME) and its possible impact on the outcomes of elections". Andreas JN466 00:49, 8. Dez. 2015 (CET)
- Kurz und bündig: Wikiblabla ist von der WMF finanzierter Werbemüll für Google. Wikidata ist der Ausverkauf der Wikipedia-Seele. --Informationswiedergutmachung (Diskussion) 00:54, 8. Dez. 2015 (CET)
- Kurz und bündig: Du hast keine Ahnung und laberst unsubstantiell herum. Vernünftige Kritik bzgl. Wikidata habe ich von Dir in zig Beiträgen zu dem Thema nicht gelesen. Dementsprechend nervig sind Deine Beiträge in dem Kontext mittlerweile. Yellowcard (D.) 15:32, 8. Dez. 2015 (CET)
- </quetsch>Och, Yellowcard, klingt wie ein Selbstgespräch. Wikidata ist rausgeworfenes Geld. Wenn man es ins Klo gestopft hätte, das Geld, dann wäre derselbe Effekt rausgekommen. Ach ne, hat man ja, das Klo nennt sich nur die allwissende Müllhalde aka Google. Es hätte nur nicht unser Geld gekostet... --Informationswiedergutmachung (Diskussion) 00:27, 9. Dez. 2015 (CET)
- Verstehe ich nicht. Wikidata funktioniert doch gut, Du kannst oder willst das Konzept bloß nicht verstehen. Falls Du substantielle Kritik hast, melde Dich gern wieder, ich setze mich dann mit ihr auseinander. Andreas hat es doch super vorgemacht: er trifft mit seiner Kritik gute Punkte und skizziert die momentanen Probleme von Wikidata ziemlich treffend. Nun ist das aber lange nichts, was man nicht ausbessern könnte, eher ein üblicher Community-Prozess. Hint: Durch Beleidigungen kommt man da seltenst weiter, eher mit argumentativer Überzeugung ... Yellowcard (D.) 01:11, 9. Dez. 2015 (CET)
- Ich stimme Yellowcard bezüglich der Bewertung der Kommentare zu, aber was wünscht du dir denn von Wikidata? Was meinst du mit Werbemüll? Was meinst du mit Ausverkauf der Wikipedia Seele? Dankend, Conny 05:54, 9. Dez. 2015 (CET).
- (quetsch) Danke für den Kommentar! —MisterSynergy (Diskussion) 08:48, 8. Dez. 2015 (CET)
- Kurz und bündig: Wikiblabla ist von der WMF finanzierter Werbemüll für Google. Wikidata ist der Ausverkauf der Wikipedia-Seele. --Informationswiedergutmachung (Diskussion) 00:54, 8. Dez. 2015 (CET)
- Siehe Meinungsbild hier in Wikidata. Eine der Optionen ist, dass Bots die URL der genauen Artikelversion hinterlegen sollen, aus welcher der Inhalt stammt. Eine weitere Option sieht vor, dass der Bot auch die externe Quelle suchen und hinterlegen soll. Das wären zumindest Schritte in die richtige Richtung. Andreas JN466 04:02, 8. Dez. 2015 (CET)
- Wenn man das Meinungsbild hochscrollt ist da fast alles rot. Ich sehe keine Akzeptanz dieser Vorschläge in der dortigen Community. Bin allerdings selbst dort stark aktiv und deshalb kein neutraler Beobachter. Ich habe mir zu Jerusalem Bing und Google angesehen und bei beiden wurde der deutsche WP-Artikel verlinkt. Glückwunsch an die Wikipedianer, die die Einleitung dieses Artikels geschrieben haben und Dank an die, die Vandalismus fern halten. Semantik Web macht die Wikipedia offenbar noch wichtiger, ob Wikidata jemals die Bedeutung bekommt, die ihr angedichtet wird, steht noch in den Sternen. Momentan fehlt einfach noch der Content, Wikidata besteht zur Zeit hauptsächlich aus Personendaten, Normdaten und Verlinkungen innerhalb WD. Es ist nur der Glanz des Silicon Valley, der Wikidata so hell scheinen lässt. Vielleicht wird WD auch ein Jahr 2006 erleben, das war das Jahr als Wikipedia in Europa und den USA abhob und aus eigener Kraft begann zu leuchten. Die vielen Zeitungsartikel deuten darauf hin, dass 2006 bei WD schon früher kommt. PS: Es wäre ein Gewinn für WP, würde man die Hälfte aller refs rausschmeißen. Hoffentlich zieht diese Unsitte nie bei WD ein. Goldzahn (Diskussion) 04:32, 8. Dez. 2015 (CET)
- Es wäre ein Gewinn für WP, wenn man welche Refs wo rausschmeißen würde?--Kmhkmh (Diskussion) 05:36, 8. Dez. 2015 (CET)
- Wenn man das Meinungsbild hochscrollt ist da fast alles rot. Ich sehe keine Akzeptanz dieser Vorschläge in der dortigen Community. Bin allerdings selbst dort stark aktiv und deshalb kein neutraler Beobachter. Ich habe mir zu Jerusalem Bing und Google angesehen und bei beiden wurde der deutsche WP-Artikel verlinkt. Glückwunsch an die Wikipedianer, die die Einleitung dieses Artikels geschrieben haben und Dank an die, die Vandalismus fern halten. Semantik Web macht die Wikipedia offenbar noch wichtiger, ob Wikidata jemals die Bedeutung bekommt, die ihr angedichtet wird, steht noch in den Sternen. Momentan fehlt einfach noch der Content, Wikidata besteht zur Zeit hauptsächlich aus Personendaten, Normdaten und Verlinkungen innerhalb WD. Es ist nur der Glanz des Silicon Valley, der Wikidata so hell scheinen lässt. Vielleicht wird WD auch ein Jahr 2006 erleben, das war das Jahr als Wikipedia in Europa und den USA abhob und aus eigener Kraft begann zu leuchten. Die vielen Zeitungsartikel deuten darauf hin, dass 2006 bei WD schon früher kommt. PS: Es wäre ein Gewinn für WP, würde man die Hälfte aller refs rausschmeißen. Hoffentlich zieht diese Unsitte nie bei WD ein. Goldzahn (Diskussion) 04:32, 8. Dez. 2015 (CET)
- Es gibt da noch ein anderes Problem. Gesetzt den Fall, man wüde bspw. vom USGS deren Datenbank aller geographischen Objekte importieren – theoretisch machbar, die Daten können in strukturierter Form von da heruntergeladen werden – dann fehlt dennoch der Mechanismus, diese Daten mit eventuell vorhandenen Wikidataitems zu verbinden. Bevor man also solche externen Datenbestände in Wikidata einliest, muß man, um Doppelungen zu vermeiden, zuerst checken, ob alle potentiell bereits vorhandenen Items eine ID haben und darf dann die schon vorhandenen Datensätze natürlich nicht neu anlegen, sondern nur, soweit notwendig korrigieren.
- Goldzahn macht, wie viele Wikidatianer einen grundlegenden Fehler. Einzelnachweise – ich nenne so was Belege – sind selbst Datensätze, siehe etwa Gary S. Becker, 83, Nobel Winner Who Applied Economics to Everyday Life, Dies (Q16749642), die natürlich auch verknüßft werden müssen, in dem Fall zumindest zur Person. Ich gehe davon aus, daß nach gewissen Irrungen und Wirrungen in ein paar Jahren unser gesamtes Referenzierungssystem aus solchen Datensätzen bestehen wird. (Eine solcher Wirrungen ist es, daß Mitarbeiter eines bestimmten Wartungsprojektes benamte Referenzen entnamen, wenn diese Ref nur einmal im Artikel vorkommt.) --Matthiasb –
 (CallMyCenter) 08:16, 8. Dez. 2015 (CET)
(CallMyCenter) 08:16, 8. Dez. 2015 (CET)
- Kurze Nachfrage: „ … daß Mitarbeiter … benamte Referenzen entnamen, wenn diese Ref nur einmal im Artikel vorkommt” – heißt, daß ich eine Publikation eines Autors z. B. mit <ref name="Hans-Joachim Ziegeler"/> vercode und irgendjemand ändert das, weil ja keine Notwendigkeit bestehe ein mehrfach verwendbares ref-Tag zu haben da es nur einmal im Text vorkommt? Aha. Was ein Unfug. Naja.
- Ob man es noch hinbekommen kann einzelne Einzelnachweise wie Datensätze zu behandeln, wage ich zu bezweifeln: Es gibt ja Null System oder – wenn man es strenger formulieren möchte – Vorschrift für einen Autor wie er seine ref-Tags ausgestalten soll. Mein Hans-Joachim Ziegeler hat 1999 einen Aufsatz in einem Fachlexikon veröffentlicht: Wie will ich denn sichergehen, daß alle die diesen Lexikonartikel ebenfalls als Referenz/Quelle verwendet haben das mit ref name="Hans-Joachim Ziegeler" getan haben? Und nicht mit – was genauso naheliegend bzw. sowieso korrekter wäre – mit ref name="Hans-Joachim Ziegeler (1999)" oder ref name="Hans-Joachim Ziegeler_1999_VL" oder mit ref name="Ziegeler, VL 1999"? Huch?!! Hatte ich vergessen zu unterschreiben? Sowas … also nachsigniert: --Henriette (Diskussion) 10:21, 8. Dez. 2015 (CET) ;)
- Henriette: Da bin ich relativ optimistisch, dass wir aus einzelnen Einzelnachweisen strukturierte Daten machen können, siehe Vorlagen cite news, cite book, Internetquelle usw. Es wird aber nicht an einer "ref name" hängen, sondern an DOI, ISBN, URL und ähnlichem. Wenn jeder Wikipedianer damit einfach semiautomatisch formatierte refs generieren kann (via Citoid/Zotero), brauchen wir nicht unbedingt "Vorschriften für einen Autor wie er seine ref-Tags ausgestalten soll", Bequemlichkeit reicht dann. Und diese refs müssten dann auch für wikidata nutzbar sein, um dort Aussagen zu belegen. --Atlasowa (Diskussion) 13:03, 8. Dez. 2015 (CET)
- @Atlasowa: Ich zweifele nicht daran, daß man es kann (oder könnte …), ich zweifele daran, daß eine Migration gelingen könnte. Eben weil es hier jahrelang… ich will nicht sagen Anarchie, aber eben größtmögliche individuelle Gestaltungsmöglichkeiten gab (bzw.: noch gibt). Ich sehe schon übereifrige menschliche Wartungsbots, die Zitationen in das Bequemlichkeitsformat umwandeln ohne sich einen Kopf darüber zu machen, ob sie evtl. gerade einen korrekten Verweis in Grütze verwandeln. (Ich gestehe aber auch gern, daß ich schon allein deshalb etwas gegen die „Bequemlichkeit" habe, weil a) für mich die Lit.-Zitationsvorlagen im Quelltext ziemlicher Gibberish sind und b) ich es gut finde, wenn ich mir bei der Formulierung einer korrekten bibliographischen Angabe nochmal Gedanken über das machen muß was ich da gerade ein- und angebe. Darfst Du aber beides gern auf „hoffnungslos altmodischer Philologe” schieben – stimmt sogar :)) Danke für die Erläuterung und Gruß! --Henriette (Diskussion) 14:06, 8. Dez. 2015 (CET)
- @Henriette: Ich glaube wir sind da gar nicht so weit auseinander, was die richtige Balance aus Bequemlichkeit und Sorgfalt angeht. --Atlasowa (Diskussion) 15:51, 8. Dez. 2015 (CET)
- Literatur, die vor 1972 erschien hat keine ISBN, und eine ISBN ist auch heute nicht zwingend vorhanden. --Matthiasb –
 (CallMyCenter) 17:33, 8. Dez. 2015 (CET)
(CallMyCenter) 17:33, 8. Dez. 2015 (CET)
- Das z. B. ist sowas, ja. Und selbst eine vorhandene ISBN hilft mir wenig bei einem Sammelband mit Aufsätzen in dem ein Autor mehr als einen Aufsatz veröffentlicht hat (oder, gar nicht so seltener Fall, einen Aufsatz publiziert und Vorwort/Einleitung geschrieben). Alle Literatur die grob gesagt vor den 1970er Jahren erschien, ist mit URLs oder DOIs sowieso kaum zu packen (außer sie ist inzwischen frei, wurde digitalisiert und hat einen urn). Ich bin ja nur ein simpler Philolog aber mir scheint, daß das über lange Jahre des Nachdenkens entwickelte System der Literaturzitation bzw. bibliographischer Angaben verdammt gut funktioniert und – bei sachgemäßer und intelligenter Anwendung – auch noch die merkwürdigsten Cornercases sehr gut abbilden kann. Bei Literatur (allgemeiner gesagt: (gedruckten) Quellen) haben wir es nicht nur mit „Autor hat Buch in Jahr X geschrieben" zu tun, sondern mit einem Haufen unterschiedlichster Druckerzeugnisse (und natürlich auch nicht gedruckter Literatur! – wie ausschließlich digital publizierten Zeitschriften z. B.). --Henriette (Diskussion) 14:27, 9. Dez. 2015 (CET)
- Literatur, die vor 1972 erschien hat keine ISBN, und eine ISBN ist auch heute nicht zwingend vorhanden. --Matthiasb –
- @Henriette: Ich glaube wir sind da gar nicht so weit auseinander, was die richtige Balance aus Bequemlichkeit und Sorgfalt angeht. --Atlasowa (Diskussion) 15:51, 8. Dez. 2015 (CET)
- @Atlasowa: Ich zweifele nicht daran, daß man es kann (oder könnte …), ich zweifele daran, daß eine Migration gelingen könnte. Eben weil es hier jahrelang… ich will nicht sagen Anarchie, aber eben größtmögliche individuelle Gestaltungsmöglichkeiten gab (bzw.: noch gibt). Ich sehe schon übereifrige menschliche Wartungsbots, die Zitationen in das Bequemlichkeitsformat umwandeln ohne sich einen Kopf darüber zu machen, ob sie evtl. gerade einen korrekten Verweis in Grütze verwandeln. (Ich gestehe aber auch gern, daß ich schon allein deshalb etwas gegen die „Bequemlichkeit" habe, weil a) für mich die Lit.-Zitationsvorlagen im Quelltext ziemlicher Gibberish sind und b) ich es gut finde, wenn ich mir bei der Formulierung einer korrekten bibliographischen Angabe nochmal Gedanken über das machen muß was ich da gerade ein- und angebe. Darfst Du aber beides gern auf „hoffnungslos altmodischer Philologe” schieben – stimmt sogar :)) Danke für die Erläuterung und Gruß! --Henriette (Diskussion) 14:06, 8. Dez. 2015 (CET)
- Henriette: Da bin ich relativ optimistisch, dass wir aus einzelnen Einzelnachweisen strukturierte Daten machen können, siehe Vorlagen cite news, cite book, Internetquelle usw. Es wird aber nicht an einer "ref name" hängen, sondern an DOI, ISBN, URL und ähnlichem. Wenn jeder Wikipedianer damit einfach semiautomatisch formatierte refs generieren kann (via Citoid/Zotero), brauchen wir nicht unbedingt "Vorschriften für einen Autor wie er seine ref-Tags ausgestalten soll", Bequemlichkeit reicht dann. Und diese refs müssten dann auch für wikidata nutzbar sein, um dort Aussagen zu belegen. --Atlasowa (Diskussion) 13:03, 8. Dez. 2015 (CET)
- Ich glaube, das soll dann nachher so gehen.
-
"Citing as a public service", Dario Taraborelli
Wichtiger Artikel. Eine Übersetzung ins Deutsche -oder zumindest Zusammenfassung- wäre sehr wünschenswert. Nicht jeder ist so flüssig in Englisch. --77.9.85.56 10:05, 8. Dez. 2015 (CET)
@Matthiasb Zum Matching von externen Datenbanken mit Wikidata. Das Problem ist schon aktuell, weil wir ja dabei sind die Google-Datenbank von Freebase zu importieren. So weit ich das mitbekommen habe, wird das mit einer Mischung aus Handarbeit und Botarbeit gemacht. Aber natürlich gibt es Doppelungen und die zu finden und zu beheben, gehört mit zu den Wartungsaufgaben. Falls es interessiert d:Wikidata:WikiProject Freebase. Der Import selbst scheint nur mit einem Tool gemacht zu werden d:Wikidata:Primary sources tool, welches - wenn man will - bei den items Freebase-Informationen einblendet, die man akzeptieren, als falsch verwerfen oder ignorieren kann. Mir ist dabei aufgefallen, dass das meistens Filmthemen sind. Vielleicht nur ein subjektiver Eindruck. Ein anderes tool ist meta:Mix'n'match, das glaube ich das Gleiche mit anderen Daten macht, aber ganz extern läuft. Benutzt habe ich das noch nie. --Goldzahn (Diskussion) 10:11, 8. Dez. 2015 (CET)
Ich finde den verlinkten Artikel lang, aber gut. Er weist auf ein Problem hin: Wikidata ist ein großer Faktor bei der Erstellung von steckbriefartigen "Datenporträts" wie dem Google Knowledge Graph. Diese Porträts zielen auf Eindeutigkeit grundlegender Angaben. Die Angaben sind aber gar nicht so eindeutig. Es handelt sich um (oft keineswegs neutrale) Vereinfachungen zum Teil sehr komplizierter Sachverhalte. Wie ist damit umzugehen? Wikidata hat zwar die prinzipielle Möglichkeit, mehrere konkurrierende Angaben aufzunehmen und deren Herkunft jeweils einzeln zu belegen. Dies wird aber nicht sonderlich ernst genommen und geht bei der Übernahme von Angaben in ein solches Datenporträt verloren. Es besteht die Gefahr einer Monokultur: Es wird eine Wirklichkeit vorgespiegelt, die das Wichtigste von dem, was datenmäßig erfassbar und zuverlässig wissbar ist, repräsentiert. Diese "eine Wirklichkeit" ist jedoch ein Kunstprodukt. - Meines Erachtens sollte es der Job der Wikimedia-Projekte sein, über die komplizierte Wirklichkeit zu informieren und ihre Rezipienten in die Lage zu versetzen, die Vorstellung einer einfachen, datenmäßig erfassbaren Wirklichkeit zu hinterfragen. Wenn das stimmt, ist es ganz wesentlich, sofort zu erfahren, woher die Daten eigentlich stammen und ob es auch noch andere Datenquellen gibt. Dieser Aufgabe ist aber bislang nicht gerade höchste Priorität eingeräumt worden. Man glaubt zwischen "eindeutigen Daten" und "konkurrierenden Interpretationen" klar unterscheiden zu können. Das ist aber in sehr vielen Fällen gar nicht möglich, da bereits die Datenerhebung, viel mehr noch die Repräsentation der Daten auf einer Interpretation basiert.--Mautpreller (Diskussion) 10:26, 8. Dez. 2015 (CET)
- +1. Es gibt da eine zusätzliche Dimension. Wir in Europa leben, trotz Terrorismus, Syrien usw., in relativ ruhigen Zeiten. Das muss nicht immer so sein. In anderen Ländern sind Pluralismus und Meinungsfreiheit wenig gefragt, genau wie sie auch in Deutschland vor drei Generationen nicht gefragt waren. Je robuster und verteilter Informationsinfrastrukturen sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand die Herrschaft über diese Strukturen an sich reißen kann. Wenn die bestehende Infrastruktur dagegen schon monokulturelle Züge hat, wird die Medienlandschaft entsprechend leichter dominierbar. Monokulturen sind in dieser Hinsicht nicht robust. Von der Wikimedia-Warte aus gesehen ist es natürlich toll, wenn sich alle täglich auf Wikidata, Wikipedia und Google verlassen. Vom Standpunkt einer robusten Medienstruktur dagegen ist es eher besorgniserregend, weil solche Monopole potenziell instrumentalisierbar sind. An sich sollte es unsere Aufgabe sein, robuste Strukturen zu schaffen, die auch in schwierigen Zeiten gute Chancen haben, ohne Integritätsverlust zu überleben. Praktisch habe ich da keine konkreten Vorschläge; ich weiß nur, dass mir unwohl wird, wenn irgendeine Organisation zu dominant wird – selbst wenn es ein Wikimedia-Projekt ist oder „das liebe Google, das uns doch so viel geholfen hat“. Andreas JN466 17:40, 8. Dez. 2015 (CET)
- Ja, mir ist es ja auch gar nicht recht, wenn ein Wikipedia-Artikel oder ein Datenset bei Wikidata einen gar zu großen Einfluss hat. Das Credo der Wikipedia war immer: Wir sind nur Sammler und Chronisten, wir schaffen nicht, sondern wir sammeln. Das hat natürlich noch nie gestimmt. Die Wikipedia wirkt selbst schon disruptiv, sie beeinflusst und irritiert andere Medien, und es hat wenig Zweck, das zu verleugnen. Sie spricht im Wissenspluralismus mit einer gewichtigen Stimme. Was mir aber gar nicht gefällt, ist, dass die Utopien, die mit Wikidata verbunden sind, bewusst oder unbewusst dazu tendieren, unter der Hand diesen Wissenspluralismus wieder aufzuheben. Die Vielstimmigkeit wird wieder durch Einstimmigkeit ersetzt und man weiß nicht mal mehr, wer hier eigentlich spricht.--Mautpreller (Diskussion) 18:14, 8. Dez. 2015 (CET)
Mal am Rande: Es gibt in dem Signpost-Artikel ja ein schönes Beispiel für en:Citogenesis (The coati, a member of the raccoon family, is "also known as … a Brazilian aardvark"). Und enwiki hat auch eine en:Wikipedia:List of hoaxes on Wikipedia und en:Wikipedia:List of citogenesis incidents, sehr interessant (und natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit). Haben wir solche Listen auch hierzuwiki? Mir fällt dazu ein:
- "Wilhelm" zu Guttenberg
- Wikipedia:Kurier/Ausgabe 08 2014#Uni Gießen, WDR, NZZ: Zerstören, um zu berichten (Vogel „Sperchdrossel“, ein angebliches Moos „Müllia Irriatum“, eine angeblich Nagetiere fressende Pflanze namens Hyproxanthipa)
- Monika Harms wurde ein Vater angedichtet (Citogenesis konnte ich gerade so noch verhindern [3][4])
Was noch? (und nicht im Benutzer:Gestumblindi/Fakemuseum spicken!) --Atlasowa (Diskussion) 13:57, 8. Dez. 2015 (CET)
- +1: Wikipedia-Selbstversuch: Wie ich Stalins Badezimmer erschuf --Atlasowa (Diskussion) 14:16, 8. Dez. 2015 (CET)
@Andreas: Deine hier geäußerte Kritik finde ich gut. Den Punkten 2 und 3 schließe ich mich vollumfänglich an, bzgl. Punkt 1 bin ich mir noch nicht sicher: Ich denke, dass das in der Nachnutzbarkeit mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein könnte. Ich habe mir da also noch keine Meinung gebildet. Deinen umseitig verlinkten Beitrag habe ich noch nicht gelesen, werde das aber bis heute Abend nachholen. Yellowcard (D.) 15:35, 8. Dez. 2015 (CET)
- Nochmal @Andreas: Deine Argumentation bzgl. der Lizenzierung verstehe ich bei weiterem Lesen nicht. Du begründest die Forderung nach einer Lizenz mit Attribution so, dass bei Nachnutzung der Daten damit die Quelle angegeben werden müsste. Das ist aber falsch. Vielmehr ist es so, dass bei einer beliebigen Lizenz mit Attributionsforderung bei Nachnutzung die Namen der relevanten Beitragenden genannt werden müssten, das heißt eine längere Liste von Usernamen und IP-Adressen. Quelle: Wikidata – und das ist nach meinem Verständnis ja das, was Du bei Nachnutzung gern sehen würdest – wäre bei einer solchen Lizenz nicht ausreichend. Yellowcard (D.) 01:36, 9. Dez. 2015 (CET)
- Wenn im Google Knowledge Graph Wikipedia-Inhalte stehen, steht das Wort „Wikipedia“ auch grundsätzlich da. Bing nennt sowohl Freebase (CC-BY) als auch Wikipedia als Quellen am unteren Rand der Snapshot-Box. Dort steht dann „Data from: Wikipedia · Freebase“. (Bei Google habe ich Freebase noch nie genannt gesehen; das hat wohl damit zu tun, dass Freebase Google selbst gehört.) Ich verstehe diese Nennungen als minimale Attribution, die angesichts des Bildschirmformats wohl auch sinnvoll ist. (Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Richter Google und Bing auflegen würde, alle Nutzernamen aufzulisten, die an den eingeblendeten Inhalten beteiligt waren.) Meine Vermutung ist:
- Wenn Wikidata dieselbe Lizenz wie Wikipedia hätte, würde eine Nennung in dem gehabten Format bei Bing und Google wahrscheinlich erfolgen.
- Wenn Wikipedia dieselbe Lizenz wie Wikidata hätte, würde die Nennung wahrscheinlich irgendwann verschwinden.
- Es sollte mich sehr überraschen, wenn Microsoft und Google als Geldgeber für Wikidata nicht ihre Präferenz bekannt gemacht hätten, dass die Wikidata-Lizenz bitte schön CC0 sein sollte, damit ganz klar ist, dass keinerlei Attribution notwendig sein wird.
- Die Verwendung von Wikidata soll nebenbei bemerkt irgendwie anders sein als bei Freebase. Während Freebase einen relativ direkten Einfluss auf den Inhalt des Knowledge Graph hatte, soll es bei Wikidata indirekter sein. Nähere Einzelheiten werden von Google nicht dargelegt. SEO-Experten raten ihren Kunden auf jeden Fall dazu, Wikidata zu bearbeiten, weil es – auf welche Weise nun auch immer – eine wichtige Quelle für den Knowledge Graph sein soll. Andreas JN466 03:51, 9. Dez. 2015 (CET)
- Nur, um das klarzustellen: Nein, diese Annahme ist schlichtweg falsch. Google hat an die Entwicklung von Wikidata keine einzige Bedingung gestellt, und auch keinerlei "Präferenzen bekannt gemacht". Und von Microsoft haben wir keinen einzigen Cent erhalten, und dementsprechend auch keine Bedingungen. Erik kam, unabhängig von mir, zu dem selben Vorschlag, CC0 zu verwenden. Meine Meinung ist hier festgehalten. Ich bin der Überzeugung, dass eine Lizenz, die auf Urheberrecht basiert, für Daten und Fakten nicht anwendbar ist. Wenn Du aber die Meinung vertrittst, dass Fakten selbst urheberrechtlich schützbar sein sollen, wärst Du nicht der erste. Für richtig, oder gar für das beste für unsere Mission, halte ich das allerdings nicht. -- Denny Vrandečić | Diskussion 04:57, 9. Dez. 2015 (CET)
- @Denny, ich habe Microsoft hier als Kurzform für das Institut des Microsoft-Gründers (AI2) gebraucht, das 50% der ursprünglichen Gelder beisteuerte (und seine Gründung doch wohl dem Microsoft-Vermögen verdankt). Zu Datenbankrechten siehe https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikilegal/Database_Rights – einzelne Fakten sind nicht geschützt, Datenbanken als ganze schon (selbst in den USA). Dass Erik zu demselben Schluss kam, mag sein; aber in deinem Fall ist es wegen deines Anstellungsverhältnisses bei Google nie möglich, mit Sicherheit zu sagen, ob du deine persönlichen Ansichten vertrittst oder die deines Arbeitgebers. Mit anderen Worten, wir können uns nicht sicher sein, dass du für CC-BY-SA plädieren könntest, ohne dich eines Vergehens gegenüber deinem Arbeitgeber schuldig zu machen.
- Außerdem wäre ich schon deshalb nicht der erste, der behauptet hätte, dass Fakten unter gewissen Umständen dem Urheberrechtsschutz unterliegen könnten, weil du selber einmal, noch vor deinem Anstellungsverhältnis bei Google, gesagt hast: "it is true that Wikidata under CC0 would not be allowed to import content from a Share-Alike data source. Wikidata does not plan to extract content out of Wikipedia at all. Wikidata will provide data that can be reused in the Wikipedias."
- Du hattest ferner vor ein paar Jahren einmal gesagt, die Entscheidung für die CC0-Lizenz könne die Community später ggf. rückgängig machen. Gilt das prinzipiell noch? Wie du weißt, geht es mir darum, dass Nachnutzer eine minimale Attribution vornehmen – nicht zur Einschränkung der Nachnutzung, sondern um der Transparenz der Datenherkunft willen. Andreas JN466 05:29, 9. Dez. 2015 (CET)
- Ich halte - und hielt schon damals - die Möglichkeit, Fakten und Daten mit der CC-BY-SA Lizenz zu versehen, für schlicht falsch. Wenn es nur nach meinem Verständnis der Rechtslage ginge, würde Wikidata überhaupt keine Lizenz benötigen, weil Daten und Fakten sowieso frei sind. Aber anzunehmen dass es nach mir geht, wäre reichlich dämlich. Insbesondere kann ich nicht vorhersagen, wie Gerichte tatsächlich entscheiden werden sollte es soweit kommen. Dementsprechend halte ich meine damalige Aussage, dass Wikidata unter einer CC0-Lizenz nicht Daten aus einer Share-Alike Datenquelle übernehmen dürfe, nach wie vor für richtig. Alles andere wäre unverantwortlich. Aus diesem Satz abzuleiten, dass ich glaube, dass Fakten urheberrechtlich geschützt sein können, ist schlicht falsch. Ich verweise wiederholt auf diesen Aufsatz, wo ich das ausführlicher darstelle.
- Bezüglich der Lizenzänderung: ich bin kein Anwalt. In meinem damaligen Verständnis, und das hat sich nicht geändert bisher, kann jeder gemeinfreie Werke unter einer beliebigen Lizenz wiederveröffentlichen. Wir machen das in Wikipedia doch dauernd, dass wir gemeinfreie Texte unter der CC-BY-SA Lizenz veröffentlichen. Mir ist unklar warum dass bei Wikidata anders sein sollte, insofern man irrtümlich annimmt, dass Daten überhaupt unter einer auf dem Urheberrecht basierenden Lizenz veröffentlichbar sind. Ich würde eine solche Lizenzänderung für unbedacht halten, und würde gegen sie argumentieren, aber ich halte sie nach wie vor für rechtlich möglich. Ich verstehe nicht, warum Du überhaupt fragst - steht in dieser Antwort irgendwas drin, was Dir nicht sowieso bekannt ist?
- Schliesslich, re "wegen deines Anstellungsverhältnisses bei Google nie möglich, mit Sicherheit zu sagen, ob du deine persönlichen Ansichten vertrittst oder die deines Arbeitgebers." - aber zu dem Zeitpunkt war ich bei Wikimedia Deutschland angestellt, und meine persönliche Meinung zu Datenlizensierung ist schon vor meiner Anstellung bei WMDE nachweisbar, und hat sich seitdem nicht geändert. Zudem, im Sinne der Transparenz frage ich doch auch nicht nach, wo Du arbeitest, und hinterfrage ob Du Deine eigene Meinung hier widergibst, oder ob Du einfach nur Orlowski nach dem Mund redest, weil Du ja für Ihn schreibst und wahrscheinlich reichlich bezahlt wirst dafür. Ich würde mir wünschen, den gleichen Respekt dafür, dass ich als Wikimedianer eine eigenständige Person bin, zu erhalten. Solche dauernden Anspielungen und ad-hominen Attacken sind doch ermüdend. Oder anders gesagt, wenn Du mich ohnehin nur für die PR-Abteilung von Google hältst, warum fragst Du überhaupt nach? -- Denny Vrandečić | Diskussion 08:26, 9. Dez. 2015 (CET)
- Aber Denny, es ist gar nicht möglich, diese Frage unpersönlich zu diskutieren. Es ist so, dass Du persönlich die Interessen von Google wahrzunehmen hast. Ich glaube nicht, dass Du nur die PR-Abteilung von Google bist, dazu klingt mir das, was Du sagst, viel zu individuell. Aber dass Deine Beschäftigung bei Google Deine Einschätzungen prägt, liegt doch auf der Hand. Google ist doch nicht irgendeine Firma, die mit Wikidata gar nichts zu tun hat. Ich habe in Diskussionen mit Dir meist ganz gute Erfahrungen gemacht, aber Misstrauen ist hier sachlich begründet und nicht "ad hominem", genauer gesagt: selbstverständliche Pflicht.--Mautpreller (Diskussion) 09:49, 9. Dez. 2015 (CET)
- Andreas, die Quellenangabe Quelle: Wikipedia bei der Übernahme von Inhalten aus der Wikipedia findet sich zwar oft, ist aber nichts anderes als eine Lizenzverletzung. Das haben Gerichte auch schon zigfach bestätigt, der Lizenztext der CC-Lizenzen ist da eindeutig: Die einzelnen Autoren müssen genannt werden, und zwar jeder einzelne, der zum Wikipedia-Artikel einen Beitrag mit Schöpfungshöhe geleistet hat. Dasselbe gilt für Wikidata. Ob der Google Knowledge Graph (oder wer auch immer) bei einer Datenübernahme aus Wikidata etwas wie Quelle: Wikidata dazuschreiben möchte oder nicht, hat mit der Lizenzierung zumindest rechtlich gesehen nichts zu tun. Und dass Player wie Google fälschlicherweise glauben, diese Quellenangabe sei wegen der BY-Klausel notwendig, kann ich mir nicht vorstellen. Yellowcard (D.) 10:00, 9. Dez. 2015 (CET)
- Yellowcard, Bing hat in seinem Snapshot öfters eine Timeline. Beispiel: [5] Diese Timeline besteht einfach aus Wikipedia-Sätzen, die eine Jahreszahl enthalten. Wenn du die Timeline unten aufklappst, erscheint ein "More on Wikipedia"-Link zu dem betreffenden Wikipedia-Artikel, aus dem die Sätze stammen. Nun stell dir vor, du würdest Microsoft in den USA wegen Lizenzverletzung verklagen, weil die Autorennamen nicht genannt sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Anwälte von Microsoft das Argument ins Feld führen werden, dass bei einer solchen Nutzung eines so kleinen Teils eines Wikipedia-Artikels eine Nennung aller Autoren einfach unrealistisch ist und mit der Nennung und Verlinkung von Wikipedia (die auch in Snapshots ohne Timeline erfolgt, in denen nur die ersten Sätze des Artikels eingeblendet werden), der Wikipedia-Lizenz in genügendem Ausmaß Rechnung getragen wird. Die vorhandene Attribution, auch wenn sie nicht so vollständig ist, wie die Lizenz fordert, ist rechtlich nicht belanglos, denn sie ist Zeichen eines guten Willens seitens Bings, den Benutzer darüber aufzuklären, dass Bing die Daten nicht selbst erstellt hat. Bei Wikidata dagegen entfällt dieser Aspekt mit CC0 – und damit auch die Transparenz hinsichtlich der Datenherkunft. Andreas JN466 17:16, 9. Dez. 2015 (CET)
- Misstrauen ist hier auf beiden Seiten angebracht. Denny steckt ohne Frage in einem gewissen Interessenskonflikt durch seine Position bei Google, aber für mich argumentiert er hier kohärent und transparent. Er macht das in meinen Augen deutlich besser als Andreas, der wiederholt mit durchaus validen Wikidata-Kritiken daherkommt und seine Position gut zu verkaufen weiß. Bei genauerer Betrachtung über die letzten Monate kommen seine Beiträge aber einseitig, wiederholend, zum Teil auffällig Google-fokussiert und vor allem ohne substantielle Lösungsvorschläge daher (dadurch war meine eingangs bewusst diffus gehaltene Frage an ihn motiviert). Mittlerweile habe ich gesehen, dass er bei Wikidata bisher nicht mehr als sechs Beiträge (mit seinem hier genutzten Konto) getätigt hat, so dass ich jetzt zweifle, ob seine Meinung zu Bot-Importen, externen Nachweisen oder auch Vandalismus bei Wikidata überhaupt praxisnah und brauchbar sein kann. Ich verstehe seine Motivation überhaupt nicht. Kurzum: Misstrauen bei Andreas nicht minder angebracht als bei Denny. Jeder muss da selbst entscheiden, was zu glauben ist. —MisterSynergy (Diskussion) 11:10, 9. Dez. 2015 (CET)
- Entschuldige mal, es macht schon einen Unterschied, ob jemand bei einem der größten privaten Sponsoren (und Profiteure) von Wikidata angestellt ist oder nicht.--Mautpreller (Diskussion) 11:39, 9. Dez. 2015 (CET)
- Andreas, die Quellenangabe Quelle: Wikipedia bei der Übernahme von Inhalten aus der Wikipedia findet sich zwar oft, ist aber nichts anderes als eine Lizenzverletzung. Das haben Gerichte auch schon zigfach bestätigt, der Lizenztext der CC-Lizenzen ist da eindeutig: Die einzelnen Autoren müssen genannt werden, und zwar jeder einzelne, der zum Wikipedia-Artikel einen Beitrag mit Schöpfungshöhe geleistet hat. Dasselbe gilt für Wikidata. Ob der Google Knowledge Graph (oder wer auch immer) bei einer Datenübernahme aus Wikidata etwas wie Quelle: Wikidata dazuschreiben möchte oder nicht, hat mit der Lizenzierung zumindest rechtlich gesehen nichts zu tun. Und dass Player wie Google fälschlicherweise glauben, diese Quellenangabe sei wegen der BY-Klausel notwendig, kann ich mir nicht vorstellen. Yellowcard (D.) 10:00, 9. Dez. 2015 (CET)
- Aber Denny, es ist gar nicht möglich, diese Frage unpersönlich zu diskutieren. Es ist so, dass Du persönlich die Interessen von Google wahrzunehmen hast. Ich glaube nicht, dass Du nur die PR-Abteilung von Google bist, dazu klingt mir das, was Du sagst, viel zu individuell. Aber dass Deine Beschäftigung bei Google Deine Einschätzungen prägt, liegt doch auf der Hand. Google ist doch nicht irgendeine Firma, die mit Wikidata gar nichts zu tun hat. Ich habe in Diskussionen mit Dir meist ganz gute Erfahrungen gemacht, aber Misstrauen ist hier sachlich begründet und nicht "ad hominem", genauer gesagt: selbstverständliche Pflicht.--Mautpreller (Diskussion) 09:49, 9. Dez. 2015 (CET)
- Nur, um das klarzustellen: Nein, diese Annahme ist schlichtweg falsch. Google hat an die Entwicklung von Wikidata keine einzige Bedingung gestellt, und auch keinerlei "Präferenzen bekannt gemacht". Und von Microsoft haben wir keinen einzigen Cent erhalten, und dementsprechend auch keine Bedingungen. Erik kam, unabhängig von mir, zu dem selben Vorschlag, CC0 zu verwenden. Meine Meinung ist hier festgehalten. Ich bin der Überzeugung, dass eine Lizenz, die auf Urheberrecht basiert, für Daten und Fakten nicht anwendbar ist. Wenn Du aber die Meinung vertrittst, dass Fakten selbst urheberrechtlich schützbar sein sollen, wärst Du nicht der erste. Für richtig, oder gar für das beste für unsere Mission, halte ich das allerdings nicht. -- Denny Vrandečić | Diskussion 04:57, 9. Dez. 2015 (CET)
- Wenn im Google Knowledge Graph Wikipedia-Inhalte stehen, steht das Wort „Wikipedia“ auch grundsätzlich da. Bing nennt sowohl Freebase (CC-BY) als auch Wikipedia als Quellen am unteren Rand der Snapshot-Box. Dort steht dann „Data from: Wikipedia · Freebase“. (Bei Google habe ich Freebase noch nie genannt gesehen; das hat wohl damit zu tun, dass Freebase Google selbst gehört.) Ich verstehe diese Nennungen als minimale Attribution, die angesichts des Bildschirmformats wohl auch sinnvoll ist. (Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Richter Google und Bing auflegen würde, alle Nutzernamen aufzulisten, die an den eingeblendeten Inhalten beteiligt waren.) Meine Vermutung ist:
- Wie gesagt: „Misstrauen ist hier auf beiden Seiten angebracht.“ Das möchte ich gar nicht bestreiten. In dieser Sache finde ich dennoch Dennys Position nachvollziehbar, die vom Andreas nur in engen Grenzen. —MisterSynergy (Diskussion) 12:01, 9. Dez. 2015 (CET)
- Und dieser Angestellte von Google saß also vorher bei WMDE und heute sitzt er im Board der Wikimedia Foundation. Und meint, alles, was er gesagt oder getan habe, sei stets nur seine persönliche Meinung/Handlung gewesen. Ich kann mir durchaus vorstellen, daß das dort, wo er saß oder sitzt, eine plausible Argumentation war, weil die Leute dort, wo er saß oder sitzt, eben so gedacht haben. Aber man kann ja noch anders denken. Und dann kommt man natürlich auch zu einem anderen Ergebnis.--Aschmidt (Diskussion) 12:34, 9. Dez. 2015 (CET)

- Also ich verdiene meine Brötchen als freiberuflicher technischer Übersetzer in Cambridge. Wikipedia ist ein Hobby. Ich habe im Laufe der Zeit viele Missstände in der englischen Wikipedia (wo ich die meiste Zeit zu finden bin) beobachtet, früher auf Wikipediocracy.com dazu gebloggt, im Signpost darüber geschrieben und von Zeit zu Zeit Journalisten bei Wikipedia-Recherchen geholfen. Ich habe genau einen Beitrag für The Register geschrieben (wo der von Denny erwähnte Orlowski arbeitet). Der ist eine Kurzfassung des umseitig verlinkten Signpost-Artikels, für den ich zwei Nächte durchgemacht habe, und ich kriege vom Register weniger als 100 Euro dafür. Das ist das erste und einzige Mal, dass ich einen Presseartikel geschrieben habe und dafür bezahlt werde. Wenn euch interessiert, für welche anderen Presseartikel ich Journalisten kontaktiert bzw. Recherchen beigetragen habe, hier ist eine Auswahl: [6][7][8][9][10][11][12]. Ich bin stolz auf diese Arbeit, und habe auf der Wikiconference 2015 USA (Anreise auf eigene Kosten) dazu referiert. Die Slides sind hier: [13] (meine sind die blauen in der zweiten Hälfte der Präsentation). Andreas JN466 16:27, 9. Dez. 2015 (CET)
- @Denny, du sagst, du hältst deine damalige Aussage, dass Wikidata unter einer CC0-Lizenz nicht Daten aus einer Share-Alike Datenquelle übernehmen dürfe, nach wie vor für richtig. Aber du bist dir doch sicherlich bewusst, dass das genau das ist, was Wikidata macht. Wikipedia hat eine Share-Alike-Lizenz, und Wikidata importiert massenweise, im Schnellverfahren, Daten von Wikipedia. Wieso ist das bei Wikipedia okay und bei anderen Datenquellen nicht?!
- Um das Ganze einmal aus einer anderen Warte zu betrachten: Wenn Ehrenamtliche diese Imports machen, liegt das im Geschäftsinteresse deines Arbeitgebers, denn der will die Daten ja umsonst haben, um damit Geld zu verdienen. Der mit Wikidata gefütterte Knowledge Graph dient dazu, anderen (inklusive Wikipedia) Klicks wegzunehmen, indem mutmaßlich gesuchte Informationen schon auf Googles eigenen, mit Werbung versehenen Seiten präsentiert werden. Das steigert Googles Gewinne.
- „Freie Inhalte, die wir alle kostenlos nutzen können, sind toll! Helft uns (umsonst!), solche Inhalte zu erstellen!“ klingt für mich scheinheilig, wenn die, die dazu aufrufen, mit den erstellten Inhalten Hunderte von Milliarden verdienen. Die Werbeeinnahmen von Google allein (die anderen Nachnutzer wie Facebook und Bing lasse ich jetzt mal außen vor) belaufen sich auf knapp $200 Millionen täglich. Die Wikipedia-Inhalte im Knowledge Graph leisten einen nicht unerheblichen Beitrag dazu. Angesichts solcher astronomischen Gewinne erschiene es mir menschlich gesehen fairer, wenn Google und die anderen Wikidata-Sponsoren (dazu gehört übrigens auch die russische Suchmaschine Yandex) die Leute bei Wikidata für ihre Arbeit bezahlen würden.
- Ein Rechenexempel: wenn man die $200 Millionen, die Google im Laufe eines Tages an Werbung verdient, auf die Gesamtzahl aller jemals in Wikimedia-Projekten getätigten Edits (etwa 2,6 Milliarden) umrechnen würde, würde sich der Wert jedes einzelnen von einem Ehrenamtlichen getätigten Edits auf etwa 0,07 Euro belaufen.
- Das ist der wirtschaftliche Wert der „freien Inhalte“. Und ich bin sicher, dass das, was die Arbeit von Ehrenamtlichen in Wikipedia zu Googles Gewinnen beigetragen hat, wesentlich mehr darstellt als die Einnahmen eines einzigen Tages. Wenn Google also in Wikipedia unter CC-BY-SA lizenzierte Daten als CC0 haben möchten, wäre eine Möglichkeit, dass Google die Ehrenamtlichen, die diese Daten erstellt haben, bezahlt. Damit wäre dann ja vielleicht auch hinreichend sichergestellt, dass die Öffentlichkeit weiß, woher viele von Googles Daten kommen.
- Grund für die Frage, ob die Wikimedia-Community die Wikidata-Lizenz nach wie vor ändern könnte, war, dass Atlasowa neulich hier auf dieser Seite gesagt hat, diesbezügliche Fragen würden in letzter Zeit, trotz des damals von dir eingeräumten „Das ist nur für den Anfang, wir können das später immer noch ändern“, immer abgeblockt. Andreas JN466 16:10, 9. Dez. 2015 (CET)

- Unter Abblocken verstehe ich zum Beispiel sowas: "Licensing is either a pain on the producer or re-user. I am absolutely convinced that we have to be the ones bearing the pain if we want to be successful. (...) I am absolutely convinced that a license change is one of the very few things that can kill Wikidata. Let's not do that. --Lydia Pintscher (WMDE) (Staff) (talk) 11:42, 10 April 2014 (UTC)[14]" Meistens lässt man Nachfragen aber einfach ins Leere laufen, keine Antwort ist auch eine Antwort. Wenn man wie früher angesprochen einen Lizenzwechsel machen will (Beispiele für Lizenzen wären schema.org: License CC-BY-SA 3.0 oder OpenStreetMap: ODbL oder OpenCorporates: SA-BY-Open Database License usw.), dann haben wir dafür allerdings schon einen Präzedenzfall, bei Wikipedia. Das hat damals das WMF Board entschieden.
- Zum Bezahlen von Datenpflegern: Das scheint Google Research schon 2013 ausprobiert zu haben: "Unpaid users vs. hourly (oDesk) vs. piecemeal (Amazon Mechanical Turk)". Ergebnis: Die Freiwilligen sind besser (und billiger). Außerdem ist es nützlich, mehr über die Datenpfleger zu wissen ("Use a binary classifier, trained on features derived from user contribution history, to predict the probability the contribution is correct." "Use ad optimization system to figure out which kinds of users..." "Can we replicate the predictability of paid crowdsourcing in terms of attracting participation, while engaging unpaid users? And how can we identify and incentivize experts among these users, who match the needs of the application at hand?"[15]) --Atlasowa (Diskussion) 17:56, 9. Dez. 2015 (CET)
- Danke, interessant. Dass intrinsische Motivation eine andere Art und Qualität der Mitarbeit erzeugt, ist nachvollziehbar. Damit verbunden ist auch ein anderes Selbstwertgefühl. Wer ohne Bezahlung gibt, fühlt sich „reich“ („affective currency“), weil er etwas Wertvolles geben konnte, usw. Die Ökonomie, die aus "Playbor" resultiert, ist hinterfragbar: Every night, Knapp logs onto Wikipedia, where he’s averaged 385 daily edits over the past decade. He thinks he spends a comfortable 20-plus hours a week working on the site now, but he’s had a fair share of 16- or 18-hour days. Arguably, his work plays a large role in the $51 million in donations that Wikipedia scored last year — and also in the staggering $16.5 billion in revenue that Google reported in 2014. (Through its Knowledge Graph, which displays basic factual data and short answers to questions in search, Google leans heavily on Wikipedia’s unpaid editors.) And yet, though Knapp makes no salary, he claims he’s getting something a lot more valuable: entertainment. Knowledge. The chance to back his values and meet new people. “I understand that some people want to be paid to do what they love,” he said on the phone from Indianapolis, driving home from his (paid) job. “But when you put a number on the thing you love, it can’t be priceless. If you don’t put a number on it, you assign the value and the meaning to it, yourself — you don’t negotiate that with the market.” Sociologists call this kind of value “affective currency,” and it’s what keeps many of the social Web’s most prolific unpaid workers in the posting, moderating or editing game. Even when the time commitment becomes incredible — some would say insane — they argue they’re “compensated” accordingly, whether in pleasure or new knowledge or what Scholz calls their “15 megabytes of fame.” [...] Can something truly be called exploitative, or even labor, if the exploited parties enjoy it? That’s a difficult question and one that theorists haven’t conclusively answered yet.
- Die Frage ist, ob und wie man die Vorzüge intrinsischer Motivation mit sozialwirtschaftlicher Gerechtigkeit verbinden kann. Einmal ins Blaue gedacht – wenn jeder, der in den vergangenen 15 Jahren an Wikimedia-Projekten gearbeitet hat, aus heiterem Himmel 10 Cents für jeden in diesen Jahren getätigten Edit bekommen würde, bezahlt aus den Werbeeinnahmen, die die großen Internetplattformen aus ihrer Arbeit bezogen haben, würden sich die Leute freuen, weil der Wert ihrer Arbeit anerkannt wird? Oder würden sie meinen, dass das ihre Arbeit im Nachhinein vollkommen entwertet, weil damit der ursprüngliche Geist ihrer Teilnahme nachträglich mit schnödem Mammon „kontaminiert“ wird? Wie würde es die Motivation für zukünftige Arbeit beeinflussen? --Andreas JN466 11:46, 11. Dez. 2015 (CET)
Ein sehr guter Artikel, danke dafür! Durchaus problematische Dinge, die die Wikidata-Community ernst nehmen sollte (auch wenn es bei einigen meinungsstarken Community-Mitgliedern dort leider nicht danach aussieht). Eines der größten Probleme mit Wikidata ist IMO die Vorstellung, man könnte alle Aspekte eines jeden Themas in hübsche kleine, exakte Statements aufteilen und daraus später wieder problemlos inhaltlich völlig unproblematische Informationspakete über das Thema erstellen. Leider bleibt dabei aber fast immer der Kontext dieser Informationen völlig auf der Strecke. Das geht zwar bei diversen Dingen recht gut, aber etwa bei historischen Themen oder dort, wo es schwierig wird zwischen Fakt und Fiktion / Wahrheit oder Propaganda zu unterscheiden, wird es sehr schnell zu einem großen Problem. In Fließtexten wie etwa hier in WP-Artikeln kann man da dem uninformierten Leser ausführliche Erklärungen geben, um den Aussagen einen Kontext zu geben. Verlässt man sich dagegen nur auf Wikidata, geht dies leider verloren und Nutzer, denen diese Informationen vorgesetzt werden, werden u. U. sogar irregeführt. --95.89.234.7 16:26, 8. Dez. 2015 (CET)
Andreas: „The project has a dual purpose […] in particular, Wikidata is the designated successor to Google's Freebase, designed to deliver data for the Google Knowledge Graph.“ - Eine sehr streitbare These. --Succu (Diskussion) 00:07, 9. Dez. 2015 (CET)
- TU Dresden: „Im Dezember 2013 gab Google bekannt, seine eigene gemeinschaftlich editierte Wissensbasis Freebase zugunsten von Wikidata einzustellen, wodurch Wikidata auch eine wichtige Rolle als Quelle für den Google Knowledge Graph zukommt. Die Forschungsgruppe Knowledge Systems arbeitet eng mit dem Entwicklerteam von Wikidata zusammen und stellt zum Beispiel die Wikidata RDF-Exporte zur Verfügung.“
- Google: „When we publicly launched Freebase back in 2007, we thought of it as a "Wikipedia for structured data." So it shouldn't be surprising that we've been closely watching the Wikimedia Foundation's project Wikidata[1] since it launched about two years ago. We believe strongly in a robust community-driven effort to collect and curate structured knowledge about the world, but we now think we can serve that goal best by supporting Wikidata -- they’re growing fast, have an active community, and are better-suited to lead an open collaborative knowledge base. So we've decided to help transfer the data in Freebase to Wikidata, and in mid-2015 we’ll wind down the Freebase service as a standalone project. Freebase has also supported developer access to the data, so before we retire it, we’ll launch a new API for entity search powered by Google's Knowledge Graph. Loading Freebase into Wikidata as-is wouldn't meet the Wikidata community's guidelines for citation and sourcing of facts -- while a significant portion of the facts in Freebase came from Wikipedia itself, those facts were attributed to Wikipedia and not the actual original non-Wikipedia sources. So we’ll be launching a tool for Wikidata community members to match Freebase assertions to potential citations from either Google Search or our Knowledge Vault[2], so these individual facts can then be properly loaded to Wikidata. We believe this is the best first step we can take toward becoming a constructive participant in the Wikidata community, but we’ll look to continually evolve our role to support the goal of a comprehensive open database of common knowledge that anyone can use.“
- Search Engine Land: „Google is shutting down Freebase, its open source repository of facts that, in part, helps power the Google Knowledge Graph. Google announced the news today on Google+, saying: "We’ve decided to help transfer the data in Freebase to Wikidata, and in mid-2015 we’ll wind down the Freebase service as a standalone project." This means that the data won’t be lost but instead will be transferred to Wikimedia Foundation’s project Wikidata, which will have their own API to so that developers who want to retrieve facts automatically, as they did with Freebase, can still do so. This would include Google also pulling data from Wikidata, to help power its Knowledge Graph.“
- Interessant ist bei Google der Passus „Loading Freebase into Wikidata as-is wouldn't meet the Wikidata community's guidelines for citation and sourcing of facts -- while a significant portion of the facts in Freebase came from Wikipedia itself, those facts were attributed to Wikipedia and not the actual original non-Wikipedia sources.“ (Übersetzung: „Freebase-Inhalte so, wie sie sind, in Wikidata zu importieren würde nicht den Zitations- und Bequellungsrichtlinien der Wikidata-Gemeinde entsprechen – denn während ein wesentlicher Teil der Freebase-Daten aus Wikipedia selbst stammt, hatten diese Fakten eine Wikipedia-Quellenangabe, anstatt die ursprünglich in Wikipedia genannten externen Quellen anzugeben.“) Was Wikidata jetzt mit den Bot-Importen von Wikipedia macht, ist aber genau das, was Freebase auch gemacht hat: Wikipedia als Quelle zu nennen. Andreas JN466 04:07, 9. Dez. 2015 (CET)
- Zu Wikipedia als Quelle nennen: Ich arbeite momentan in WD an einem tool mit dem man auch halbautomatisch Quellen aus einer Infobox übernehmen (und bearbeiten) kann. Da ich auch WP-Autor bin, habe ich Erfahrung mit der Bequellung von Artikeln. Wenn ich Daten eines z.B. italienischen Sees bequellen will, würde ich eine de.sprachige Quelle bevorzugen, dann eine en.sprachige und zuletzt eine it.sprachige. Ich nehme an in anderen WPs würde man das ähnlich machen. Ich habe mir also für das tool überlegt wie man für eine WD-Aussage drei unterschiedliche Quellen unterbringen kann, um später im WP-Artikel die gewünschte Quelle auch wieder abholen zu können. "Importiert aus de.WP" kann für ein Lua-Modul der Hinweis sein, dass da meine de-Quellen drin sind. Gibt es diesen Hinweis nicht, schaue ich erst nach einem en- und dann nach einem it-Hinweis. Soll heißen, "importiert aus" ist meiner Meinung nach sehr nützlich und sollte mein diesbezüglicher Vorschlag im rfc berücksichtigt werden, fände ich das sehr gut. Jedenfalls werde ich mein tool dementsprechend programmieren. Momentan zeichnet sich im rfc ab, dass man zusätzlich zum "importiert aus" eine Zeitangabe will. Ob es mit der WP-api möglich wäre einen Link zu einer WP-Artikelversion zu setzen, weiß ich nicht. Müsste irgendwer mal ausprobieren. Goldzahn (Diskussion) 08:09, 9. Dez. 2015 (CET)
- Mir sind die Vorgänge um und zu Freebase bekannt. Deine sehr streitbare These lautet in meiner Lesart: Einer der beiden Hauptzwecke von WD war von Anfang an Freebase abzulösen. Tatsächlich? --Succu (Diskussion) 18:41, 9. Dez. 2015 (CET)
- @Succu, Du hast eine Situation, in der zwei Suchmaschinen (Google und Yandex) Gelder zum Projektstart beisteuern, zusammen mit dem Institut des Gründers von Microsoft, das ebenfalls eine der meistbenutzten Suchmaschinen betreibt. Die Vorstellung, dass da anfangs niemand an Suchmaschinen gedacht hat, erscheint mir beim allerbesten Willen nicht plausibel.
- Schon die erste Pressemitteilung sprach von externen Anwendungen: „Neben den Wikimedia-Projekten werden auch zahlreiche externe Anwendungen von den Daten profitieren. Mit Wikidata können Daten vernetzt und annotiert werden, was beispielsweise für wissenschaftliche und öffentliche Daten von großer Bedeutung ist. Die Wikidata-Inhalte werden unter einer freien Creative Commons-Lizenz veröffentlicht.“
- Markus Krötzsch hat mich auf der Mailingliste gefragt, ob ich denn Quellen dafür hätte, dass der Knowledge Graph Wikidata benutzen will. Als ich ihm mit einem Link auf eine Seite seiner eigenen Forschungsgruppe an der TU Dresden geantwortet habe, wo stand, dass „Wikidata auch eine wichtige Rolle als Quelle für den Google Knowledge Graph zukommt“, hat er diesen Nebensatz im Handumdrehen gelöscht. Vorher, nachher. Denny hat ebenfalls im Frühling 2015 im IRC Chat gesagt, dass Wikidata eine von mehreren Quellen für den Knowledge Graph sein wird. Sein Angestellten-Profil auf research.google.com sagt klipp und klar, "Denny works at the Google Knowledge Graph", gefolgt von der Google-Publikation „Wikidata: A Free Collaborative Knowledge Base“ und anderen Schriften zu Wikidata. Vielleicht hat irgend jemand mal daran gedacht, es wäre schön, ein Projekt für Interwikilinks zu haben und dort Infobox-Inhalte zu sammeln, aber der Suchmaschinenzusammenhang war doch wohl spätestens (denn dem müssen ja Gespäche vorangegangen sein) zu dem Zeitpunkt, wo das Geld von den Suchmaschinen eintraf und Denny anfing, für Googles Knowledge Graph zu arbeiten, ein integraler Bestandteil des Ganzen. --Andreas JN466 14:56, 10. Dez. 2015 (CET)
- Mir sind die Vorgänge um und zu Freebase bekannt. Deine sehr streitbare These lautet in meiner Lesart: Einer der beiden Hauptzwecke von WD war von Anfang an Freebase abzulösen. Tatsächlich? --Succu (Diskussion) 18:41, 9. Dez. 2015 (CET)
Als Seitenbemerkung: [16].--Mautpreller (Diskussion) 12:52, 10. Dez. 2015 (CET)
- Da mich @Jayen466: gebeten hat, als damaliger Disk-Teilnehmer nochmal was zu sagen.. ich habe jetzt nicht alles genau verfolgt, aber ich versuch nochmal meine Punkte anzumerken:
- Was Denny hier sagt, passt mE. nicht zu der Auffassung der europäischen Datenbankrechte. Dort ist es nämlich tatsächlich so, dass es nicht auf die Form der Datenbank ankommt, sondern lediglich, ob es eine strukturierte Anordnung von Datenelementen gibt - in dem Sinne wäre die Summe unserer Infoboxen durchaus bereits als Datenbank zu verstehen. Denny hätte Recht, wenn wir aus den Fließtexten händisch die Daten erst einzeln und mühsam raussuchen würden. Aber darum geht es ja mW. nicht, sondern darum, dass wir massiv die bereits aufbereiteten Daten aus den Infoboxen (und ggf. auch Listen-Artikeln) abgreifen. Meine grobe Idee an der Stelle wäre (aber das müsste man sicher mit einem Rechtsexperten noch erörtern), dass die Wikipedia-Projekte, die als Quelle für solche Übernahmen herhalten sollen, ein Meinungsbild veranstalten, wo die User einmal einem Prozedere oder Lizenzanpassung zustimmen, nach dem die Datenentahme unter einer ODbL-ähnlichen Lizenz gestattet wird und man dann als Attribution ähnlich wie bei OpenStreetMap "Wikipedia und Mitwirkende" angibt. Denn die Datenbankrechte sind ohnehin nicht an einzelne User, sondern an eine Gemeinschaft/Firma geknüpft.
- Wenn ich Dennys Standpunkt recht verstehe sagt er: WikiData ist ein US-Projekt und europäisches Recht interessiert daher für WikiData ohnehin nicht. Wenn das aber die Art und Weise ist, wie man innerhalb der Wikipedia mit der Arbeit anderer User umgeht, fänd ich das ziemlich beschämend. Und wenn ich jetzt noch lese, dass es da anscheinend von Anfang an eine Interessen-Überschneidung mit Google gab, dann scheint mir das jetzt irgendwie, als ginge es nur darum, die gesammelten Wikipedia-Daten möglichst schnell und einfach an Google zu verfüttern. Vielleicht ist das auch der Punkt wo sich WikiData und OpenStreetMap unterscheiden. OSM war strategisch in einer Situation, in der man dringend mehr Mitwirkende brauchte (entspr. Publicity über die ODbL-Lizenz und Festlegung, dass die ganze Arbeit nicht eines Tages unter einer geschlossenen Lizenz kommerzialisiert werden kann). Bei WikiData hingegen geht es ja mehr darum, die bereits vorhandenen Daten aus Wikipedia einfach zu verwerten, egal ob man damit jetzt die Wiki-Mitwirkenden motiviert.
- Ein weiteres wesentliches Problem ist mE. der Import von Fremddaten, die unter einer Share-Alike-Lizenz veröffentlicht werden. Zum Beispiel gibt es momentan in diversen Bundesländern OpenData-Portale, die aber fast alle eine ODbL oder CC-ähnliche Lizenz verwenden. Bei OpenStreetMap hat man mit diesen Dingen einige Erfahrung. Da hätte ich mir gewünscht, dass man von deren KnowHow hätte ein wenig mitnehmen können
- Das waren glaub ich so meine Punkte. --alexrk (Diskussion) 15:43, 12. Dez. 2015 (CET)
Deutschland ist Weltmeister
Glückwunsch zu dem unerwarteten internationalen Erfolg! Im Signpost wird demnächst ein interessanter Artikel über den Fotografen des Siegerfotos erscheinen.--Sinuhe20 (Diskussion) 21:29, 8. Dez. 2015 (CET)
- Auch Glückwunsch. Ein Hoch auf die Drohnenfotografie! Sie eröffnet im wahrsten Sinne vollkommen neue Perspektiven. Aber … nein, dies ist dennoch kein Plädoyer dafür, dass Wikimedia ein solches Gerät beschafft. --Aalfons (Diskussion) 22:22, 8. Dez. 2015 (CET)

- Ah, ein Foto des Solowezki-Klosters ist unter den Siegerbildern.
Nicht genug damit, dass die russ.-orthodoxe Kirche den ganzen Laden vereinnahmt für ihre Rede von der Märtyrerschaft der Rechtgläubigen in dunkler Zeit. Jetzt auch noch Postkartenkitsch. Persönlich find ich einen solchen Umgang mit historischen Motiven schlicht geschmacklos. Atomiccocktail (Diskussion) 12:14, 9. Dez. 2015 (CET)
- Ah, ein Foto des Solowezki-Klosters ist unter den Siegerbildern.
Ich halte die Auszeichnung als Sieger für ein Drohnenbild für äußerst kritisch. Für normale Menschen jenseits des machbaren. Was ist den die nächste Forderungsstufe, um wirklich auch nur eine Chance auf eine fordere Platzierung zu haben? Bilder aus der ISS? Grenzt den Kreis möglicher Kandidaten durchaus ein. Nichts gegen das wirklich gute Bild. Aber hier sollte es Sonderkategorien geben. Sonst wird eine solche Entscheidung spätestens mittelfristig eine Bürde für einen solchen Wettbewerb. Denn der soll inkludieren - nicht wie in der Form ausgrenzen. Marcus Cyron Reden 13:47, 9. Dez. 2015 (CET)
- Solch eine Drohne samt nicht allzu schrottiger Kleinkamera ist heutzutage billiger als das, was manche Wikiknipser als Minimalausstattung für sogenannte "Qualitätsbilder" erachten, also eine sogenannte "Vollformat"-Kamera mindestens mit Objektiven mit rotem, goldenen oder sonstwelchem Profi-Ring... -- Smial (Diskussion) 14:51, 9. Dez. 2015 (CET)
- Die prominente Platzierung von Bildern aus Deutschland ist natürlich zunächst erfreulich, aber ich habe angesichts der glatten Postkartenmotive von "schönen" Denkmälern Bauchschmerzen. Das bringt mich ein weiteres Mal zu dem Schluss, dass solche Topplatzierungen von deutschen WLM-Bildern im internationalen Wettbewerb nicht unbedingt erstrebenswert sind. --
 Nicola - Ming Klaaf 13:55, 9. Dez. 2015 (CET)
Nicola - Ming Klaaf 13:55, 9. Dez. 2015 (CET)
- Das wievielte Siegerbild vom Berliner Olympiastadion war das jetzt? Und @Nicola: Ich verstehe deinen Kommentar bzw. deine Argumentation nicht: Was ist nicht gut an Siegerbildern aus Deutschland? Die Motive sind zu „schön", die Bilder zu gut oder ist das allgemein irgendwie zuviel Deutschland …? *grübel* --Henriette (Diskussion) 14:35, 9. Dez. 2015 (CET)

- (BK) Wie man es macht - es ist falsch. Plazieren sich keine deutschen Bilder, dann hat die deutschsprachige Jury versagt. Plazieren sie sich, sind es zu schöne Postkartenmotive. Welch ein Glück, daß sich keine Fotoknipser durch Ausgrenzung von der Teilnahme abschrecken ließen. Oder durch Abschreckung ausgrenzen? Egal. -- Smial (Diskussion) 14:42, 9. Dez. 2015 (CET)
- (nach Bk): Mmh ... „Kloster doof“, „Drone doof“, „Olympiastadion doof“, „Deutschland doof“ - wie ich sehe, freuen sich alle ganz doll über die tollen Bilder; die Entscheidung, nicht mitzumachen, war also richtig, denn falls (!!) man gewonnen hätte wäre auch „Achim doof“ ... -- Achim Raschka (Diskussion) 14:43, 9. Dez. 2015 (CET)
- Sowieso
 --
-- Nicola - Ming Klaaf 14:50, 9. Dez. 2015 (CET)
Nicola - Ming Klaaf 14:50, 9. Dez. 2015 (CET)
- @Smial: Ich habe damit eigentlich nur die Meinung geäußert, die ich schon seit Jahren vertrete - dass nämlich der "internationale" Geschmack nicht der Leitfaden für de:WLM sein sollte. Aber das ist eben nur meine Meinung, andere mögen das anders sehen. Wäre sonst ja auch komisch. --
 Nicola - Ming Klaaf 14:54, 9. Dez. 2015 (CET)
Nicola - Ming Klaaf 14:54, 9. Dez. 2015 (CET)
- @Smial: Ich habe damit eigentlich nur die Meinung geäußert, die ich schon seit Jahren vertrete - dass nämlich der "internationale" Geschmack nicht der Leitfaden für de:WLM sein sollte. Aber das ist eben nur meine Meinung, andere mögen das anders sehen. Wäre sonst ja auch komisch. --
- @Achim: Einfach tapfer weiterknipsen, schauen, wo es Lücken gibt, und auf Wettbewerbe einen lassen. Es gibt noch viele Lücken, die man mit handwerklich halbwegs ordentlichen Fotos schließen könnte. Ganz ohne Bapperl, Orden oder anderem Klimbim. -- Smial (Diskussion) 14:58, 9. Dez. 2015 (CET)
- Sowieso
- @Achim: Ich habe nicht gesagt (und gemeint auch nicht!) „Olympiastadion doof“ – ich wundere mich darüber (nicht: urteile!!), daß gefühlt seit drei oder vier Jahren jedesmal ein neues Foto von diesem Stadion unter den Siegerfotos ist. Doof wie ich bin, denke ich halt, daß dieser Wettbewerb nicht immer nur noch schönere Fotos der 300 bekanntesten „schönen" Bauwerke hervorbringen sollte, sondern in erster Linie dem enzyklopädischen Ziel – in Form z. B. der fotografischen Sicherung noch nicht abgelichteter Objekte – dienen sollte. Ist meine Meinung – und die kann man gern doof finden! --Henriette (Diskussion) 15:13, 9. Dez. 2015 (CET)
- Tatsächlich ist das Olympiastadion zum ersten Mal dabei, überhaupt ist zum ersten Mal ein Foto aus Deutschland unter die ersten zehn gekommen. --Seewolf (Diskussion) 15:20, 9. Dez. 2015 (CET)
- Korrigiere: zum ersten Mal mehrere. Die Anhäuser Mauer hatte 2011 mal einen dritten Platz. --Seewolf (Diskussion) 15:22, 9. Dez. 2015 (CET)
- Ergänze: Und 2013 meine Wenigkeit den fünften. // Martin K. (Diskussion) 15:31, 9. Dez. 2015 (CET)
- Sorry, meine Schlampigkeit: Ich meinte den WLM-Ableger der de.WP! Da war mindestens im letzten Jahr (oder vorletzten??) auch das Stadion unter den Siegerbildern; und ich meine, daß es im letzten oder vorletzten Jahr eine Diskussion genau darum gab, warum Motive von schon x-mal abgelichteten Bauwerken immer wieder im Wettbewerb sind. Letztendlich ist mir das übrigens total latte: Ein schönes Foto ist ein schönes Foto. Ich habe nur (keine Ahnung warum) irgendwie eine andere Idee von Ziel und Zweck dieses Wettbewerbs (vielleicht sollte ich auch einfach endlich akzeptieren, daß ich damit gegen den Konsens laufe …). --Henriette (Diskussion) 15:58, 9. Dez. 2015 (CET)
- Ich hatte in diesem Jahr aber ein ähnliches Gefühl als ich die vollständige Liste der WLM-Top-100 für Deutschland gesehen habe. Spontan brach etwas wie "schon wieder die alten bekannten Motive" heraus. Für den beschränkten Bereich Hamburg habe ich dann beschlossen, mich nicht auf das Gefühl zu verlassen und mal ein wenig Daten zu sammeln. Aus der entstandenen Liste habe ich bisher zwar noch keine Diskussion abgeleitet, aber ich fühle mich darin bestätigt, dass sich prämierte Motive wiederholen und dass prämierte Motive auch Jahre nach der Veröffentlichung keine Nutzung in der WP haben. Angesichts der u.a. von Smial immer wieder angesprochenen Lücken ist das m.E. eine falsche Verwendung von Ausrüstung, Zeit und Fähigkeiten der Fotografen. Gruß --Dirts(c) (Diskussion) 08:46, 10. Dez. 2015 (CET)
- Sorry, meine Schlampigkeit: Ich meinte den WLM-Ableger der de.WP! Da war mindestens im letzten Jahr (oder vorletzten??) auch das Stadion unter den Siegerbildern; und ich meine, daß es im letzten oder vorletzten Jahr eine Diskussion genau darum gab, warum Motive von schon x-mal abgelichteten Bauwerken immer wieder im Wettbewerb sind. Letztendlich ist mir das übrigens total latte: Ein schönes Foto ist ein schönes Foto. Ich habe nur (keine Ahnung warum) irgendwie eine andere Idee von Ziel und Zweck dieses Wettbewerbs (vielleicht sollte ich auch einfach endlich akzeptieren, daß ich damit gegen den Konsens laufe …). --Henriette (Diskussion) 15:58, 9. Dez. 2015 (CET)
- Ergänze: Und 2013 meine Wenigkeit den fünften. // Martin K. (Diskussion) 15:31, 9. Dez. 2015 (CET)
- Korrigiere: zum ersten Mal mehrere. Die Anhäuser Mauer hatte 2011 mal einen dritten Platz. --Seewolf (Diskussion) 15:22, 9. Dez. 2015 (CET)
- Tatsächlich ist das Olympiastadion zum ersten Mal dabei, überhaupt ist zum ersten Mal ein Foto aus Deutschland unter die ersten zehn gekommen. --Seewolf (Diskussion) 15:20, 9. Dez. 2015 (CET)
- @Henriette: Es existieren trotz WLM immer noch reihenweise Baudenkmallisten mit großen Lücken in der Bebilderung, einfach weil kein Wikiknipser in der Nähe wohnt oder weil der Zugang vom öffentlichen Straßenraum nicht möglich ist oder aus welchen Gründen auch immer. Es nichtexistieren übrigens auch noch zahlreiche Listen. -- Smial (Diskussion) 15:27, 9. Dez. 2015 (CET)
(BK) Wir sind weder Weltmeister noch Papst. Gewonnen hat ein Bild eines Benutzer. (Und jetzt glühe ich schon mal die Kamera vor, Objektive mit rotem Ring sind in ausreichender Zahl vorhanden. Postkartenreife Bilder finde ich aber langweilig und würde sie Löschen, wenn ich sie gemacht hätte.)--Elektrofisch (Diskussion) 15:24, 9. Dez. 2015 (CET)
- Ich kann Dir inhaltlich nicht ganz folgen?! Und auch generell wüsste ich nicht wodurch genau sich ein Postkartenbild von anderen Bildern unterscheidet?! Ist Deine Ablehnung so zu verstehen, dass Du nur die Bilder nicht löschst, die nie jemand jemals auf eine Postkarte drucken wollen würde? // Martin K. (Diskussion) 15:31, 9. Dez. 2015 (CET)
- Mich langweilen Bilder, die in der Art einer Postkarte perfekt sind. Ich finde ihre Aussage generell zweifelhaft.--Elektrofisch (Diskussion) 16:02, 9. Dez. 2015 (CET)
- Wikipediabebilderung sollte generell sachlich und technisch akzeptabel daherkommen. Wenn sie darüberhinaus technisch sehr hohe Qualitätsansprüche befriedigt und auch noch ästhetisch ansprechend geknipst wurde, ist das kein Hindernis. Ich rede hier nicht von manipulativen Aufhybschungen. Aber man muß nicht hinter jedem Foto, das auch postkartentauglich wäre, gleich eine Verschwörung der Werbewirtschaft oder irgendwelcher Geheimbünde vermuten. -- Smial (Diskussion) 16:54, 9. Dez. 2015 (CET) (der den massiv zugenommen habenden Trend zu aggressiver Bildbearbeitung innerhalb der Wikipedia-Fotoabteilung freilich mit deutlichem Unbehagen beobachtet)
- @Smial: Woran machst Du diesen Trend fest? Nenn mal ein paar Beispiel (gerne auch aus der Reihe der Preisträger, wenn es da welche geben sollte). // Martin K. (Diskussion) 17:21, 9. Dez. 2015 (CET)
- Das würde an dieser Stelle zu weit führen. Beobachte einfach eine Weile com:qic oder com:fpc. -- Smial (Diskussion) 22:47, 9. Dez. 2015 (CET)
- @Smial: Woran machst Du diesen Trend fest? Nenn mal ein paar Beispiel (gerne auch aus der Reihe der Preisträger, wenn es da welche geben sollte). // Martin K. (Diskussion) 17:21, 9. Dez. 2015 (CET)
- Wikipediabebilderung sollte generell sachlich und technisch akzeptabel daherkommen. Wenn sie darüberhinaus technisch sehr hohe Qualitätsansprüche befriedigt und auch noch ästhetisch ansprechend geknipst wurde, ist das kein Hindernis. Ich rede hier nicht von manipulativen Aufhybschungen. Aber man muß nicht hinter jedem Foto, das auch postkartentauglich wäre, gleich eine Verschwörung der Werbewirtschaft oder irgendwelcher Geheimbünde vermuten. -- Smial (Diskussion) 16:54, 9. Dez. 2015 (CET) (der den massiv zugenommen habenden Trend zu aggressiver Bildbearbeitung innerhalb der Wikipedia-Fotoabteilung freilich mit deutlichem Unbehagen beobachtet)
- Mich langweilen Bilder, die in der Art einer Postkarte perfekt sind. Ich finde ihre Aussage generell zweifelhaft.--Elektrofisch (Diskussion) 16:02, 9. Dez. 2015 (CET)
- @Elektrofisch: Na dann begründe mal, was genau an diesen Bildern „zweifelhaft“ ist
- Was mindert aus Deiner Sicht ihren Wert für unsere Enzyklopädie?
- Wie sähe eine (aus Deiner Sicht) bessere Darstellung desselben Motivs (auf Commons gibt es ja ein paar Alternativen)?
- Ist ästhetisch grundsätzlich ein Mallus? Schließen sic „Schönheit“ oder „Gefälligkeit“ und (enzyklopädische) Funktionalität gegenseitig aus? Und wenn ja warum?
- Gilt das auch für die Featured Pictures auf Commons| und die Exzellenten Bidler hierzuwiki?
- // Martin K. (Diskussion) 17:21, 9. Dez. 2015 (CET)
- @Elektrofisch: Na dann begründe mal, was genau an diesen Bildern „zweifelhaft“ ist
- Auch mal ein Tag, den man sich im Kalender rot markieren kann: Die meisten mosern, nur Zietz gehört ausnahmsweise mal zu den wenigen, die nix zu beanstanden haben. Andererseits: An die überragende Windows-96-Ästhetik eines „Überarbeiten“-Bausteins kommt natürlich das beste Foto nicht ran. --Richard Zietz 17:20, 9. Dez. 2015 (CET)
- @Martin K. sie sind zu glatt zu getrimmt auf technische Brillianz. Das Leben und das mit ihm verbundene Chaos sind abwesend. Und diese Abwesenheit ist zentraler Teil der Bildaussage. Beim Rathaus wo sind die Menschen? Beim Olympiastadion: die Perspektive und der Bildaufbau sind der Geschichte des Ortes und der Fotos von ihm unangemessen. Der Leuchtturm sagt mir nix. Auch da fehlt Leben. Das ist kein Ort wo ich mich eingeladen fühle und ich neugierig auf mehr werde. Sacra di San Michele finde ich langweilig. Gibt es da kein modernes Leben? Den Buddakopf empfinde ich als billigen Ethnokitsch.
- Gegenfrage wozu sollen die Fotos denn gut sein? In welchen Artikeln was genau belegen?--Elektrofisch (Diskussion) 17:40, 9. Dez. 2015 (CET)
- Zum Thema „da fehlt Leben“: Dir ist schon bewusst, dass die Abwesenheit von Personen u.a. dem Recht am eigenen Bild geschuldet ist? Und dass das „Leben“ der Erkennbarkeit des Bildmotivs mit untererheblich abträglich sein kann, sieht man ja an derMasse der WLM-Fassadenaufnahmen mit den unvermeidlichen aber immer gleichen Ketten parkender Autos davor an. Bei welcher dieser Blechkollonen-Aufnahmen wäre denn ein solche photographische Auszeichnung zu rechtfertigen?!
- Das Olympiastadion finde ich (nicht nur weil ich den Photographen gut kenne) übrigens aus enzyklopädischer Sicht sehr gelungen, weil es mit den Feuerschale im Vordergrund genau den damals vorherrschenden neoklassizistischen und brutal symmetrischen Architekturstil visualisiert und zudem zeigt, dass sich auch die modernen Anbauten immer noch dieser Formensprache unterwerfen. Man muss das nicht mögen, aber das ist genauso eine historische Tatsache, wie das 1936 an dieser Schale der erste olympische Fackellauf endete.
- Ja, den Buddakopf kann man als Ethnokitsch ansehen. Aber da es ihn augenscheinlich vor Ort tatsächlich gibt, hat das durchaus seinen enzyklopädischen Wert. Von gephotoshopten Übertreibungen, wie z.B. dem Schwedischen Sieger ist das Gott sei Dank noch ein gutes Stück entfernt.
- Und das Du die dramatische Aufnahme der Sacra di San Michele „langweilig“ findest kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Ein ehemaliger Studienkollege von mir mach Matte Paintings für die Serie Game of Thrones – und die investieren viel zeit und Geld, um genau so was hinzubekommen. // Martin K. (Diskussion) 18:01, 9. Dez. 2015 (CET)
- Ach ja, zu Deiner Gegenfrage: Ich finde schon, dass obigen Aufnahmen dazu geeignet sind, Artikel wie Leuchtturm Westerheversand, Sacra di San Michele, Neues Rathaus, Olympiastadion Berlin oder auch Ficus zu illustrieren. // Martin K. (Diskussion) 18:15, 9. Dez. 2015 (CET)
- Das es den eben so gibt ist keine gute Begründung für ein gutes Foto. Fotos werden vom Fotografen konstruiert und mit dem Satz machst du den Fotografen zum Knipser. Von Feininger gab es mal den Satz das man bei bestimmten Motiven die zu schön sind besser darauf verzichtet ein Foto zu machen. Nebenbei das Motiv ist Dutzendware wie man mit Google leicht zeigen kann. Fehlt Leben bedeutet für mich nicht das Menschen da erkennbar drauf sein müssen. Ich kenne das Rathaus von Hannover von innen. Eine Langzeitaufnahme mit huschenden Personen (ok, auch nicht innovativ) wäre eine Möglichkeit zu zeigen das der Laden keine ausgestorbene menschenlose Architektur ist, es handelt sich immerhin um ein wichtiges Zentrum demokratischer Organisation. Ich achte bei Fotos von touristischen Attraktionen darauf, dass auch dieser Aspekt auf dem Motiv zu sehen ist, wenn ich den Lust auf ein solches Foto habe. Der Leuchtturm sieht aus wie aus der Becks oder Jever Werbung. Mag ich nicht. Auch da wären Ausflügler oder Tiere oder ... besser. Die Landschaft wird die nächsten 50 oder 100 Jahre nicht überleben, weil sie absaufen wird und das Bild sieht aus wie aus einem guten Katalog der Tourismusindustrie: glatt, geleckt, bunt mit netten Fotowölkchen ohne Leben. Dabei steht der Turm mitten in einer der biologisch sehr interessanten Landschaften. La Sacra ammantata sieht in der Tat aus wie ein Schauplatz aus einem besseren Fantasyfilm. Da frag ich wozu braucht WP das? Weder ist das Foto besonders instruktiv was die Architektur betrifft, noch zeigt das was ein Foto heute zeigen kann: Dazu wird das Ding derzeit genutzt. Beim Olympiabild bleib ich dabei, das kopiert zu exakt die Leni und das ohne erkennbaren Bruch. Ein kleiner Playmobiladolf - so als Idee - in den Vordergrund gestellt wäre da schon ein erfreulicher Bruch.--Elektrofisch (Diskussion) 19:55, 9. Dez. 2015 (CET)
- Das ist jetzt stellenweise schon sehr geschmäcklerisch. Außerdem ist das, was Du da vorschlägst leichter gesagt als getan. Einen Photographen würde ich jetzt bitten einfach mal eines seiner Bilder zu zeigen, dass diesen Kriterien gerecht wird. Aber Deiner Upload-Historie zur Folge scheinst Du ja keiner zu sein (jedenfalls nicht für die Wikipedia)...
- Deshalb nur soviel: Solche Forderung aufzustellen ist immer wesentlich einfacher als sie selbst am konkreten Motiv zu erfüllen. Und Gedenk der Bilder, die ich im Rahmen der Vorjury gesehen hab, bin ich mit dem Jury-Ergebnis doch recht zufrieden. // Martin K. (Diskussion) 20:17, 9. Dez. 2015 (CET)
- </quetsch>Geschmäcklerisch darf ich sein. Richtig, Forderungen aufstellen ist leicht, das macht die Forderungen aber - selbst wenn man sie sie selbst nicht umsetzen kann - nicht zu dummen Forderungen. Der Begründer der französischen Gastrokritik ist nie über ein Spiegelei hinaus gekommen. Meine Uploads hier (nunja etwas sonderbar da nachzuschlagen) sind eben Uploads hier. Ich verkaufe in anderem Zusammenhang ab und an Fotos und ich halte stark fotolastige Vorträge. Ich hab also durchaus eine Idee wie ich für meine Zwecke mit Fotos umgehe. Nun die oben machen mich nicht sonderlich an, müssen sie auch nicht oder?--Elektrofisch (Diskussion) 21:27, 9. Dez. 2015 (CET)
- Niemand ist gezwungen, Begeisterung für die Siegerbilder zu zeigen. Freilich steht der Vorwurf, menschenleere Szenen seien nicht realistisch und enzyklopädisch genug in einem knuffigen Gegensatz zu der Idee, ein gegebenes Motiv mit einem kleinen Plastik-Hitler aufzupeppen. -- Smial (Diskussion) 22:53, 9. Dez. 2015 (CET)
- </quetsch>Geschmäcklerisch darf ich sein. Richtig, Forderungen aufstellen ist leicht, das macht die Forderungen aber - selbst wenn man sie sie selbst nicht umsetzen kann - nicht zu dummen Forderungen. Der Begründer der französischen Gastrokritik ist nie über ein Spiegelei hinaus gekommen. Meine Uploads hier (nunja etwas sonderbar da nachzuschlagen) sind eben Uploads hier. Ich verkaufe in anderem Zusammenhang ab und an Fotos und ich halte stark fotolastige Vorträge. Ich hab also durchaus eine Idee wie ich für meine Zwecke mit Fotos umgehe. Nun die oben machen mich nicht sonderlich an, müssen sie auch nicht oder?--Elektrofisch (Diskussion) 21:27, 9. Dez. 2015 (CET)
- Mein erster Gedanke bei Platz 2 war ebenfalls: Da hat jemand einen Screenshot aus Skyrim eingesendet ;-) -- HilberTraum (d, m) 20:14, 9. Dez. 2015 (CET)
- Ähnlich wie das Foto des Berliner Stadions ist doch auch das Bild des Solowetzki zu sehen: Kitsch pur. Nichts, aber auch gar nichts wird transportiert von diesem Ort des Schreckens. Man kann entgegnen: "Eh Atomic, die Russen da oben, die machen das da aber so, das sieht jetzt doch so aus!" Tja, das sage ich nur: Geschichtsvergessenheit wird hier ästhetizistisch gedoppelt. Lang lebe Maxim Gorki, ein Hoch auf die personifizierte Lebenslüge. Atomiccocktail (Diskussion) 20:22, 9. Dez. 2015 (CET)
- Irgendwie finde ich das Paradigma etwas seltsam, dass Orte mit eine schrecklichen Geschichte zwangsläufig trist und bedrückend abgebildet werden müssen und alles andere Kitsch sei. Ob Ihr es glaubt oder nicht auch diese Zeiten waren nicht so schwarz-weiß wie sie auf den alten Photos in den Geschichtsbüchern aussehen und auch in Auschwitz und Buchenwald scheint im Sommer die Sonne, weht der Wind durch die Birken und auch dort leben heute Menschen, die das ihre Heimat nennen. Auch das gehört zu diesen Orten.
- So zu tun, als dürfe man solche Orte (vom Olympiatadion bis zum Gulag) nur trist und bei Regenwetter abbilden halte ich daher ehrlich gesagt genauso für Kitsch wie das Gegenteil. // Martin K. (Diskussion) 00:04, 10. Dez. 2015 (CET)
- @Martin K.: Ja, da ist sicher was dran. Der Postkarten-Kitsch des Kloster-Fotos hat mich sozusagen in eine gegenteilige Emotion getrieben, fast ein Ekel über eine derartige Geschichtsvergessenheit. Selbstverständlich scheint dort auch die Sonne, spannt sich an vielen Tagen über dem Gesamtensemble der blaue Himmel. Was ist aber der Kern dieser Klosteranlage? Eine lange und wechselvolle Geschichte. Eine, die mit großem Leid verbunden ist. Das fängt das Foto "mit keiner Silbe" ein. Das Brüchige des Solowetzki - gegründet als Ort der Gottsuche einerseits, Keimzelle eines Lagersystems mit Millionen von Opfern andererseits - ist das eigentlich Interessante. Hier eine Bildsprache zu finden, genau das ist die Herausforderung. Und diese ist gar nicht gesucht worden. Stattdessen ist ein Foto entstanden, das man in jeder Fremdenverkehrsbroschüre einsetzen kann, wenn man vom Gerüst am Turm absieht. Würde eine derartige Bildsprache in Artikeln dominieren, die Unternehmen oder ihre Produkte beschreiben, würde es hier mit Recht Widerstand geben gegen die Verwerblichung der Wikipedia, gegen die Kolonialisierung der WP durch Warenästhetik. Ein enzyklopädischer Standpunkt am Solowetzki ist: Nicht das Glatte ist interessant, sondern das in sich Differenzierte, das Widersprüchliche. Atomiccocktail (Diskussion) 07:13, 10. Dez. 2015 (CET)
- Wieso trist und bedrückend? Das Olympiastadion wurde von Frau Riefenstahl (bzw. ihren Untergebenen) im Sinne von Körper, Rasse, Raum und Volksgemeinschaft bildlich gestaltet. Wenn man das heute fotografiert, sollte man das anders machen oder genau so aber mit Bruch. Die Fallhöhe ist bei Riefenstahlschem Pathos ist hoch, die Nähe zur Lächerlichkeit gering. Ich glaub damit müsste man spielen, statt das nachzubauen.
- Was soll ein leeres Rathaus? Ein Haus aus dem die Bürger verbannt sind? Was die Werbebildsprache "Heimat und Tourismus" bei einem Leuchtturm? Was zeigt denn das Bild? Wo ist sein Vorteil gegenüber anderen Bildern. Es sieht schön aus, gut aber sonst? Was ist der enzyklopedingsische Mehrwert dieses Bildes?--Elektrofisch (Diskussion) 07:21, 10. Dez. 2015 (CET)
- Nochmal: In Deutschland gibt es das Recht am eigenen Bild. Und deshalb ist dieser reportagehafte Bildanmutung, die Dir da offenbar vorschwebt nur schwer zu realisieren. Ich will mir das Genöle gar nicht erst vorstellen, das es hier gäbe, wen all diese Bilder Langzeitbelichtungen mit bis zur Unkenntlichkeit verwischten Personen wären.
- Nebenbei bemerkt ist es in der Praxis echt schwer, so was halbwegs ästhetisch hinzubekommen. Damit die Person nicht total verstümmelt aussieht braucht man da einige Anläufe. Und wenn die Personen dann auch noch an irgendwelchen bildkompositorisch sinnvoll Stellen sein sollen, kommt man um eine regelrechte Inszenierung nicht drum rum. Und ich bezweifle sehr, ob so eine Inszenierung vom enzyklopädischen Standpunkt wünschenswert wäre. // Martin K. (Diskussion) 11:45, 10. Dez. 2015 (CET)

- @Elektrofisch: Nach dem, was Du da schreibst, sollte Dir eigentlich dieses Bild hier besser gefallen. Gleiches Motiv, gleicher Photograph, anderer Blickwinkel. // Martin K. (Diskussion) 00:43, 11. Dez. 2015 (CET)
- @Martin Kraft: Hm. Ich hab Google angeworfen. Suchbegriffe "Olympia Stadion Berlin Flamme" offensichtlich sprang da die Motivklingel bei einigen Fotografen an, was zu ähnlichen Kompositionen aus neuem Dach und alter Flamme führte. Mehrfach auch mit dieser Symetrie.[17] unter den Bildern hab ich welche gesucht, die ich trotz nackter Architektur besser finde. Ein Bild aus dem SternStern gefiel mir besser. Nicht der Himmel der ist etwas zu viel. Aber was mir daran gefallen hat, dass der Bildaufbau nicht ganz so feierlich, sakral, überhöht ist. Das Problem ist nicht eine "Entlarvung des Gigantimus". Mein Problem ist die Verlängerung der mystischen Inszenierung der Nazis. (Die Olympia und Parteitagsfilme hast du sicher gesehen.) Und ich finde die leistet das WP-Bild: Extremes Weitwinkel, abschneiden nicht sakraler Elemente, perspektivische und damit auch mystische Überhöhung. Das Stern Bild ist da (bis auf den Himmel) bescheidener: da ist ein provisorisch aufgestellte Absperrgitter zu sehen, auch noch lückenhaft und asymetrisch. Das holt das Bild sozusagen in die reale Welt zurück.--Elektrofisch (Diskussion) 20:14, 11. Dez. 2015 (CET)
- @Elektrofisch: Nach dem, was Du da schreibst, sollte Dir eigentlich dieses Bild hier besser gefallen. Gleiches Motiv, gleicher Photograph, anderer Blickwinkel. // Martin K. (Diskussion) 00:43, 11. Dez. 2015 (CET)
- @Elektrofisch: Zum Leuchtturm: Nahezu alle anderen Bilder dieses Turms auf commons entsprechen ebenso deiner eigenartigen Definition von Werbebildsprache. Dat Dingen sieht nun mal bei schönem Wetter so aus, wie es dort im Watt steht. Der Vorteil der kritisierten Aufnahme ist im Vergleich zu den anderen vorhandenen freien Bildern einfach zu erkennen, wenn man seine ideologischen Scheuklappen mal ablegtund richtig hinsieht: Es ist das einzige Foto nennenswerter Auflösung auf commons, das den Turm /komplett/ zeigt, ohne das irgendwas von irgendwas verdeckt wird. Mithin ein klarer Mehrwert. Gut, man könnte nun noch bemängeln, daß das Bild nicht gleichzeitig die andere Seite zeigt. Oder daß es nicht bei Sturmflut geknipst wurde. Im letzteren Fall wird sich aber sicherlich jemand finden, der die Überdramatisierung der örtlichen Situation bemängelt und ein neutraleres Bild fordert. Evtl. könnte man es mal mit Küstennebel versuchen? Ein, zwei Gläschen könnten helfen. -- Smial (Diskussion) 12:26, 10. Dez. 2015 (CET)
- @Marcus Cyron: WLM war bisher auch immer mit ein technischer Wettkampf. Wer hat denn schon mit einer günstigen Kompaktkamera noch eine Siegchance? Aber darum geht es ja nicht, ich denke Commons und Wikipedia können von Drohnenfotografie nur profitieren. Sie eröffnet völlig neue Perspektiven, erfordert aber einen entsprechenden Mehraufwand, der meiner Meinung nach auch belohnt werden sollte. Und der 5. Platz zeigt ja, dass man mit einfachen Mitteln und der richtigen Motivwahl immer noch gute Ergebnisse erzielen kann. --Sinuhe20 (Diskussion) 21:07, 9. Dez. 2015 (CET)
- Ich stimme Atomiccocktail zu. Deutschland ist ein Land voller alter Bauwunden, tragischer Orte, aber auch ein alter Industriestandort. Diese Charakteristiken unseres Landes kommen bei der Auswahl der Bilder kaum zum Tragen, und genau das finde ich bedauerlich. Stattdessen wird eine schöne Fassade inszeniert, und das kommt international an.
- Wohlgemerkt: Das eine sind die vielen "pragmatischen" Fotos, die dazu dienen, "einfache" Baudenkmäler zu dokumentieren, und da sind die Beiträge zu WLM nicht hoch genug einzuschätzen.
- Der Fotowettbewerb hingegen sollte sich nicht der touristischen Wohlfühlästhetik verpflichtet fühlen (Japaner lieben Neuschwanstein), sondern mehr Inhalt liefern. Dass nun solche Fotos international Anklang fanden, wundert mich nicht. --
 Nicola - Ming Klaaf 21:23, 9. Dez. 2015 (CET)
Nicola - Ming Klaaf 21:23, 9. Dez. 2015 (CET)
Ich hab mich über den ersten Platz wirklich gefreut. Obwohl nur 75km entfernt lebend, war ich noch nie dort. Da ist nämlich nur Gegend, und nichts weiter fotografisch interessantes. Und genau das zeigt das Foto durch das "Luftbild". Mitten in der Pampa gibt es was. Das nächste Kulturdenkmal ist vermutlich zig Kilometer entfernt.Gruss --Nightflyer (Diskussion) 22:22, 9. Dez. 2015 (CET)
- Ein kleiner Zwischenruf dazu: das kann ich auf Norddeutschland so nicht sitzen lassen. ;-) Das nächste Kulturdenkmal ist lt. Liste der Kulturdenkmale in Westerhever der Haubarg Süderdeich 4 und der ist lt. Onkel Gugel ungefähr 1,34 km Luftlinie entfernt. Also gar nicht mal so weit... --Dirts(c) (Diskussion) 23:22, 9. Dez. 2015 (CET)
- Korrektur meiner eigenen Aussage: ich meinte den Haubarg Süderdeich 2. ;-) Und mein Kommentar kann sehr gut als Illustration des Zweckes der Wikipedia verstanden werden: wir sammeln Wissen an einer zentralen Stelle und machen es in Text und Bild schnell zugänglich. Da kann man dann Aussagen wie "das nächste ... ist zig km entfernt" ganz einfach überprüfen. Im Idealfall sieht man auch noch ein Foto davon und kann sich viel besser das berüchtigte "Bild" machen. Wenn ich dann die WP noch weiter bemühe, hinterfrage ich auch schnell die Aussage "Da ist ... nur Gegend", weil ich über den Einstieg im Artikel zur Halbinsel Eiderstedt merke, dass die ganze "Gegend" ohne die menschliche Tätigkeit in den letzten 2000 Jahren ganz anders aussehen würde. Das nur als kurze Nebenbetrachtung dazu, was an der WP einfach absolut großartig ist, wozu alle hier ihren Teil beitragen (ob mit Fotos oder Texten), worauf man gelegentlich auch mal stolz sein darf und woran wir immer weiter arbeiten sollten (ob mit oder ohne Wettbewerbe). --Dirts(c) (Diskussion) 12:43, 10. Dez. 2015 (CET)

- Also, da gibt es noch mehr als Gegend! Deiche, Kohl, Schafe... -- Smial (Diskussion) 13:04, 10. Dez. 2015 (CET)
Frage

Eine Frage, ohne mich tief in die Regularien des Wettbewerbs eingearbeitet zu haben: Gibt es eigentlich die Möglichkeit, Bilder aus Ländern bzw. von Photographen aus Ländern zum Wettbewerb einzureichen, die NICHT über eine organisierte Autorenschaft verfügen? Ich denke da natürlich an Osttimor, wo ich inzwischen mehrere Dauerspender von Bildern habe. --JPF just another user 15:04, 9. Dez. 2015 (CET)
- Warum nicht - du müsstest einfach beim nächsten Mal die Sektion Osttimor eröffnen und eine Jury finden, der die Uploader natürlich nicht angehören sollten. Wir hatten ja auch mal die Antarktis als Teilnahmeland dabei. -- Achim Raschka (Diskussion) 15:07, 9. Dez. 2015 (CET)
- Ich sprach von einer NICHT existierenden Organisation der Autorenschaft. ;-) Für eine Jury kommen ja nur @MF-Warburg: und ich in Frage, aber dann geht es los mit der Frage nach Preisen und wie dann die Einreichung in den internationalen Wettbewerb erfolgt. Wenn es keinen Sammelwettbewerb für nicht repräsentierte Länder gibt, wie wäre es mit einer Adoption? Sofern zum Beispiel die deutschen Fotografen keine zusätzliche Konkurenz fürchten, könnte das einen Mehrgewinn für die Wikipedia insgesamt bedeuten. --JPF just another user 15:34, 9. Dez. 2015 (CET)
- Da es letzten Endes nicht darum geht, irgendwelche Photographen auszuzeichnen, sondern unser Projekt als ganzes voranzubringen, sollte eine größere Konkurrenz im Wettbewerb wirklich kein Gegenargument sein. In einer Idealen Welt würden wir so von unglaublich guten Photographen überrannt, dass wir gar nicht mehr wüssten, was wir alles auszeichnen sollten...
- Organisatorisch läuft das wie immer in der Wikipedia: Wenn's jemand mach, wird's gemacht. Wenn Ihr also Zeit und Motivation habt eine WLM-Section Osttimor ins Leben zu rufen, wüsste ich nicht, was dagegen spricht. Meines Wissens sind die nationalen WLM-section ja auch nicht an ein lokales Chapter geknüpft - das kann theoretisch jeder organisieren.
- Was die Preise angeht: Die wurden ja auch in Deutschland dieses Jahr teilweise von externen Sponsoren eingeworben (vielleicht gibt es ja ein paar Firmen oder NGOs, denen etwas an Osttimor liegt). Geldpreise könnte man entweder direkt bei der WMF beantragen (dafür sind die ja da) oder man bittet WMDE tatsächlich um so was wie eine Patenschaft (so riesig sind die Preisgelder ja i.d.R. nicht). Also: Nur zu! // Martin K. (Diskussion) 16:00, 9. Dez. 2015 (CET)
- Letzteres wäre eine Idee. Mit der Sektion müsste man gucken. Die Facebook-Gruppe hat ja immerhin >500 Mitglieder. Eine weitere Überlegung wäre eine Zusammenarbeit mit dem dortigen Telekommunikationsunternehmen... --JPF just another user 22:52, 9. Dez. 2015 (CET)
- @J. Patrick Fischer: Warum kämen für eine Jury nur MF-Warburg und du in Frage? Ich bin mir recht sicher, dass sich zwei, drei weitere Juroren finden ließen (so viele Bilder werden es ja im Vergleich zu Deutschland und Österreich nicht werden, nehme ich an?), die alle Fotos sichten und eine Top-10-Liste zusammenstellen. Fachkenntnisse zum Land sind ja nicht notwendig, um die Qualität von Fotos zu beurteilen.--Cirdan ± 10:51, 10. Dez. 2015 (CET)
- Waren halt die beiden, die mir einfielen mit der Kombination Wikipedia/Osttimor ;-) Aber ich denke, ich lese mich erstmal ein über die internationalen Bedingungen betreffs Motive, usw. --JPF just another user 13:45, 10. Dez. 2015 (CET)
- Motiv kann alles sein, was in irgendeiner Form unter Denkmalschutz steht.
- Es braucht natürlich jemanden in der Wettbewerbsorganisation, der sich ein bisschen mit Denkmalschutz in Osttimor auskennt, so dass nicht einfach irgendwelche Gebäude/Steine/usw. eingereicht werden. Aber die Jury bewertet allein die Fotos. Auch in Deutschland und Österreich haben die Jury-Mitglieder die meisten Denkmäler noch nie vorher gesehen und können sie auch nicht genau zuordnen (ein Fachwerkhaus sieht z.B. für Laien fast überall in Deutschland gleich aus).--Cirdan ± 14:00, 10. Dez. 2015 (CET)
- "Denkmalschutz" in Osttimor? Der war gut. ;-) Idealerweise kann man vielleicht das Ministerium für Tourismus, Kunst und Kultur mit ins Boot holen. Hmm..., ich versuche mal, ob meine Kontakte da hin reichen. --JPF just another user 14:04, 10. Dez. 2015 (CET)
- Motiv kann alles sein, was in irgendeiner Form unter Denkmalschutz steht.
- Waren halt die beiden, die mir einfielen mit der Kombination Wikipedia/Osttimor ;-) Aber ich denke, ich lese mich erstmal ein über die internationalen Bedingungen betreffs Motive, usw. --JPF just another user 13:45, 10. Dez. 2015 (CET)
- Ohne jetzt chauvinistisch klingen zu wollen:' Gibt es sowas wie „Denkmalschutz in Osttimor“ (also offizielle Denkmallisten, Bauvorschriften etc.) überhaupt? Osttimor ist ja noch ein ziemlich junger Staat – Und da könnte ich mir vorstellen, dass die erst mal anderes zu tun hatten, als den institutionalisierten Denkmalschutz zu organisieren?!
- Weil ohne offiziell anerkannte "cultural heritage monuments" wird's schwierig, den WLM Regularien zu entsprechen. Wenn es Euch vor allem darum geht, überhaupt mal Bildmaterial aus Osttimor zu akquirieren, wäre vielleicht ein von WLM unabhängiges Wiki Loves East Timor zielführender - oder? // Martin K. (Diskussion) 17:33, 10. Dez. 2015 (CET)
- Genau das ist die Frage, ob auch ohne nationaler Auszeichnung Bauwerke und Artefakte als Monumente gelten können. Bisher habe ich nur bei einigen Bauwerken in einer Gemeinde Schilder mit Informationen für Touristen gesehen, die eine Nummerierung der Sehenswürdigkeiten aufführten. Wirklichen Denkmalschutz nach deutschen Muster sehe ich nicht. Da wird gerade bei Renovierungsarbeiten sehr viel verändert und vor allem die Farbwahl dürfte so manchen deutschen Denkmalschützer zum weinen bringen, siehe Mercado Municipal (Baucau). :-D Das heißt ja nicht, dass es keine historischen Bauwerke gibt, aber welche Auswahl ist halt zulässig? Die neu gebaute Kirche? Die mindestens ein paar hundert Jahren alten Festungsanlagen? Ruinen von portugiesischen Bauten aus dem 20. Jhr.? "Wiki loves Earth" scheint es bisher auf internationaler Ebene für 2016 wohl nicht zu geben. Schade. Da ist natürlich die Idee eines WLET reizvoll, vielleicht auch eines globalen Wettbewerbs für Photos aus Ländern, die allgemein abseits stehen, mit erster Runde auf nationaler Ebene. Wiki loves unknown countries? Wiki loves the World? --JPF just another user 09:32, 11. Dez. 2015 (CET)
- Wegen der WLM-Regularien, kannst Du ja mal den kontaktieren, der es erfunden hat.
- Du hast schon Recht: Wie bei den vernachlässigten Krankheiten in der Medizin, haben wir hier in der WP ein Problem mit Ländern (neben Osttimor denk ich da z.B: an den Kosovo, Südsudan), die abseits der touristischen Mainstreams liegen. Da wäre so eine Art enzyklopädisches Entwicklungshilfe-Projekt echt sinnvoll. Sowas sollte ja eigentlich auch für die WMF ein wichtiges Thema sein. // Martin K. (Diskussion) 10:55, 11. Dez. 2015 (CET)
Kultursemiotische Essensforschung
Kennt jemand dieses Forschungsgebiet? Selbst Google findet nichts, so unwichtig ist dieses Spezialgebiet dieses Herren. Erinnert mich an die diverse Späße vermeintlich Hochgebildeter, mit denen sie dem doofen Bevölkerungsrest das Unwissen beweisen wollten. Der Text ist eigentlich lächerlich subjektiv, und beschreibt das Thema weder wissenschaftlich noch rezeptorisch genau. Da passt wohl auch das Urteil "Da er nicht weiter beachtet wurde, fanden seine Werke nicht einmal in Fachbibliotheken einen Stammplatz" - also Edit, jammer nicht, sondern akzeptiere einfach Deine Leidenschaft für skuriles Nischenwissen.Oliver S.Y. (Diskussion) 01:43, 10. Dez. 2015 (CET)
- wär ich mal besser Metzgermeister geworden. --Edith Wahr (Diskussion) 02:03, 10. Dez. 2015 (CET)
- Essen ist Ideologie - und nie war sie so wertvoll wie heute...:-) Schöner (und mal etwas anderer) Artikel by the way. --Felistoria (Diskussion) 02:11, 10. Dez. 2015 (CET)
- wär ich mal besser Metzgermeister geworden. --Edith Wahr (Diskussion) 02:03, 10. Dez. 2015 (CET)
- Nicht jedes Forschungsgebiet ist eine institutionalisierte Disziplin, die sich eigenständig in einer traditionellen Aufteilung von Wissensgebieten findet. Das ist schlicht ein deskriptiver Ausdruck für bestimmte Forschungsansätze, auf dessen Gebrauch andere auch verzichten mögen. Außerhalb von deutschen, fachphilosophischen Bibliotheken hat er im Übrigen freilich sehr wohl seinen Stammplatz. Indes sind die Mythologies kein Spaß, sondern Essays (nenn das ruhig subjektiv). --Chricho ¹ ² ³ 08:58, 10. Dez. 2015 (CET)
Wie die deutschsprachige Wikipedia ihre Reputation verspeist – ein Beispiel

Umseitiger Beitrag schließt mit den Worten „Gespannt, was das Leibniz-Jahr 2016 bringt: Eure Edith“. Die Lösung ist ganz klar: 52 Zähne! -- 32X 01:43, 10. Dez. 2015 (CET)
Ist das der unbeholfene Versuch, Zietz zu topp.. - äh, zu unterbieten? Marcus Cyron Reden 03:06, 10. Dez. 2015 (CET)
- Leibnitz ist eine Stadt in der Steiermark. --Regiomontanus (Diskussion) 03:44, 10. Dez. 2015 (CET)
- Ach, das ist doch alles nur Werbung für so'n völlig überteuerten Keksbäcker, der hier seine Bilder auf Commons abgeladen hat!--Aschmidt (Diskussion) 14:58, 10. Dez. 2015 (CET)
Der Artikel zeigt nur einen Fall einer in der Wikipedia immer weiter um sich greifenden "Unsitte" auf. Viele Fachbereiche fangen an sich einzuigeln. Bezüge von und zu anderen Fachbereichen werden konsequent abgelehnt und beseitigt. Bot die Wikipedia ursprünglich die Möglichkeit fachbereichsübergreifend Sachverhalte darzustellen und damit Verknüpfungen zu schaffen, werden diese Verknüpfungen in manchen Bereichen maximal als Link noch geduldet. Der Blick über den Tellerrand wird immer seltener gewagt. Liesel 07:19, 10. Dez. 2015 (CET)
- Hallo! Dem muß ich dann doch wiedersprechen. Es geht nicht um das Einigeln, sondern ich verstehe sowas eher als Versuche, das Thema Essen und Trinken zu banalisieren und als Skurilität zur Spielwiese für Wikifanten zu machen. Wenn sich hier jemand ernsthaft mit den kulturellen Aspekten des Gerichts befasst hätte, kein Problem. So ist das nur ein einzelnes Puzzlestück, dem jegliche fachliche Einordnung eines anderen Fachbereichs fehlt. Ich weiß, mancher hier will gern Legenden, Hintergründe, Entstehungsgeschichten hören. Aber genau diese "Interessierte" kneifen, wenn die Kritikerfraktion antritt, und uns Artikel in der Löschhölle zerscheisst, weil es ihren geistigen Ansprüchen nicht genügt. Mit Igel kann ich besser leben als mit Vergleichen wie Zerberus, es kommt aber aufs selbe raus, wenn man höhere Ansprüche an EuT-Artikel stellt als Küchenlexika und Kochbücher bedienen können, sollte man diese Ansprüche erstmal selbst an sich anlegen, und in der wiss. Fachliteratur nach Belegen für die eigene Auffassung forschen. Andere und ich bei EuT haben genug damit zu tun, die enz. bedeutsamen Fakten hinsichtlich der Zusammensetzung und Eigenschaften von solchen Standardgerichten zu ermitteln. „eine beschwörende, gegen die romantische Assoziierung von Sensibilität und Krankhaftigkeit gerichtete Handlung“ zu deuten: „In dieser Art der Zubereitung sind alle Keimzustände der Materie enthalten: der blutige Brei, das Schleimige des Eies, der ganze Zusammenklang weicher lebender Substanzen, ein bedeutungsvolles Kompendium der Bilder des Vorgeburtlichen." Der Kerl hat weder das Essen geliebt, noch sonst eine positive Einstellung zum Essen gehabt, als Franzose damit sicher nicht leicht zu leben. Jemand verglich es damit, daß eine Veganerkampagne Fleisch nicht abstoßender beschreiben könnte, was dem wohl nahe kommt, aber dann gehört der Abschnitt als Kritik überschrieben, und nicht als Kultur deklariert.Oliver S.Y. (Diskussion) 09:30, 10. Dez. 2015 (CET)
Das alles ist nichts weiter als der in diesem Projekt übliche und sattsam bekannte Konflikt mit den hier derzeit in bestimmten Fachbereichen dominierenden Platzhirschen. Und genau die haben die meiste Zeit vorm Rechner, das robustete Sitzfleisch und ergo die Deutungshoheit und den alleinigen Besitz der systemtypischen Wikipedia-Wahrheit erlangt. Was man dagegen tun kann, wenn man sich als Klügerer nicht zurückziehen will? Einkaufen von Vorräten, besonders Getränken, bequeme Kleidung, Lektüre für die Pausen und eine gute mentale Verfassung. Dann kann man die ultimative Dauersitzung zwecks Zermürbung des Gegners durch Diskussionsdauerpräsenz solange bis der Platzhirsch verduftet ist, in Angriff nehmen. Kann zwar dauern, aber wat mut dat mut. --Schlesinger schreib! 09:35, 10. Dez. 2015 (CET)
- Also ich beanspruche ja schon, einer dieser Platzhirsche zu sein^^, die Löschung und Kritik kam aber vom Benutzer:Ibram Gaunt, der nicht gerade als EuT-Platzhirsch bekannt ist, gelle? Und auch Deine These mit dem Sitzfleisch passt da nicht wirklich. Lesen bildet, also vieleicht nicht einem solchern Kurierbeitrag vertrauen, sondern einfach selbst schauen, wie die echte Geschichte dahinter ist. Besonders merkwürdig wird es, wenn man sieht [18], das Edith letztes Jahr selbst munter im Artikel löschte, ein Recht was er nun anderen abspricht, weils angeblich um Reputation geht? Das ist zumindest doppelzüngig. Und Schlesinger, wir beide haben eigentlich nur keine Konflikte, weil ich den Spruch mit dem Klügeren befolge, und Dir aus dem Weg gehe :P Oliver S.Y. (Diskussion) 09:46, 10. Dez. 2015 (CET)
- Ach, du gibst zu, der "EuT"-Platzhirsch zu sein? Das ist ja sowas von neu für uns, aber egal. Nett auch dein Hinweis auf das Lesen. Einer dieser beliebten Platzhirsch-Tricks, den Gegner für dumm zu verkaufen. Ich wünsche dir eine schöne Adventszeit und zum Fest einen guten Festtagsbraten. --Schlesinger schreib! 09:59, 10. Dez. 2015 (CET)
O mei. Der ultimative Brüller ist ja, dass Barthes' hübsche Deutung bei unseren Wikipedianern als Veganerpropaganda ankommt. Dabei ist sie grade das Gegenteil. Muss die "Mythen des Alltags" mal lesen, es würde mich interessieren, ob Freund Barthes zu anderen Gerichten was sagt (Tripes à la mode de Caen; meine Frau hat in Marseille mal "Hirn und Füße" vom Schaf gegessen, weiß nicht mehr, wie das auf Französisch hieß).--Mautpreller (Diskussion) 10:40, 10. Dez. 2015 (CET)
Das interessante an dieser Diskussion ist ja nicht der Umstand, ob jetzt die Feststellungen des Herrn Barthes in kultureller Sicht relevant sind oder nicht. Da halte ich mich mangels Kenntnissen zu Herrn Barthes heraus. Viel interessanter sind doch die Begründungen der Löschung: "Überflüssig und zudem ekelerregend.", "letztlich nichts weiter als plumpe Vegetarierpropaganda, um den Fleischverzehr zu vermiesen", "hat irgendein Honk die Löschung sofort wieder rückgängig gemacht", " der ganze Abschnitt ist nicht nur vulgär", "Leider hat solcherlei Schwärmerei und das daraus resultierende Geschreibsel keinen Platz in eine (sic!) Enzyklopädie". Es geht also gar nicht explizit um Herrn Barthes. Es wird hier eine Verschwörung der Vegetarier gewittert, die gegen den Fleischverzehr agitiert. Das ist ungefähr das gleiche Niveau wie bei den Hundeliebhaber die den Abschnitt Haushund#Fleischlieferant und den Artikel Hundefleisch auch gern verboten hätten.
Eine Google-Buch-Suche findet zumindest 310 mal die Verbindung "Barthes" und tartare. Ganz so irrelevant scheint also diese Bemerkung nicht zu sein. Liesel 10:50, 10. Dez. 2015 (CET)
- Vielleicht sollte man mal Hautgout lesen.--Mautpreller (Diskussion) 10:57, 10. Dez. 2015 (CET)
1. Ich find', das der Text von Edith ein schöner und kluger Essay ist – solch' gedrechselte Prosa läs ich gern öfter! 2. Und um Mautpreller zu zitieren: „O mei.” Die einen bereiten Nahrung zu, die anderen verzehren sie und die nächsten denken darüber nach (und dann gibts auch welche, die sie fotografieren oder darüber schreiben) … Hat alles seine Berechtigung. Und wer mit philosophischen Betrachtungen zum Tartare nix anfangen kann, der möge sich doch einfach darauf beschränken es zuzubereiten und/oder zu verspeisen. --Henriette (Diskussion) 11:01, 10. Dez. 2015 (CET)
- +1 Mich wundert eher, dass ein Klassiker der Kulturwissenschaft erst jetzt Eingang findet hier in Artikel. --Lorilo (Diskussion) 11:26, 10. Dez. 2015 (CET)
Ha, ich weiß wieder, wie es hieß: fr:Pieds paquets (wär doch ein schöner Artikel für EuT), und es war nicht Hirn und Füße, sondern Pansen und Füße. Mir war es zu heavy, obwohl ich für solche Sachen was übrig habe, aber die Szenerie war super, denn es riecht schon etwas streng, so dass an den Nachbartischen etwas komisch geguckt wurde; ihr hat es prima geschmeckt. So isses halt, die französische Küche hat den Sinnen allerhand zu bieten. Manchmal an der Grenze, aber das macht es interessant.--Mautpreller (Diskussion) 11:16, 10. Dez. 2015 (CET)
- Wenn es die Situation erfordert, isst man halt sowas. Dazu einen *sehr* gekühlten Vin de sable, und der Abend dürfte noch zu retten sein :-) --Schlesinger schreib! 11:26, 10. Dez. 2015 (CET)

- Tuberkulose, Lungensanatorium; Homosexualität, Strukturalismus, Veganität, und seine Frau Mama hat ihn anscheinend auch nicht genügend lieb gehabt: Klingt, was die Lebensgeschichte des guten Manns angeht, nach einem veritablen Enzyklopädie-Schocker. In Sachen Essen & Trinken indess vertraue ich – bin da leider ziemlich altbacken konstruiert – lieber den enzyklopädischen Beiträgen des Users Oliver S.Y.. Bon appetit --Richard Zietz 12:08, 10. Dez. 2015 (CET)
- Mensch Zietz, wie kommst Du auf Veganität? Äußerst unwahrscheinlich, würde ich sagen.--Mautpreller (Diskussion) 12:19, 10. Dez. 2015 (CET)
- Meinte eigentlich: Egalität ;-). --Richard Zietz 12:34, 10. Dez. 2015 (CET)
- Tsja, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, da kann er sich noch so viele Trikoloren auf die Benutzerseite kleben und die Bibliothèque nationale de France noch so viele Sonderausstellungen zum Barthes-Jahr ausrichten: Olivers Tellerrand bleibt, was Essen und Trinken angeht, das Maß aller Dinge. Damit müssen wir uns wohl abfinden. --Edith Wahr (Diskussion) 13:44, 10. Dez. 2015 (CET)
- „was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht“: Ich an deiner Stelle wäre mit den gewagten Unterstellungen mal lieber schön vorsichtig. --Richard Zietz 13:53, 10. Dez. 2015 (CET)
- Ist der Kurier nicht genau der richtige Ort für gewagte Unterstellungen und das Köcheln im eigenen Sud? Tellerrand brauchts dafür doch gar nicht mehr ;-) --Braveheart Welcome to Project Mayhem 13:55, 10. Dez. 2015 (CET)
- sagen wirs anders: es ist keine Schande, Barthes nicht zu kennen, ich hab ja auch noch nie ein Beefsteak tartare gegessen (dafür aber schon ein Meerschweinchen). Eine Schande finde ich aber, wie aggressiv nicht nur im diesem Artikel mutwillige Ignoranz vertreten & verteidigt wird. Daher ist das alte Sprichwort vom Bauern hier durchaus angebracht. Und jetzt alle: „Mein idealer Lebenszweck ist Borstenvieh, ist Schweinespeck...“ --Edith Wahr (Diskussion) 15:11, 10. Dez. 2015 (CET)
- Der, äh, Roma-und-Sinti-Baron singt: Ja, das Schreiben und das Lesen, ist nie mein Fach gewesen, denn schon von Kindesbeinen befasst' ich mich mit Schweinen... Ein Großwerk der Gattung, jawohl. --Schlesinger schreib! 19:17, 10. Dez. 2015 (CET)

- Ist der Kurier nicht genau der richtige Ort für gewagte Unterstellungen und das Köcheln im eigenen Sud? Tellerrand brauchts dafür doch gar nicht mehr ;-) --Braveheart Welcome to Project Mayhem 13:55, 10. Dez. 2015 (CET)
- Siehs mal so: Immerhin bestehen im Artikel Beefsteak knapp 2/3 des Fließtextes aus Barthes-Betrachtungen (übrigens eingebracht von einem gewissen „Jannemann“), wodurch der Artikel von einem Artikel über ein Fleischgericht quasi zu einem Artikel über „kultursemiotische Beefsteakforschung“ umfunktioniert wurde.
- Davon abgesehen klingt das, was dort steht, tatsächlich nicht wirklich nach Veganistenpropaganda, eher im Gegenteil... --Gretarsson (Diskussion) 14:03, 10. Dez. 2015 (CET)
- Yo, der Artikel wird dadurch schon etwas Barthes-lastig. Andererseits ist das der reizvollste Teil des sehr kurzen Artikels. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass unter Beefsteak nicht mehr geschrieben werden kann. Wenigstens ein Link zu Steak wäre angebracht (fehlt erstaunlicherweise), um etwas über die üblichen Zubereitungsweisen zu erfahren.--Mautpreller (Diskussion) 14:32, 10. Dez. 2015 (CET)
- Ich befürchte fast, dass in diesem Artikel eigentlich nicht viel mehr zum Beefsteak gesagt werden kann, als in den Artikeln Steak und Hacksteak schon steht. Im Grunde ist das eine extended BKL mit kulturphilosophischem Sahnehäubchen. Steak war verlinkt, allerdings im Absatz zu Barthes. Ich hab den Link jetzt mit konkreterem Ziel in die Einleitung gesetzt. Was vielleicht noch interessant zu wissen wäre ist, inwieweit Barthes das französische bifteck vom „amerikanischen Steak“ abgrenzt. In der fr.WP ist bifteck eine weiterleitung auf Steak. Allerdings hat der Artikel ein QS-Bapperl... --Gretarsson (Diskussion) 15:44, 10. Dez. 2015 (CET)
- oyvey, Barthes' düstere Prophezeiung von l'invasion des steaks américains ist also wahrgeworden, der Franzos hat mal wieder kampflos die Waffenn gestreckt und einen Artikel Steak frites angelegt. Das wird dem Zietz nicht gefallen. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! --Edith Wahr (Diskussion) 15:57, 10. Dez. 2015 (CET)
- Ich befürchte fast, dass in diesem Artikel eigentlich nicht viel mehr zum Beefsteak gesagt werden kann, als in den Artikeln Steak und Hacksteak schon steht. Im Grunde ist das eine extended BKL mit kulturphilosophischem Sahnehäubchen. Steak war verlinkt, allerdings im Absatz zu Barthes. Ich hab den Link jetzt mit konkreterem Ziel in die Einleitung gesetzt. Was vielleicht noch interessant zu wissen wäre ist, inwieweit Barthes das französische bifteck vom „amerikanischen Steak“ abgrenzt. In der fr.WP ist bifteck eine weiterleitung auf Steak. Allerdings hat der Artikel ein QS-Bapperl... --Gretarsson (Diskussion) 15:44, 10. Dez. 2015 (CET)
- Yo, der Artikel wird dadurch schon etwas Barthes-lastig. Andererseits ist das der reizvollste Teil des sehr kurzen Artikels. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass unter Beefsteak nicht mehr geschrieben werden kann. Wenigstens ein Link zu Steak wäre angebracht (fehlt erstaunlicherweise), um etwas über die üblichen Zubereitungsweisen zu erfahren.--Mautpreller (Diskussion) 14:32, 10. Dez. 2015 (CET)
- „was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht“: Ich an deiner Stelle wäre mit den gewagten Unterstellungen mal lieber schön vorsichtig. --Richard Zietz 13:53, 10. Dez. 2015 (CET)
- Tsja, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, da kann er sich noch so viele Trikoloren auf die Benutzerseite kleben und die Bibliothèque nationale de France noch so viele Sonderausstellungen zum Barthes-Jahr ausrichten: Olivers Tellerrand bleibt, was Essen und Trinken angeht, das Maß aller Dinge. Damit müssen wir uns wohl abfinden. --Edith Wahr (Diskussion) 13:44, 10. Dez. 2015 (CET)
- Meinte eigentlich: Egalität ;-). --Richard Zietz 12:34, 10. Dez. 2015 (CET)
- Mensch Zietz, wie kommst Du auf Veganität? Äußerst unwahrscheinlich, würde ich sagen.--Mautpreller (Diskussion) 12:19, 10. Dez. 2015 (CET)
- Tuberkulose, Lungensanatorium; Homosexualität, Strukturalismus, Veganität, und seine Frau Mama hat ihn anscheinend auch nicht genügend lieb gehabt: Klingt, was die Lebensgeschichte des guten Manns angeht, nach einem veritablen Enzyklopädie-Schocker. In Sachen Essen & Trinken indess vertraue ich – bin da leider ziemlich altbacken konstruiert – lieber den enzyklopädischen Beiträgen des Users Oliver S.Y.. Bon appetit --Richard Zietz 12:08, 10. Dez. 2015 (CET)
Ein schönes Thema, gibt es doch nur zwei Anlässe, bei denen sich Menschen (jenseits der Sexualität) so richtig nahekommen und sozialisieren: das gemeinsame Lachen und das gemeinsame Essen. Das soziale wollen wir nicht behandeln, gut, wenn wir aber auch noch das kommunikative Element entfernen, werden aus Speisen Nahrungsmittel, das Portal:Essen und Trinken banalisiert und profanisiert mit dem Verbot der kulturellen Betrachtung ein Wesensmerkmal der Speise, die neben dem Zugang von Wasser nicht nur lebensnotwendig, sondern (man bedenke den redistributiven Charctzer der Herrschaft in Mesopotamien) gesellschaftlich höchst relevant ist. Wenn unter Trauben und Haifischflossensuppe nur noch die Zubereitung aufgeführt wird, hat Wikipedia als Lexikon verloren. −Sargoth 14:14, 10. Dez. 2015 (CET)
- Nur der Hinweis, es geht nicht um Verbote, sondern daß hier mancher seine eigene Wassersuppe für so wichtig hält, daraus "kulturelle Aspekte" per Selbstdefinition zu finden. Es ist ein willkürlich herausgesuchtes Zitat, was an einen Artikel rangepappt wurde. Ohne die Andeutung einer Quellen, welche in irgendeiner Weise als "wissenschaftlich" betrachtet werden kann. Allgemein kannte ich es bislang so, daß derartige Texte als Primärquelle abgelehnt werden. Aber es ist ja nur Essen, drum gelten keine Regeln, spielen wir einfach mals Murkssuppe. Quelle 4 ist zB. eine solche gute Sekundärquelle über die kulturellen Hintergründen von Themen aus dem EuT-Bereich. Es gibt sie also, und man muß nicht seine persönliche Romantik von Ansichten über den pränatalen Fleischschleim auskosten.Oliver S.Y. (Diskussion) 16:19, 10. Dez. 2015 (CET)
- Barthes ist also Deiner Meinung nach "willkürlich herausgesucht" und ein Buch des Suhrkamp-Verlags keine Quelle, die in "irgendeiner Weise als wissenschaftlich betratet werden kann"? In dem Fall würde ich den ganzen Essen und Trinken - Bereich am besten direkt nach chefkoch.de auslagern. --RobNbaby (Diskussion) 16:52, 10. Dez. 2015 (CET)
- Sagen wir mal so: die Tatsache allein, dass jemand etwas in einer Veröffentlichung über ein relevantes Thema ausgesagt hat, macht die Aussage nicht unbedingt automatisch relevant für den betreffenden Artikel. Idealerweise sollten Wikipedianer die Bedeutung solcher Aussagen für ein Thema nicht selbst einschätzen, sondern diese Einschätzung erstmal Dritten verlassen. D.h. es wäre sinnvoll erstmal zu schauen, ob z. B. die Aussagen Barthes zu diesem Gericht bereits von Dritten rezipiert wurden. Gibt es also Veröffentlichungen, die auf Barthes Aussagen zum Gericht eingehen oder diese zumindest erwähnen? Aufgrund dieser Veröffentlichungen würde man dann Barthes Aussagen im Gericht-Artikel erwähnen, ergänzt z. B. um Zitate aus Barthes Essay. Ansonsten ginge eome asuführliche Erwähnung IMO eher ein bisschen in Richtung Trivia. --95.89.234.7 17:40, 10. Dez. 2015 (CET)
- Hmmm...wenn "jemand" Roland Barthes heißt, wäre es nicht unbedingt zu viel verlangt, einmal "barthes steak tatar" o.ä. bei GoogleScholar oder -Books einzugeben, um zu überprüfen, ob es da vielleicht doch ein bißchen Rezeption gab, bevor man die Bearbeitung mit blödsinnigen Bearbeitungskommentaren revertiert. Stattdessen wird revertiert, was man nicht auf anhieb versteht bis nur noch das übrigbleit, was man wahrscheinlich auch in einem mittelmäßigen Kochbuch nachlesen könnte. --RobNbaby (Diskussion) 19:25, 10. Dez. 2015 (CET)
- Und auch das ist dankenswerter Weise mal wieder ein Beweis für Euer verkanntes Bildungsbürgertum. Ihr wollt offenbar in der deutschsprachigen Wikipedia mit Euren Fremdsprachenkenntnissen protzen, weil das ja der doofe Rest nicht versteht. WP:Q nennt die Nachvollziehbarkeit von Wissen als ein Hauptmerkmal, naheliegend, das für de:WP damit Deutsch gemeint ist, auch wenn das mancher verachtet. Was die mittelmäßigen Kochbücher angeht, ich glaube nicht, daß Du überhaupt gute Kochbücher oder gar Küchenlexika kennst, über die Du so redest, ich besitze gleich mehrere davon, um deren Inhalt weiterzugeben. Und das ist vieleicht der Unterschied, einige wollen die Leute belehren, andere lediglich mitteilen, was als richtig in der Fachliteratur, und nicht irgendwo steht.Oliver S.Y. (Diskussion) 19:34, 10. Dez. 2015 (CET)
- Ich kenne wirklich nicht besonders viele Kochbücher - und eben weil das so ist, entferne ich nicht mal eben so Passagen, die mit einem Kochbuch belegt werden. Wenn man Barthes nicht kennt, ist es dagegen anscheinend gerechtfertigt, Abschnitte über ihn wegen Vegetarismus und Trivialität mal eben so zu revertieren. Weil halt Bildungsbürgertum und so(?) -RobNbaby (Diskussion) 20:43, 10. Dez. 2015 (CET)
- Schau Dir die Artikeldiskussion an, die Argumente stammen nicht von mir, ich teile sie nur. A) Es ist nur das Zitat einer einzelnen Person, keine Rezeption Kultureller Aspekte, wie der Abschnitt als Ziel hatte, B) Die Auswahl eine Philosophen als einziges Zitat ist weder neutral noch fachlich zu begründen, C) Der Leser wird mit dem abschreckenden Charakter dieses Zitats allein gelassen, für das keinerlei fachliche Einordnung oder Bewertung durch Dritte genannt werden. D) Beim Lesen des Artikels zur Person erfährt der Leser, daß diese für den Deutschen Literaturraum als unwesentlich erachtet wird. Das reicht für gewöhnlich, um einen umstrittenen Abschnitt zu entfernen, der ohne Konsenssuche eingefügt wurde.Oliver S.Y. (Diskussion) 20:51, 10. Dez. 2015 (CET)
- Punkt D) lasse ich einfach mal unkommentiert, da fehlen mir die Worte (Artikeleinleitungen sind halt manchmal nicht das nonplusultra, vor allem wenn sie Zitate enthalten), Punkt C) würde ich wiedersprechen, abschreckend ist für mich etwas anderes. Punkt B) könnte schwierig werden, da sich kaum jemand anderes mit Tatar als philosophischen Thema auseinandergesetzt haben dürfte - gerade deshalb gehört er in den Artikel. Punkt A) ist insofern berechtigt, dass das einzelne unkommentierte Zitat wirklich ein bißchen mager ist. Das rechtfertigt jedoch keine Löschung, sondern höchstens einen Ausbau. Nach der Aktion hier wird aber wohl sowieso keiner mehr Lust auf einen Artikelausbau haben. --RobNbaby (Diskussion) 21:04, 10. Dez. 2015 (CET)
- Schau Dir die Artikeldiskussion an, die Argumente stammen nicht von mir, ich teile sie nur. A) Es ist nur das Zitat einer einzelnen Person, keine Rezeption Kultureller Aspekte, wie der Abschnitt als Ziel hatte, B) Die Auswahl eine Philosophen als einziges Zitat ist weder neutral noch fachlich zu begründen, C) Der Leser wird mit dem abschreckenden Charakter dieses Zitats allein gelassen, für das keinerlei fachliche Einordnung oder Bewertung durch Dritte genannt werden. D) Beim Lesen des Artikels zur Person erfährt der Leser, daß diese für den Deutschen Literaturraum als unwesentlich erachtet wird. Das reicht für gewöhnlich, um einen umstrittenen Abschnitt zu entfernen, der ohne Konsenssuche eingefügt wurde.Oliver S.Y. (Diskussion) 20:51, 10. Dez. 2015 (CET)
- Ich kenne wirklich nicht besonders viele Kochbücher - und eben weil das so ist, entferne ich nicht mal eben so Passagen, die mit einem Kochbuch belegt werden. Wenn man Barthes nicht kennt, ist es dagegen anscheinend gerechtfertigt, Abschnitte über ihn wegen Vegetarismus und Trivialität mal eben so zu revertieren. Weil halt Bildungsbürgertum und so(?) -RobNbaby (Diskussion) 20:43, 10. Dez. 2015 (CET)
- Und auch das ist dankenswerter Weise mal wieder ein Beweis für Euer verkanntes Bildungsbürgertum. Ihr wollt offenbar in der deutschsprachigen Wikipedia mit Euren Fremdsprachenkenntnissen protzen, weil das ja der doofe Rest nicht versteht. WP:Q nennt die Nachvollziehbarkeit von Wissen als ein Hauptmerkmal, naheliegend, das für de:WP damit Deutsch gemeint ist, auch wenn das mancher verachtet. Was die mittelmäßigen Kochbücher angeht, ich glaube nicht, daß Du überhaupt gute Kochbücher oder gar Küchenlexika kennst, über die Du so redest, ich besitze gleich mehrere davon, um deren Inhalt weiterzugeben. Und das ist vieleicht der Unterschied, einige wollen die Leute belehren, andere lediglich mitteilen, was als richtig in der Fachliteratur, und nicht irgendwo steht.Oliver S.Y. (Diskussion) 19:34, 10. Dez. 2015 (CET)
- Hmmm...wenn "jemand" Roland Barthes heißt, wäre es nicht unbedingt zu viel verlangt, einmal "barthes steak tatar" o.ä. bei GoogleScholar oder -Books einzugeben, um zu überprüfen, ob es da vielleicht doch ein bißchen Rezeption gab, bevor man die Bearbeitung mit blödsinnigen Bearbeitungskommentaren revertiert. Stattdessen wird revertiert, was man nicht auf anhieb versteht bis nur noch das übrigbleit, was man wahrscheinlich auch in einem mittelmäßigen Kochbuch nachlesen könnte. --RobNbaby (Diskussion) 19:25, 10. Dez. 2015 (CET)
- Sagen wir mal so: die Tatsache allein, dass jemand etwas in einer Veröffentlichung über ein relevantes Thema ausgesagt hat, macht die Aussage nicht unbedingt automatisch relevant für den betreffenden Artikel. Idealerweise sollten Wikipedianer die Bedeutung solcher Aussagen für ein Thema nicht selbst einschätzen, sondern diese Einschätzung erstmal Dritten verlassen. D.h. es wäre sinnvoll erstmal zu schauen, ob z. B. die Aussagen Barthes zu diesem Gericht bereits von Dritten rezipiert wurden. Gibt es also Veröffentlichungen, die auf Barthes Aussagen zum Gericht eingehen oder diese zumindest erwähnen? Aufgrund dieser Veröffentlichungen würde man dann Barthes Aussagen im Gericht-Artikel erwähnen, ergänzt z. B. um Zitate aus Barthes Essay. Ansonsten ginge eome asuführliche Erwähnung IMO eher ein bisschen in Richtung Trivia. --95.89.234.7 17:40, 10. Dez. 2015 (CET)
- Barthes ist also Deiner Meinung nach "willkürlich herausgesucht" und ein Buch des Suhrkamp-Verlags keine Quelle, die in "irgendeiner Weise als wissenschaftlich betratet werden kann"? In dem Fall würde ich den ganzen Essen und Trinken - Bereich am besten direkt nach chefkoch.de auslagern. --RobNbaby (Diskussion) 16:52, 10. Dez. 2015 (CET)
- Nix gegen Petra Foede, aber Roland Barthes scheint mir doch noch ein kleines bisschen interessanter.--Mautpreller (Diskussion) 17:07, 10. Dez. 2015 (CET)
- ein ähnliches Spektakel spielte sich übrigens unlängst in Artikel und Diskussion zu „Bel paese“ ab, einem Oliver ist die Käsetheke einfach näher als die Bibliothek, und so kann man noch so oft Dante, Petrarca und die Encyclopedia Italiana aufführen, hilft alles nix, wenn der Oliver einfach ganz dolle die Augen zumacht und das nicht zur Kenntnis nehmen _will_. Das meine ich mit mutwilliger, aggressiv verteidigter, und flächendeckender Ignoranz. --Edith Wahr (Diskussion) 17:29, 10. Dez. 2015 (CET)
- Nix gegen Petra Foede, aber Roland Barthes scheint mir doch noch ein kleines bisschen interessanter.--Mautpreller (Diskussion) 17:07, 10. Dez. 2015 (CET)
- Ich würde ja den gemeinsamen Konsum berauschender Mittel und Substanzen in die Reihe aufnehmen. Einem Bayern kommt man ohne Bier nie nahe. Benedictus Levita (Diskussion) 16:23, 10. Dez. 2015 (CET)
- Leider noch etwas schlimmer, als von Oliver S.Y. beschrieben. Um die Chose zu verdeutlichen, ein kurzer Exkurs zur REWE-Wurstheke heute mittag unmittelbar nach diesem Edit. Eine der beiden Fachverkäuferinnen war sichtlich aufgebracht, zornig, verletzt. Ich war verdutzt, habe aber nicht nachgefragt. Im Gespräch mit ihrer Kollegin ergab sich dann allerdings die Situation. Eine Angehörige der Bionade-Ökomarkt-Bessergestellt-Fraktion (jedenfalls war die Klassenlage gut aus der Kommunikation der beiden Verkäuferinnen zu extrahieren) kurz vor mir hatte offensichtlich die So-Leute-wie-ich-stehen-meilenweit-über-so-einer-unbedarften-Gurke-wie-dir-aus-dem-einfachem-Volk-Nummer abgezogen und die gute Frau derart gedemütigt, dass sie noch bei meinem Eintreffen vor Wut kochte. Ebenfalls typisch – der herangezogene Anlass, mittels dem die Verhältnisse zwischen Herrschaft und Personal supermarkttechnisch klargestellt wurden: 155 Gramm statt – schneide bei der Wurst mal grammgenau – die erwünschten 150. 149 mit einer Scheibe weniger waren auch nicht okay; offensichtlich hatte die Waage nach Zugabe einer halben Wurstscheibe dann endlich die verlangten 150 Gramm angezeigt.
- Warum der kleine Exkurs an die Wursttheke? Erstens natürlich, weil die bildungsbürgerlichen Stände vom guten Leben zwar gern reden, die Nahrung als solche jedoch auffällig wenig wertschätzen (wie sein Epigone Barthes wortreich unter Beweis stellt). Zweitens sind bei den Edits und diversen Kleinscheiß-Edit Wars des User Edith Wahr sowohl Anlässe als auch Intentionen verblüffend ähnlich. Mit anderen Worten: Es geht meist ziemlich um Nothing. Wichtig hingegen ist, dass der User sich als akademisch beschlagener Geistescrack in Szene setzen und dem dummen Allgemeinwikipedianer seine Unbeschlagenheit und Trampeligkeit unter Beweis stellen kann. Die Mittel dazu bzw. Anlässe sind meist treffsicher und mit einer gewissen routinierten Erfahrung gewählt. Barthes beispielsweise ist zweifellos eine Quelle aus der akademischen Welt. Auch „amerikanisch“ (anstatt „US-amerikanisch“) ist genügend festgeklopft, wodurch sich der User fast stets auf der sicheren Seite wähnen kann. Bei anspruchsvolleren Interventionen zeigt dann eben der Literaturwissenschaftler dem Klempner, wo das Rohr liegt – auch wenn Ersterer noch nie einen Kanaldeckel von unten gesehen hat. Die Methode „Wahr“ eben. Gehen wir also davon aus, dass es hier um zwei Dinge geht: a) um soziale Rollenklarstellung, b) nicht ums Essen. --Richard Zietz 17:21, 10. Dez. 2015 (CET)
- Was lehrt uns das? Fleischesser haben ein interessanteres Leben als Fleischverächter. An der REWE-Obst- und Gemüseauslage passieren nie solche tollen Sachen! Und bei Milch und Käse isses auch total fad … :(( --Henriette (Diskussion) 17:39, 10. Dez. 2015 (CET)
- </quetsch> Ist was dran. Das letzte „aufregende“ Erlebnis bei den Milchprodukten in letzter Zeit war die Bitte einer älteren Frau, ihr doch vielleicht Joghoutprodukte aus dem obersten Regal herunterzureichen. Heute habe ich mich geärgert, weil seit Tagen (!!) kein Cola normal mehr verfügbar ist – stattdessen nur die Vanille-Plörre, Zero, eine neue Line mit einem pflanzlichen Süßstoff sowie Normalcola in 2-Liter-Leichtplastikflaschen (Wertung: super – für Leute, die auf Kohlensäure keinen Wert legen). Freundlicher Hinweis war angedacht; da jedoch kein(e) Mitarbeiter(in) in Sicht war, hab’ ich’s gelassen. Wo die Kommunikation sonst noch funzt, ist bei mir gemeinhin die Brottheke. Allerdings: Nachdem mein REWE den Subunternehmer gewechselt hat (oder umgekehrt), bin ich als klarer Anhänger der Weizen-und-Mehl-anstatt-Rogge-und-Dinkel-Linie zu einem anderen Brotdealer gewechselt. --Richard Zietz 18:02, 10. Dez. 2015 (CET)
- ich nehme an, Zietz würde gerne auf die altbewährte sowjetische Methode zurückgreifen und die Edith ins Arbeitslager schicken? Nunja, da bewahrheiten sich wohl einfach die weisen Worte von Karl Marx über „die Armut der Bauern: Ihr Produktionsfeld, die Parzelle, läßt in seiner Kultur keine Teilung der Arbeit zu, keine Anwendung der Wissenschaft, also keine Mannigfaltigkeit der Entwicklung, keine Verschiedenheit der Talente.“ ([19]). Mit sozialistischem Gruß: --Edith Wahr (Diskussion) 17:50, 10. Dez. 2015 (CET)
- Autsch. Marx im Grab hat vor ein paar Minuten gezuckt. --Richard Zietz 18:05, 10. Dez. 2015 (CET)
- „Dafür aber waren sie auch geistig tot, lebten nur für ihre kleinlichen Privatinteressen, für ihren Webstuhl und ihr Gärtchen und wußten nichts von der gewaltigen Bewegung, die draußen durch die Menschheit ging. Sie fühlten sich behaglich in ihrem stillen Pflanzenleben und wären ohne die industrielle Revolution nie herausgetreten aus dieser allerdings sehr romantisch-gemütlichen, aber doch eines Menschen unwürdigen Existenz. Sie waren eben keine Menschen“ (Friedrich Engels, Die Lage der arbeitenden Klasse in England). ¡Venceremos! --Edith Wahr (Diskussion) 18:22, 10. Dez. 2015 (CET)
- Friedrich Engels als Kritiker der bäuerlichen Lebensweise: Das war aber jetzt mal richtig gegeben. --Richard Zietz 18:58, 10. Dez. 2015 (CET)
- „Dafür aber waren sie auch geistig tot, lebten nur für ihre kleinlichen Privatinteressen, für ihren Webstuhl und ihr Gärtchen und wußten nichts von der gewaltigen Bewegung, die draußen durch die Menschheit ging. Sie fühlten sich behaglich in ihrem stillen Pflanzenleben und wären ohne die industrielle Revolution nie herausgetreten aus dieser allerdings sehr romantisch-gemütlichen, aber doch eines Menschen unwürdigen Existenz. Sie waren eben keine Menschen“ (Friedrich Engels, Die Lage der arbeitenden Klasse in England). ¡Venceremos! --Edith Wahr (Diskussion) 18:22, 10. Dez. 2015 (CET)
- Autsch. Marx im Grab hat vor ein paar Minuten gezuckt. --Richard Zietz 18:05, 10. Dez. 2015 (CET)
- Was lehrt uns das? Fleischesser haben ein interessanteres Leben als Fleischverächter. An der REWE-Obst- und Gemüseauslage passieren nie solche tollen Sachen! Und bei Milch und Käse isses auch total fad … :(( --Henriette (Diskussion) 17:39, 10. Dez. 2015 (CET)
Ach Leute, regt Euch doch nicht auf. Lest es, lächelt und esst einfach weiter. Wie pflegt doch der Volksmund - somit auch mein ungebildeter Schnudden - zu sagen? "Essen und trinken sind die drei schönsten Dinge im Leben." Also, schönen Abend allseits! --Unscheinbar (Diskussion) 17:38, 10. Dez. 2015 (CET)
- Ja klar ist Barthes ein Bildungsbürger. Na und? Geringschätzung der Nahrung und des guten Lebens lese ich aus seinem kleinen Kabinettstück über le bifteck et les frites allerdings gar nicht heraus, ganz im Gegenteil. Vielmehr nimmt er die alltägliche Kultur als Gegenstand ernst (keineswegs ohne Witz, aber eben doch: ernst), was gar nicht für alle seine Kollegen gilt. Was mich an der hiesigen Geschichte am meisten verblüfft, ist das augenblickliche Einrasten auf Klischees und Stereotypen. Geht offenbar nicht anders, Barthes = Bionade-Biedermeier. Wenn man den kurzen Essay oder auch nur das Zitat selber einigermaßen unbefangen auf sich wirken lässt, kann man da doch unmöglich Veganer-Propaganda rauslesen. - Lustig finde ich auch, damit jetzt das Thema (US-)amerikanisch zu verbinden. Redet man denn an der Fleischtheke beim Rewe von US-amerikanischem Rindfleisch? Ehrlich? Oder vielleicht beim Bäcker: bittschön zwei Nussecken und einen US-Amerikaner? Oder machen das die Klempner? - Ganz abgesehen davon: Wieso sollten sich Bildungsbürger nicht dazu bekennen, welche zu sein? Mir scheint es gerade ein ungeheuer bildungsbürgerlicher Zug zu sein, im "einfachen Volk" die Wahrheit zu suchen.--Mautpreller (Diskussion) 18:02, 10. Dez. 2015 (CET)
- „Wieso sollten sich Bildungsbürger nicht dazu bekennen, welche zu sein?” – möglicherweise deshalb, weil sie keine Lust darauf haben sich mit der „Stulle mit Margarine und ganz dick Fleischsalat drauf"-Franktion über Herrn Barthes' Reflexionen über bifteck et frites zu zanken? :)) --Henriette (Diskussion) 18:13, 10. Dez. 2015 (CET)
- Ja klar ist Barthes ein Bildungsbürger. Na und? Geringschätzung der Nahrung und des guten Lebens lese ich aus seinem kleinen Kabinettstück über le bifteck et les frites allerdings gar nicht heraus, ganz im Gegenteil. Vielmehr nimmt er die alltägliche Kultur als Gegenstand ernst (keineswegs ohne Witz, aber eben doch: ernst), was gar nicht für alle seine Kollegen gilt. Was mich an der hiesigen Geschichte am meisten verblüfft, ist das augenblickliche Einrasten auf Klischees und Stereotypen. Geht offenbar nicht anders, Barthes = Bionade-Biedermeier. Wenn man den kurzen Essay oder auch nur das Zitat selber einigermaßen unbefangen auf sich wirken lässt, kann man da doch unmöglich Veganer-Propaganda rauslesen. - Lustig finde ich auch, damit jetzt das Thema (US-)amerikanisch zu verbinden. Redet man denn an der Fleischtheke beim Rewe von US-amerikanischem Rindfleisch? Ehrlich? Oder vielleicht beim Bäcker: bittschön zwei Nussecken und einen US-Amerikaner? Oder machen das die Klempner? - Ganz abgesehen davon: Wieso sollten sich Bildungsbürger nicht dazu bekennen, welche zu sein? Mir scheint es gerade ein ungeheuer bildungsbürgerlicher Zug zu sein, im "einfachen Volk" die Wahrheit zu suchen.--Mautpreller (Diskussion) 18:02, 10. Dez. 2015 (CET)
- Danke Zietz, Du bringst es oben auf den Punkt. Die Frage ist hier eher, welcher elitäre Haufen sich zur selbstdefinierten Elite aufgeschwungen hat, und anderen erklären will, was einen Bildungsbürger ausmacht. In der Summe sind das nämlich erschreckend wenig Fakten, dafür wenige Beispiele, die solange künstlich aufgebläht werden, das daneben anderes verschwimmt. Und es warst glaube ich auch Du Henriette, welche führende Werke der Belletristik für nicht ausreichend fundiert erklärtest, um z.B. in der Literaturliste dem Leser lediglich angeboten zu werden. Wer hat von Euch Zolas Gesamtwerk gelesen? Oder zumindest Der Bauch von Paris, und nicht nur Nana und den Totschläger aus dem Schulunterricht? Dort wird zumindest die Entwicklung des realen Fortschritts im Einzelhandel Mitte des 19.Jh. beschrieben. Ohne das Werk zu kennen wird des aber als unwissenschaftlich abgelehnt. Oder den Caoba-Zyklus von B.Traven über die Mahagoniproduktion? Glaube niemand kommt da auf die Idee, den Biologistas Abschnitte über die "Kulturellen Aspekte" von Mahagoni auf dieser Basis in die Artikel zu schreiben. Aber bei Essen ist es zulässig, selbst ausgewählte Zitate reinzupappen? Das verstößt eigentlich gegen diverse Grundsätze unseres Projekts, was aber Bildungsbürger ganz gern in ihre Richtung interpretieren.Oliver S.Y. (Diskussion) 19:18, 10. Dez. 2015 (CET) PS - ohne Prolls wie meinereiner würden hier die Bildungsbürger wahrscheinlich die Speisekarten von ihrem Lieblingsbrunch abschreiben. Denn wenn ich lese, daß mancher das Gericht noch nie verzehrt hat, frage ich mich nach dem Grundverständnis enz. Arbeit, nachdem eher die Zubereitung einer Speise oder die Herstellung eines Stuhls wesentlich ist, und nicht der bloße Gebrauch.Oliver S.Y. (Diskussion) 19:21, 10. Dez. 2015 (CET)
- Die kulturellen Askpekte der Mahagoniproduktion wären sicher eine Bereicherung im entsprechenden Artikel. Auch wenn Traven als Romanautor sich schlecht mit Barthes vergleichen lässt. Warum werfen wir nicht Demokrit aus dem Artikel Atom raus? Diese Halluzinationen der ollen Griechen damals haben ja doch überhaupt nicht mit moderner Chemie zu tun! Und diese faulen Philosophen haben bestimmt nicht einmal selber gekocht! --RobNbaby (Diskussion) 19:36, 10. Dez. 2015 (CET)
- Oje, nu hamwers. Prolls und Bildungsbürger, die Sache ist geritzt, alles ist orntlich einsortiert. Wie unglaublich öde. Übrigens, Oliver, stimme ich Dir zu, dass die ("technische") Herstellung eines Werkstücks oder Gerichts für einen enzyklopädischen Artikel sehr wichtig ist. Genau dieses Rezept verfolge ich auch bei Literatur-Artikeln: Wie ist das Stück gemacht? Dagegen kann ich Dir gar nicht zustimmen bei der Verachtung des "bloßen Gebrauchs". Schließlich werden alle Werkstücke, ob Stühle, Romane oder Beefsteak Tatar, für den Gebrauch gemacht. Man weiß bloß oft nicht viel darüber, wie sie gebraucht werden, aber wo man es weiß, ist das unbedingt ein Thema. Dass Barthes kein "beliebiges Zitat" und auch keine "Belletristik" ist, braucht man doch hoffentlich nicht noch ein zehntes Mal zu sagen.--Mautpreller (Diskussion) 20:14, 10. Dez. 2015 (CET)
- Danke Zietz, Du bringst es oben auf den Punkt. Die Frage ist hier eher, welcher elitäre Haufen sich zur selbstdefinierten Elite aufgeschwungen hat, und anderen erklären will, was einen Bildungsbürger ausmacht. In der Summe sind das nämlich erschreckend wenig Fakten, dafür wenige Beispiele, die solange künstlich aufgebläht werden, das daneben anderes verschwimmt. Und es warst glaube ich auch Du Henriette, welche führende Werke der Belletristik für nicht ausreichend fundiert erklärtest, um z.B. in der Literaturliste dem Leser lediglich angeboten zu werden. Wer hat von Euch Zolas Gesamtwerk gelesen? Oder zumindest Der Bauch von Paris, und nicht nur Nana und den Totschläger aus dem Schulunterricht? Dort wird zumindest die Entwicklung des realen Fortschritts im Einzelhandel Mitte des 19.Jh. beschrieben. Ohne das Werk zu kennen wird des aber als unwissenschaftlich abgelehnt. Oder den Caoba-Zyklus von B.Traven über die Mahagoniproduktion? Glaube niemand kommt da auf die Idee, den Biologistas Abschnitte über die "Kulturellen Aspekte" von Mahagoni auf dieser Basis in die Artikel zu schreiben. Aber bei Essen ist es zulässig, selbst ausgewählte Zitate reinzupappen? Das verstößt eigentlich gegen diverse Grundsätze unseres Projekts, was aber Bildungsbürger ganz gern in ihre Richtung interpretieren.Oliver S.Y. (Diskussion) 19:18, 10. Dez. 2015 (CET) PS - ohne Prolls wie meinereiner würden hier die Bildungsbürger wahrscheinlich die Speisekarten von ihrem Lieblingsbrunch abschreiben. Denn wenn ich lese, daß mancher das Gericht noch nie verzehrt hat, frage ich mich nach dem Grundverständnis enz. Arbeit, nachdem eher die Zubereitung einer Speise oder die Herstellung eines Stuhls wesentlich ist, und nicht der bloße Gebrauch.Oliver S.Y. (Diskussion) 19:21, 10. Dez. 2015 (CET)
- Wer mich kennt weiß, daß es keine Verachtung des bloßen Gebrauchs ist :) - bin nun wirklich kein Kostverächter. Ich wäre froh, wenn wir hier über solche Details Artikel schreiben könnten, aber dann kommt die Holzhammerfraktion, und erschlägt uns mit WP:WWNI Punkt 9, da sind die Lexikaeinträge schon der Kompromiss. Also auf der einen Seite eingeschränkte Beschreibung für die Zubereitung, gleichzeitig so weitestgehende Toleranz gegenüber einem Einzelzitat, das ist der Widerspruch. Das mit dem Proll ist Ironie, ich hab auch nach höherem gestrebt, jedoch bleibt Koch mein Beruf, und das kommt von Berufung :) - Was Demokrit angeht, Rob, genau das ist doch hier das Vorbild, als Rezeption die Ansichten mehrere Experten zu einem Thema. Allgemein wird das für mich unter Rezeption, meinetwegen mit Kulturell als Eingrenzung, bezeichnet. Bei Atom wird ja auch die Entwicklung ausführlich gezeigt, etwas was uns auch verwehrt wird, da dies eben meist vermeintlich profane "Kochbücher" von XYZ sind, egal wie maßgeblich sie für ihre Epoche waren.Oliver S.Y. (Diskussion) 20:24, 10. Dez. 2015 (CET)
- Oliver S.Y.: Ich denke, Du hast jetzt hinreichend ausführlich dargestellt, daß Du mit Roland Barthes und einer kultursemiotischen Essensforschung nichts anfangen kannst (auf mehreren Ebenen). Das ist völlig OK. Die allermeisten Menschen können mit ausgesprochen vielen Dingen auf dieser Welt nichts anfangen (von Atomphysik bis Zebrafischzucht). Das Problem ist, daß Du den Menschen, die damit etwas anfangen und ganz gut einschätzen können ob es relevant, interessant oder – horribile dictu! – eine gute Ergänzung zu einem EuT-Artikel sein könnte, rundheraus absprichst das beurteilen zu können; schließlich weißt Du ja ganz genau, daß es nur irgendein Firlefanz ist. Beweis? „Selbst Google findet nichts, so unwichtig ist dieses Spezialgebiet dieses Herren.” (weia …) Wie wärs denn, wenn Du diesen Unfug mit „Proll vs. bildungsbürgerlicher Eierkopf" vergisst und den Eierköpfen das zugestehst, was Du völlig selbstverständlich für Dich einforderst: Jemandem die Kompetenz zutrauen und ihm zugestehen über Dinge sprechen und urteilen zu können? --Henriette (Diskussion) 21:15, 10. Dez. 2015 (CET)
- Henriette, verwechselst Du da mal wieder ein wenig die Fronten aus Deiner Antipathie gegen mich heraus? Den Artikel hier im Kurier hat Jannemann/EdithWahr verfasst, und versucht, Andersdenkende in einer Artikeldiskussion zu diffamieren! Benutzer:Ibram Gaunt sollte eher den Konterpart geben, macht er aber nicht. EW behauptet, durch unser Verhalten würden Ibram und ich die Reputation der Wikipedia beschädigen. Meinst wirklich, daß ich mir sowas gefallen lasse? Und wenn ich hier etliche Antworten lese, weiß ich, daß eine andere Meinung wie eben meine wichtig ist für die Vielfalt der Wikipedia, weil sie sonst in Eurer geistigen... endet. Nein, ich weiß nicht, was genau richtig ist. Das wissen WP:NPOV, WP:Q und WP:KTF aber ganz genau, und gelten hier seit einem Jahrzehnt für alle Artikel. Nur das Leute wie Jannemann und scheinbar auch Du den Anwendungsbereich genauso nach Gusto definieren, wie den Konsensgrundsatz, denn den willst Du hier umkehren, daß ich begründen muß, weshalb etwas entfernt wird, und nicht weshalb eine offensichtlich umstrittene Passage hinein soll. Wenn Barthes eine Meinung von vielen wäre, geschenkt, die aberwitzige Verehrung für ihn, welche "Ihr" hier jedem seiner Worte zugesteht ist dagegen wirklich erschreckend. Gibt übrigens einen sehr guten Artikel über die Mythen des Alltags, wirklich umfangreich, und seine Autoren haben meinen vollsten Respekt. Kann wirklich nicht entdecken, daß Lino Wirag und die anderen dort den Aspekt des Tatarzitats überhaupt einer Erwähnung wert fanden, und das ist für mich der wikiinterne Standard für Relevanz, nicht was Leute wie Du oder Edith meinen, welche zufällig auf das Thema stoßen. Übrigens war der eine Edit Jannemanns einziger Beitrag zum Thema vor einem Jahr, er hatte offenbar gar nicht vor, weitere "Kulturelle Aspekte" einzubauen.Oliver S.Y. (Diskussion) 21:47, 10. Dez. 2015 (CET)
Ich quetsche mich hier einfach mal dazwischen: Meine Meinung zur deutschen Wikipedia ist schlicht Resignation: Ich habe es satt, mich gegen bestimmte Schreiber - Wichtigtuer - zur Wehr zu setzen, die glauben, sie hätten die Alleinherrschaft über einen Artikel. Ich habe es satt, dass wegen jeder Änderung ein Editwar entsteht, etwa mit User [[20]] in [Artikel] über KIndergarten-Kram wie "Das Gunship" oder "Die Gunship". Dazu ist mir meine Zeit schlicht und ergreifend zu kostbar - im Übrigen bin ich der Meinung, dass die deutsche Wikipedia gerade wegen solchen unerträglichen Characteren unter extremem Qualitätsmangel leidet. Viele Artikel sind hoffnungslos scheiße, weil sich die, die Informationen beitragen könnten, wegen Kleinigkeiten und verstockten Egos in den Haaren liegen. Da ich nicht eine solche Laubenkolonie-Vorsitzender-Mentalität habe, habe ich das Schreiben hier auch weitestgehend eingestellt. Das nur als Antwort auf deine Erwähnung meinerseits, lieber [[21]]. Gruß --Ibram Gaunt (Diskussion) 22:37, 11. Dez. 2015 (CET)
- Oliver, ein Kommentar der mit einer Unterstellung beginnt („ … aus Deiner Antipathie gegen mich heraus”) wird von mir nicht gelesen. --Henriette (Diskussion) 21:58, 10. Dez. 2015 (CET)
- Ja, das ist eben das Grundproblem, Deine selektive Sichtweise. "Wie die deutschsprachige Wikipedia ihre Reputation verspeist" hälst Du nicht für eine Unterstellung, sonder wahrscheinlich eine faktenbasierte wissenschaftliche Analyse, und steigst deshalb in die Diskussion ein. Sicher alles Zufall, und kein grundsätzliches Problem zwischen uns.Oliver S.Y. (Diskussion) 22:20, 10. Dez. 2015 (CET)
- Ja, das ist eben mein Grundproblem: Leute die mich beleidigen und persönlich angreifen sind für mich keine Gesprächspartner. Würd' mich übrigens ehrlich wundern, wenn das bei dir anders wär … Damit EoD von mir. Ich habe kein Interesse an einer solchen fruchtlosen Konversation. Danke fürs Gespräch. --Henriette (Diskussion) 22:35, 10. Dez. 2015 (CET)
Vielleicht haben wir zwei verschiedene Kurierartikel gelesen. Alles Diffamierende in Edith Wahrs Artikel ist zitiert, nämlich aus der Artikeldiskussion, und man kann wirklich nicht behaupten, dass diese Zitate aus dem Zusammenhang gerissen oder gegen ihre eigentliche Intention verwendet würden. Wenns freilich um die Überschrift geht: Ja, det Janze ist rufschädigend. Man muss Barthes nicht kennen, aber wenn man schon drauf aufmerksam gemacht wird, könnte man ja mal auf den Trichter kommen, dass der auf dem Gebiet der Analyse von Alltagsmythen ungefähr so bedeutend ist wie Escoffier für die Birne Helene. Klar, rufschädigend ist das vor allem deshalb, weil die Schwerintellektuellen mit Barthes mehr anfangen können als mit Escoffier. Aber das setzt ja das Problem nicht außer Kraft, dass Urteile über etwas, was man gar nicht kennt, nicht so irre weiterführend sind. Ich glaube aber eh, dass im Kern etwas anderes dahintersteckt. Hier gehts ums "Fachliche", und das ist oft genug tödlich, aber erst recht hier in der Wikipedia. Es gäbe hier enorme Möglichkeiten für Interdisziplinarität, aber die kommt nur selten zu ihrem Recht (ist auch ne schwierige Sache). Nein, Fachvertreter tragen ihre Abgrenzungskämpfe hier oft noch unduldsamer aus, als es in der akademischen Wissenschaft der Fall ist. Dabei gibt es kaum einen Gegenstand, der nicht von mehreren "Fächern" aus sinnvoll betrachtet werden könnte. Du kämpfst für das Fach "Essen und Trinken" und seine Kategorien, Sitten und Begriffe. Nichts dagegen, gute Sache, weiter so. Wenn das aber heißt: Philosophen und Kulturwissenschaftler, Finger weg! Euern Kram will ich gar nicht wissen, hier ist EuT, da gehts nach unseren Regeln, dann wird eine große Chance verschenkt.--Mautpreller (Diskussion) 22:22, 10. Dez. 2015 (CET)
(BK) Aha, ihr seid ja immer noch zugange, jetzt also auf der persönlichen Ebene? Edith Wahrs Artikel im Kurier ist nichts weiter als eine kleine feuilletonistische Polemik, die an einem Beispiel unsere Betriebsblindheit und Beschränktheit beschreibt, und das zu recht. Sich darüber zu echauffieren ist ja hier völlig normal. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass viele von uns sich inselmäßig in ihrem Spezialbereich komfortabel eingerichtet haben und alles, was sich drumherum abspielt, nicht wahrnehmen wollen oder können. Kommt was von außen, wird reflexiv erstmal abgewehrt: Zu Hülf, ein Fremder wildert in meinem Revier! Im Zusammenhang mit der in dieser Community verbreiteten eingeschränkten selektiven Wahrnehmung, und der Angst Erreichtes, beispielsweise die Deutungshoheit in seinem Gebiet, wieder zu verlieren, könnte man das die zunehmende Verspießerung der Wikipedia-Community nennen. --Schlesinger schreib! 22:38, 10. Dez. 2015 (CET)
- Ich finde ebenfalls, dass eingeschränkte, selektive Freiheiten eine ganz tolle Sache sind. Barthes war Philosoph, Literaturkritiker und (Mit-)Begründer der kultursemiotischen Wissenschaftsrichtung – klar, dass seine Passage über Eiter, Blut und Schleim in einem Nahrungsmittel-Artikel da unabdingbar ist im Sinn unserer Leser und Leserinnen. Unabdingbar ist darüber hinaus Verständnis für die Tatsache, dass die Autor(inn)en des Fachportals Essen und Trinken nur auf eine stark verhaltene (also fast: heimliche) Weise über ihr Metier schreiben dürfen – Nahrungsmittelzubereitung und ähnlich banale Alltäglichkeiten. Der Grund liegt ja auch auf der Hand: Quellen sind da ja lediglich schnöde Kochbücher und ähnliche Anleitungen – anders als die post- oder prästrukturalistisch sich verbrämende Abkotzerei des Monsieur Barthes also „unwissenschaftliches“ Zeug. Allerdings schützen Wissenschaftlichkeit und Reputation keinesfalls davor, bei deutschen Wikifanten in Ungnade zu fallen. Wenden sich bekannte Autoren wie Traven oder Zola nämlich konkreten Fertigungsprozessen zu (anstatt wie es sich gehört dem theoretischen Elfenbeinturm), dann ist das – wie Oliver weiter oben anschaulich beschreibt – in de:WP ebenfalls unakzeptabel.
- Fazit: Gut, unterstützenswert und darum weitester Regelauslegung würdig sind für eine bestimmte Userfraktion offensichtlich vor allem solche Inhalte, die möglichst offensiv Unterschichtenverachtung zelebrieren und im Gegenzug eine dandyhafte, exklusive und elitäre Mittelstands-Selbstkasteiungsideologie propagieren. Offensichtlich ist in den einschlägigen Themen-Treffpunkten nichts mehr zu holen. Weshalb man mit seinen exklusiven „Erkenntnissen“ nunmehr möglichst viele andere Artikel fremdbestimmen will und den Fachautor(innen) dort nunmehr möglichst nachhaltig auf die Nerven geht. POV ist das natürlich nicht. Prolls haben in einem Lexikon einfach nichts zu suchen; da muß man die Hinweise, dass die Veranstaltung hier nur eine für die wahre Elite ist, notfalls etwas nachhaltiger platzieren. --Richard Zietz 23:41, 10. Dez. 2015 (CET)
- Darauf eine Biedermeier-Bionade. Prost! Bzw. verstehe ich nicht warum Leute, die so derart unter ihrem Unwissen leiden, daß sie keinen anderen Ausweg wissen als klügere Menschen für ihre Klugheit zu beschimpfen nicht das Naheliegendste tun: Ihren Mangel an Bildung durch Lektüre unserer vortrefflichen Enzyklopädie beseitigen. --Henriette (Diskussion) 08:09, 11. Dez. 2015 (CET)
- Magst Du nicht mal dieses durchsichtige Spielchen mit der Proll-Identität beenden, Richard? Wie ich schon oben schrieb, gerade dieses Spielchen beherrschen insbesondere die Bildungsbürger virtuos, niemand kann Intellektuellenschelte so schön inszenieren wie bildungsbürgerliche Intellektuelle, aber es führt nicht weiter. Vor allem bringt es Dich dazu, Sachen zu behaupten, die einfach nicht stimmen. Zum Beispiel: Von Eiter war nicht die Rede (ist aber auch schon egal, nicht?). Ich habe hier bislang von niemandem gelesen, dass man nicht Kochbücher für das Thema "Essen" verwenden dürfe, und mir wäre auch nicht bekannt, dass einer der Autoren etwas gegen die Verwendung von Traven und Zola hätte; wenn wer das vertritt, solltest Du den angreifen und nicht welche, die das gar nicht tun. Barthes' Essay ist keine "Abkotzerei", so könnte man eher die Ergüsse auf der Diskussionsseite des Artikels Tatar nennen, die Edith im Kurierartikel zitiert. Die nämlich waren, wie leicht erkennbar, der Anlass für den Kurierartikel. Der größte Blödsinn ist es jedoch, dass "Inhalte" wie die von Barthes für "Zelebrierung offensiver Unterschichtenverachtung" und "elitäre Mittelstands-Selbstkasteiungsideologie" stünden. Klingt ja toll, hier reißt Dich der eigene Schwung mit, ist aber leider gar nichts dran.--Mautpreller (Diskussion) 10:18, 11. Dez. 2015 (CET) PS: Es sind seit jeher die Intellektuellen, die Intellektuelle Intellektuelle schimpfen.
Was wir aus dieser Diskussion lernen
- Zietz kann nicht mit Edith und versucht ihr jetzt gewaltig ans Bein zu pissen. Etwaige Kollateralschaden am Enzyklopädieprojekt werden billigend in Kauf genommen. Wichtig ist ja allein der Krieg gegen Edith.
- Wer für Edith ist in den Augen von Zietz sein Feind und wer gegen Edith ist sein Freund.
- Oliver hat sich weit aus dem Fenster gelehnt, als er Barthes aus dem Artikel werfen wollte. Nachdem es jetzt Aufklärung gab, fällt es im schwer einen Schritt zurück zu tun und seinen Fehler einzugestehen.
= Kindergarten. Liesel 07:51, 11. Dez. 2015 (CET)
- Ich denke, der Fehler bei Oliver liegt eher darin, dass er und eine Reihe Kolleg(inn)en in den Fachportalen bislang nicht recht realisiert haben, dass Enzyklopädiearbeit hier mittlerweile nur noch mit Unterstützung einer flankierenden Security möglich ist. Die es nicht gibt – womit sich der unglückselige Kreis leider wieder schließt. --Richard Zietz 08:21, 11. Dez. 2015 (CET)
- Wir lernen vor allen Dingen daraus, dass eine kollaborative Artikelarbeit, die hier jahrelang für det Jelbe vom Ei gehalten wurde, nur noch in nach außen verschlossen Kleingrüppchen möglich ist, oder gar nicht. Wir bekommen dann eben eine Wikipedia der eingeigelten solistisch agierenden Alpha-Autoren mit enormen Kommunikationsdefiziten, einer ausgeprägten Besserwisserei und der sattsam bekannten Rechthaberei. Aber das macht nichts. --Schlesinger schreib! 08:46, 11. Dez. 2015 (CET)
- Ich denke, der Fehler bei Oliver liegt eher darin, dass er und eine Reihe Kolleg(inn)en in den Fachportalen bislang nicht recht realisiert haben, dass Enzyklopädiearbeit hier mittlerweile nur noch mit Unterstützung einer flankierenden Security möglich ist. Die es nicht gibt – womit sich der unglückselige Kreis leider wieder schließt. --Richard Zietz 08:21, 11. Dez. 2015 (CET)
- Liesel, vor allem sehe ich mal wieder bestätigt, daß Du hier einfach nur provozieren willst, egal im Kenntnis oder Unkenntnis der Fakten. Vieleicht schaust einfach nochmal in die Versionsgeschichte von Artikel und Disk. Das Thema war letztes Jahr gegessen, da es 1:1 stand, habe ich Jannemann nicht revertiert, ganz normaler Vorgang in der Artikelarbeit. Mit der IP und Ibram Gaunt stand es dann jedoch 3:1 gegen die Aufnahme in den Artikel. Klassischer Fall, wo der Benutzer, welcher einen Text im Artikel haben will dafür eine Mehrheit auf der Artikeldisk suchen muss. Das fand Edith nicht, weshalb er hier zum den Kurierartikel schrieb, um in einer Artikeldiskussion zu obsiegen. Egal um welches Thema es geht, solches Verhalten ist einfach zum Erbrechen, und wenn es nicht der Kuscheljannemann mit seinen Beziehungen wäre, hätte sich hier auch nicht soviel Beistand gefunden. Du kritisierst Zietz Engagement, was haben Leute wie Henriette oder Schlesinger mit dem Thema Essen am Hut, für gewöhnlich extrem wenig, außer es geht gegen mich, dann sind erstaunlich viele Leute dabei. Dann gilt für mich der alte Frundsberg, Danke für die Aufmerksamkeit.Oliver S.Y. (Diskussion) 10:38, 11. Dez. 2015 (CET)
- Artikeldiskussionen sollten aber auch mit halbwegs treffenden Argumenten geführt werden. Ist es denn ein treffendes Argument, Barthes' Essay als "plumpe Vegetarierpropaganda" zu bezeichnen, "um den Fleischverzehr zu vermiesen"? "Vulgär", "Geschreibsel", "Kaiser von China". Das ist doch Unfug, sorry.--Mautpreller (Diskussion) 10:48, 11. Dez. 2015 (CET)
- Ich will hier gar nicht provozieren. Ich habe nur die Diskussion gelesen und festgestellt, dass das ich will ein mal sagen "merkwürdige" Begründungen kommen. Das diese dir zuspielen ---> geschenkt. Genauso könnte ich jetzt hingehen und einen Löschantrag auf Hundefleisch oder Pferdefleisch wegen "Ekelhaft" stellen. "Pfui" ist nun mal kein Löschgrund weder von Artikeln noch einzelnen Artikelinhalten.
- Aber du solltest zugeben, dass du Herrn Barthes nicht kanntest und einfach annahmst, ist halt irgendein irrelevanter Franzose. Ok, jeder macht mal Fehler. Man sollte aber auch dazu stehen.
- Es ist außerdem falsch, dass es gegen dich geht. Es geht mir um den Artikel. Liesel 11:05, 11. Dez. 2015 (CET)
- „ … was haben Leute wie Henriette oder Schlesinger mit dem Thema Essen am Hut, für gewöhnlich extrem wenig” – nun ich esse täglich und koche recht häufig. Enzyklopädisch bin ich in dem Thema tatsächlich nicht unterwegs. Warum? Weil ich weiß, daß es in WP eine ganze Menge Leute gibt, die von der enzyklopädischen Annäherung an ein EuT-Thema sehr viel mehr verstehen als ich. Ich hab' halt deutlich mehr Ahnung von Kulturanthropologie, als von regionalen Wurst-Variäten – wenn das ein Fehler ist … naja, ich kann damit leben. --Henriette (Diskussion) 11:41, 11. Dez. 2015 (CET)
- Kulturwas?! Deutsche Wurst. Alles andere ist Käse. --JosFritz (Diskussion) 11:50, 11. Dez. 2015 (CET)
- Wurst ist mir wurst! ;) --Henriette (Diskussion) 11:58, 11. Dez. 2015 (CET)
- Aber Käse ist nicht unbedingt Käse ;-). --Richard Zietz 14:35, 11. Dez. 2015 (CET)
- Liesels erste Arbeitshypothese könnte man ja mal empirisch testen: nach meiner Zählung hat Zietz in den vergangenen 10 Tagen exakt 58 Beiträge hier geleistet, von denen sich 54 unmittelbar oder mittelbar mit meiner Person beschäftigen. Mein erster Gedanke war ja, dass er „eine herzliche, fast schon teenagerhafte Vernarrtheit“ zu mir an den Tag legt, sich womöglich meine Beiträge ausdruckt und übers Bett hängt, tatsächlich scheint er mich aber vielmehr für einen Schlotbaron zu halten und deswegen einen klitzekleinen Klassenkampf gegen mich führen zu müssen. Oyvey. --Edith Wahr (Diskussion) 14:47, 11. Dez. 2015 (CET)
- Für einen Schlotbaron, da kann ich dich beruhigen, halte ich dich nicht. Allerdings für den (wahrscheinlich) dienstältesten Rechthaber, der auf dieser Plattform sein Unwesen treibt. --Richard Zietz 15:05, 11. Dez. 2015 (CET)
- 56/60 and counting. --Edith Wahr (Diskussion) 15:12, 11. Dez. 2015 (CET)
- Mittlerweile sind’s – inklusive dem hier – 62. Wegen der 25 automatierten Dankeschöns, mit der du mir den Meldungen-Anzeiger meines Accounts zugekleistert hast. (Eine davon VM, um zu verhindern, dass du heute noch komplett ausrastest.) --Richard Zietz 15:44, 11. Dez. 2015 (CET)
- 56/60 and counting. --Edith Wahr (Diskussion) 15:12, 11. Dez. 2015 (CET)
- Für einen Schlotbaron, da kann ich dich beruhigen, halte ich dich nicht. Allerdings für den (wahrscheinlich) dienstältesten Rechthaber, der auf dieser Plattform sein Unwesen treibt. --Richard Zietz 15:05, 11. Dez. 2015 (CET)
- Liesels erste Arbeitshypothese könnte man ja mal empirisch testen: nach meiner Zählung hat Zietz in den vergangenen 10 Tagen exakt 58 Beiträge hier geleistet, von denen sich 54 unmittelbar oder mittelbar mit meiner Person beschäftigen. Mein erster Gedanke war ja, dass er „eine herzliche, fast schon teenagerhafte Vernarrtheit“ zu mir an den Tag legt, sich womöglich meine Beiträge ausdruckt und übers Bett hängt, tatsächlich scheint er mich aber vielmehr für einen Schlotbaron zu halten und deswegen einen klitzekleinen Klassenkampf gegen mich führen zu müssen. Oyvey. --Edith Wahr (Diskussion) 14:47, 11. Dez. 2015 (CET)
- Aber Käse ist nicht unbedingt Käse ;-). --Richard Zietz 14:35, 11. Dez. 2015 (CET)
- Wurst ist mir wurst! ;) --Henriette (Diskussion) 11:58, 11. Dez. 2015 (CET)
- Kulturwas?! Deutsche Wurst. Alles andere ist Käse. --JosFritz (Diskussion) 11:50, 11. Dez. 2015 (CET)
New Wikipedia Library Accounts Available Now (December 2015)
Hello Wikimedians!

The Wikipedia Library is announcing signups today for, free, full-access accounts to published research as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for new accounts and research materials from:
- Gale - multidisciplinary periodicals, newspapers, and reference sources - 10 accounts
- Brill - academic e-books and journals in English, Dutch, and other languages - 25 accounts
- Finnish Literature Society (in Finnish)
- Magiran (in Farsi) - scientific journal articles - 100 articles
- Civilica (in Farsi) - Iranian journal articles, seminars, and conferences - 50 accounts
Many other partnerships with accounts available are listed on our partners page, including EBSCO, DeGruyter, and Newspaperarchive.com. Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team 01:01, 11 December 2015 (UTC)
- Help us a start Wikipedia Library in your language! Email us at wikipedialibrary@wikimedia.org
- This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.
Meldung „Du bist nicht angemeldet“ für unangemeldete Benutzer
Heute, als ich die Hauptseite öffnete, sprang mir oben rechts ein Feld ins Auge, das mich etwas an die Oberfläche erinnerte, die ich habe, wenn ich mich anmelde. Für unangemeldete Benutzer sicherlich neu und deshalb ein Grund sich anzumelden. Sehr schöne Idee, so kann man neue Nutzer gewinnen! Weiter so, --Rogi 14:00, 11. Dez. 2015 (CET)
- Es ist das Remake eines alten Features, das es früher auch bei Wikitravel schon gab. Haben sie dort mittlerweile abgeschafft, weil es den Niedergang des Projekts nicht verhindern konnte. – Trotzdem allen ein frohes Wochenende.--Aschmidt (Diskussion) 22:45, 11. Dez. 2015 (CET)
- Eigentlich eine tolle Idee. Dadurch wird dem Problem des Aufrufens der IP-Diskussionsseite und der Beitragsliste entgegengewirkt. Vielleicht merkt der ein oder andere Leser dann auch, wer hier schreibt… Möglicherweise wäre eine Verlinkung auf WP:AUS, WP:FzW, WP:FvN sinnvoll, um die Anzahl der auf ihrer eigenen Disk nach Hilfe rufenden IPs möglichst gering zu halten und sie direkt dorthin zu schicken, wo es Hilfe gibt. -- Freddy2001 DISK 23:23, 11. Dez. 2015 (CET)
- Erinnerte mich stark an nl-wiki… -- 87.123.146.232 11:07, 12. Dez. 2015 (CET)
- Eigentlich eine tolle Idee. Dadurch wird dem Problem des Aufrufens der IP-Diskussionsseite und der Beitragsliste entgegengewirkt. Vielleicht merkt der ein oder andere Leser dann auch, wer hier schreibt… Möglicherweise wäre eine Verlinkung auf WP:AUS, WP:FzW, WP:FvN sinnvoll, um die Anzahl der auf ihrer eigenen Disk nach Hilfe rufenden IPs möglichst gering zu halten und sie direkt dorthin zu schicken, wo es Hilfe gibt. -- Freddy2001 DISK 23:23, 11. Dez. 2015 (CET)
Wikipedia-Gläubig
Naja, einen Monat nach den Anschlägen von Paris sollte die Security in einer Konzerthalle über etwas mehr Medienkompetenz verfügen und weniger wikipediagläubig sein. - ich bin immer wieder überrascht, zu welch seltsamen Schlüssen man kommen kann. Einen Zusammenhang zwischen Wikipedia und den Anschlägen von Paris zu konstruieren ist schon eine Leistung. Hut ab! Das kann wirklich nicht Jeder. Marcus Cyron Reden 15:25, 12. Dez. 2015 (CET)

















