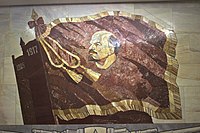U-Bahn

Ältestes und größtes Netz im deutschsprachigen Raum

Ältestes Netz der Welt und größtes Netz Westeuropas

Netz mit der größten Streckenlänge weltweit

Netz mit den meisten Stationen weltweit

Netz mit den meisten Fahrgästen weltweit
Eine U-Bahn oder Metro/Métro (Kurzform für Untergrundbahn[1] bzw. Metropolitan/Métropolitain) ist ein vom übrigen Verkehr vollständig unabhängiges, häufig im Tunnel geführtes Schienenverkehrsmittel des öffentlichen Personennahverkehrs, das vorrangig im städtischen Raum eingesetzt wird. Der Begriff wird gleichermaßen für das Gesamtsystem, seine Strecken und Linien und umgangssprachlich auch für die einzelnen Fahrzeuge (U-Bahn-Triebwagen, U-Bahn-Zug) verwendet.
Während der Name U-Bahn zunächst auf die unterirdische Trassierung hinweist, verfügen zahlreiche Netze auch über Streckenabschnitte an der Oberfläche, im Einschnitt, auf Bahndämmen oder auf Viadukten. Das U wird daher im deutschen Sprachraum teilweise auch als Abkürzung für unabhängig verstanden.
Untergrundbahnen für den Güterverkehr wie sogenannte Post-U-Bahnen sowie Grubenbahnen und Kasemattenbahnen weisen Gemeinsamkeiten mit U-Bahnen auf, dienen anders als diese jedoch nicht primär der Personenbeförderung.
Definition und Abgrenzung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Technische Definition
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Internationaler Verband für öffentliches Verkehrswesen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Internationale Verband für öffentliches Verkehrswesen (UITP) definiert den Begriff Metro als Schienenverkehrssystem für den städtischen Raum mit hoher Beförderungskapazität, das unabhängig von anderen Verkehrsmitteln trassiert ist.[2]
Der Begriff Schienenverkehrssystem (in der englischsprachigen Quelle: rail system) wird dabei weit gefasst und bezieht sich insgesamt auf Systeme mit baulich fixierter Spurbindung der Fahrzeuge und umfasst neben Bahnen, die mit Stahlrädern auf zwei Stahlschienen fahren, auch Bahnen auf Gummireifen, Einschienenbahnen und Magnetschwebebahnen, soweit sie die weiteren genannten Kriterien erfüllen (siehe auch hier). Hochbahnen, das heißt in Hochlage auf Viadukten geführte Bahnen, sind im Sinne des UITP ebenfalls Metros bzw. stellen eine Variante der Trassenführung von U-Bahnen dar (siehe auch hier). Ausdrücklich nicht zu Metros gezählt werden hingegen Hängebahnen. Das Kriterium der hohen Beförderungskapazität ist nicht präzise definiert, die UITP nennt als Bedingung lediglich den Einsatz von mindestens zweiteiligen Fahrzeugen mit einer Beförderungskapazität von mindestens 100 Fahrgästen.
Der Verband grenzt hiervon Bahnen ab, die vorrangig der Verbindung von Stadt und Region dienen,[3] sowie Straßen- und Stadtbahnen, die mindestens teilweise auf Sicht betrieben werden und auf Trassen verkehren, die mindestens teilweise auch von anderen Verkehrsmitteln genutzt werden.[4] Ebenfalls nicht eingeschlossen sind Peoplemover, da diese keine für den Stadtverkehr relevanten Relationen bedienen und/oder eine zu geringe Beförderungskapazität haben.
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) definiert den Begriff U-Bahn analog zum UITP als schienengebundenes und vom Individualverkehr vollständig getrennt geführtes Massenverkehrsmittel, das ein geschlossenes System bildet.[5] Das Erfordernis der Geschlossenheit beinhaltet auch, dass eine U-Bahn keine niveaugleichen Kreuzungen mit anderen Schienenverkehrsmitteln und keine Bahnübergänge besitzt. Die Trassierung kann sowohl im Tunnel als auch auf Dämmen und Viadukten, im Einschnitt und zu ebener Erde im freien Gelände erfolgen, wobei die Unabhängigkeit der Trasse in letzterem Falle durch Einzäunung gesichert werden kann. Die Fahrstromzuführung kann sowohl über Stromschiene als auch über Oberleitung erfolgen. Allerdings erfordert letztere Variante, je nach Tunnelprofil, häufig niedrige Sonderbauformen der Fahrdrahtaufhängung und/oder besonders kompakte Stromabnehmer. Systeme, die die genannten Merkmale erfüllen, werden auch als Voll-U-Bahn bezeichnet.
Wie der UITP grenzt auch der VDV U-Bahnen von Straßen- und Stadtbahnen ab, die mindestens teilweise eine Streckenführung auf öffentlichen Straßen haben können, in deren Bereich die Straßenverkehrs-Ordnung gilt. Aus diesem Grund haben in Deutschland U-Bahn-Wagen, anders als Straßenbahnwagen, weder Fahrtrichtungsanzeiger noch Klingeln respektive Glocken. Zur Abgabe von Achtungssignalen verfügen sie jedoch analog zur Eisenbahn über Makrofone, um beispielsweise das in der BOStrab geforderte Schutzsignal „Sh 5“ abgeben zu können. Notwendig ist dies beispielsweise zur Warnung von Personen, die sich auf Stationen zu nah an der Bahnsteigkante aufhalten, oder zur Vorwarnung von Gleisarbeitern.
Im Sinne der genannten Definition verfügen Berlin, Hamburg, München und Nürnberg über U-Bahnen (siehe auch hier). Das Frankfurter Stadtbahnsystem, das von seinem Betreiber ebenfalls als U-Bahn bezeichnet wird, ist keine U-Bahn im Sinne des VDV, da es die Anforderung der vollständigen Höhenfreiheit bzw. Unabhängigkeit von anderen Verkehrsmitteln nicht erfüllt.
American Public Transportation Association
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die American Public Transportation Association (APTA) hat für die Vereinigten Staaten in Zusammenarbeit mit Vertretern von Verkehrsbetrieben, Herstellern, technischen Sachverständigen und externen Beratern eine umfangreiche Zusammenstellung von gebräuchlichen Begriffen aus dem Gebiet des schienengebundenen Nahverkehrs erarbeitet. Ihre Verwendung ist freiwillig, der Verband strebt gleichwohl eine Übernahme durch die öffentlichen und privaten Akteure des öffentlichen Verkehrswesens an.[6] Die Begriffe wurden zudem durch die Canadian Urban Transit Association (CUTA), die grundsätzlich eng mit ihrer amerikanischen Schwesterorganisation zusammenarbeitet,[7] für Kanada übernommen.
Die im Wesentlichen der Definition des Begriffs Metro des UITP entsprechenden Systeme werden von der APTA unter den Begriffen heavy rail, metro, subway, rapid transit und rapid rail beschrieben. Sie bezeichnen elektrisch angetriebene Schienenbahnen mit hoher Beförderungskapazität für den Verkehr im städtischen Raum, die auf einem vollständig unabhängigem Bahnkörper verkehren. Bahnübergänge sind ebenfalls ausgeschlossen mit der ausdrücklichen Ausnahme von Chicago, dessen System auf den Außenstrecken der Brown, Pink, Purple und Yellow Line zahlreiche Bahnübergänge aufweist.[8] Ansonsten kann die Streckenführung im Tunnel, aufgeständert und in Dammlage, im Einschnitt und zu ebener Erde erfolgen. Die eingesetzten Fahrzeuge zeichnen sich durch hohe Beschleunigung und Beförderungsgeschwindigkeit aus, sind für den Zwei-Richtungs-Betrieb ausgelegt, können in Mehrfachtraktion eingesetzt werden und verfügen über zwei bis fünf Doppeltüren pro Wagenseite, um schnelle Fahrgastwechsel zu ermöglichen. Abweichend von der Definition des UITP werden ausschließlich hochflurige Systeme anerkannt, während Niederflurfahrzeuge ausdrücklich auf Straßen- und Stadtbahnen (s. u.) beschränkt sind.
Der Verband unterscheidet hiervon als weitere elektrische Schienenbahnen im Stadtverkehr Straßenbahnen (streetcar, street railway, tramway oder trolley) und den weitgehend mit deutschen Stadtbahnsystemen vergleichbaren Typus light rail/LRT. Straßenbahnen verkehren vorrangig im Mischverkehr im oberirdischen Straßenraum, haben kürzere Stationsabstände und werden vorwiegend für kürzere Strecken genutzt. Light rail wird zwischen Straßen- und U-Bahnen eingeordnet und kombiniert straßenbündige Streckenabschnitte mit längeren auf unabhängigem oder besonderem Bahnkörper trassierten Abschnitten. Beförderungskapazität, Beförderungsgeschwindigkeit und Stationsabstände liegen jeweils ebenfalls zwischen Straßen- und U-Bahn. Sowohl bei Straßenbahnen als auch bei light rail können Niederflur- und Hochflurfahrzeuge eingesetzt werden, die Stromversorgung erfolgt in der Regel über Oberleitung. Hinzu kommen Eisenbahn-Systeme, die vorrangig dem Pendlerverkehr in der engeren und/oder weiteren Stadtregion dienen (commuter rail, metropolitan rail, regional rail, suburban rail) und mit lokomotivbespannten Zügen oder Triebzügen betrieben werden, also vergleichbar mit europäischen S-Bahnen und teilweise dem Regionalverkehr sind.
Im Sinne der genannten Definition verfügen in den Vereinigten Staaten Atlanta, Baltimore, Boston, Chicago, Cleveland, Honolulu, Miami, New York mit Newark, Los Angeles, Philadelphia mit dem Camden County, San Francisco und Washington, D.C. sowie San Juan im amerikanischen Außengebiet Puerto Rico über U-Bahnen.[9][10][8]
In Kanada erfüllen die Systeme von Montreal (Métro und REM), Toronto und Vancouver sowie die Confederation Line in Ottawa die genannten Anforderungen.[11]
Rechtliche Definitionen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die rechtliche Definition und die betrieblichen Bestimmungen für U-Bahnen sind international unterschiedlich ausgestaltet. Während U-Bahnen in Deutschland etwa eindeutig von Eisenbahnen abgegrenzt werden (s. u.) und in Österreich eine eigene Klasse innerhalb der Eisenbahnen (s. u.) bilden, sind die Grenzen in anderen Ländern teilweise fließender oder es besteht keine rechtliche Differenzierung. Die Abgrenzung orientiert sich dort beispielsweise an der betrieblichen Geschlossenheit oder am Eigentum des Systems, da sich U-Bahnen – anders als Eisenbahnen – in der Regel in kommunalem Besitz befinden.
Die Regelungen in Deutschland und Österreich gehen auf die aus dem Rechtsbestand des Deutschen Reichs übergeleitete Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung (BOStrab) zurück, weshalb die hierzu in den beiden Ländern aktuell einschlägigen Normen eine große formale und materielle Nähe zueinander aufweisen.
Deutschland
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im rechtlichen Sinne gehören U-Bahnen in Deutschland zu den Straßenbahnen (vgl. § 4 Abs. 2 Personenbeförderungsgesetz (PBefG)) und hier zu den sogenannten unabhängigen Bahnen, die explizit „Hoch- und Untergrundbahnen, Schwebebahnen [und] ähnliche Bahnen besonderer Bauart“ (vgl. § 1 Abs. 2 Nr. 2 Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung (BOStrab) i. V. m. § 4 Abs. 2 PBefG). U-Bahnen sind demnach „Schienenbahnen“, die „ausschließlich oder überwiegend der Beförderung von Personen im Orts- oder Nachbarschaftsbereich dienen“ (§ 4 Abs. 1 PBefG) und „durch ihre Bauart oder Lage auf der gesamten Streckenlänge vom Straßenverkehr oder anderen Verkehrssystemen getrennt [sind]“ (§ 1 Abs. 2 BOStrab). Sie entsprechen damit der vom VDV sowie vom UITP für U-Bahnen formulierten Anforderung der vollständig unabhängigen und kreuzungsfreien Trassierung, wobei der UITP Hängebahnen ausdrücklich nicht zu den U-Bahnen zählt.[2]
Dem gegenüber stehen sogenannte straßenabhängige Bahnen (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 BOStrab i. V. m. § 4 Abs. 1 PBefG), die „den Verkehrsraum öffentlicher Straßen benutzen und sich mit ihren baulichen und betrieblichen Einrichtungen sowie in ihrer Betriebsweise der Eigenart des Straßenverkehrs anpassen oder einen besonderen Bahnkörper haben und in der Betriebsweise den [vorgenannten] Bahnen gleichen oder ähneln“ (§ 4 Abs. 1 PBefG), das heißt teilweise oder ausschließlich im Mischverkehr mit anderen Verkehrsarten auf der Fahrbahn verkehren. Hierunter fallen Straßenbahnen im engeren Sinne (z. B. Bremen, Dresden, Würzburg) sowie Stadtbahnen, die oberirdische, teilweise straßenbündige Abschnitte mit U-Bahn-mäßig ausgebauten Tunnel- und vereinzelt Viaduktstrecken kombinieren (z. B. Hannover, Köln, Stuttgart). Die Maße für Bahnen, die am Straßenverkehr teilnehmen, sind zudem auf eine Breite von 2,65 Metern (vgl. § 34 Abs. 3 Nr. 1 lit. a BOStrab) und eine Länge von 75 Metern (vgl. § 55 Abs. 2 BOStrab) begrenzt, während für U-Bahnen keine entsprechenden Höchstmaße gelten.
Die Abgrenzung zwischen U-Bahn und Eisenbahn ergibt sich vor allem aus deren rechtlicher Stellung als Vollbahn, die z. B. auch niveaugleiche Kreuzungen mit anderen Verkehrsmitteln, insbesondere in Form von Bahnübergängen, haben kann. U-Bahnen werden zudem von Berg- und Seilbahnen abgegrenzt.
Bau und Betrieb von U-Bahnen sind bundesrechtlich durch die Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung (BOStrab) geregelt.
- Zulassungsverfahren
Die Zulassung von Vorhaben für den Bau und die Änderung von Betriebsanlagen von U-Bahnen erfolgt in Deutschland gem. § 28 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) auf Landesebene und grundsätzlich im Wege eines Planfeststellungsverfahrens auf Antrag des Vorhabenträgers durch die hierfür von der jeweiligen Landesregierung bestimmte Planfeststellungsbehörde (vgl. § 29 Abs. 1 PBefG). In den Stadtstaaten Berlin und Hamburg sowie im Flächenland Schleswig-Holstein (berührt durch die U-Bahn Hamburg) ist diese Behörde jeweils bei einer Landesoberbehörde angesiedelt (Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt,[12] Behörde für Wirtschaft und Innovation,[13] Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus),[14] in Bayern bei der Regierung des jeweils räumlich betroffenen Regierungsbezirks als Landesmittelbehörde, das heißt für die U-Bahn München die Regierung von Oberbayern[15] und für die U-Bahn Nürnberg die Regierung von Mittelfranken.[16]
- Regelungen in der DDR
In der DDR waren Bau und Betrieb von U-Bahnen ebenfalls einheitlich geregelt, wobei es dort lediglich ein Netz in Ost-Berlin gab, das zum großen Teil aus zwei bereits vor der Staatsgründung bestehenden Strecken (nach aktueller Nomenklatur U2 und U5) bestand. Zunächst galten in der DDR ebenfalls die übergeleitete BOStrab bzw. deren gleichnamige Novellierungen (vgl. § 1 Abs. 1 BOStrab (DDR) vom 8. Dezember 1959), ab dem 1. Juni 1979 eine eigenständige Bau- und Betriebsordnung für Untergrundbahnen (BO U).[17]
Österreich
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im rechtlichen Sinne gehören U-Bahnen in Österreich zur Gruppe der Straßenbahnen innerhalb der Eisenbahnen und hier zu den sogenannten straßenunabhängigen Bahnen, die explizit „Hoch- und Untergrundbahnen, Schwebebahnen [und] ähnliche Bahnen besonderer Bauart“ umfassen (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 Eisenbahngesetz 1957 (EisbG)). U-Bahnen sind demnach „für den öffentlichen Verkehr innerhalb eines Ortes bestimmte Schienenbahnen“, „auf denen Schienenfahrzeuge ausschließlich auf einem eigenen Bahnkörper verkehren“ (§ 5 Abs. 1 EisbG). Sie entsprechen damit der vom UITP für U-Bahnen formulierten Anforderung der vollständig unabhängigen und kreuzungsfreien Trassierung.
Dem gegenüber stehen sogenannte straßenabhängige Bahnen, „deren bauliche und betrieblichen Einrichtungen sich zumindest teilweise im Verkehrsraum öffentlicher Straßen befinden und auf denen Schienenfahrzeuge zumindest teilweise den Verkehrsraum öffentlicher Straßen benützen und sich in ihrer Betriebsweise der Eigenart des Straßenverkehrs anpassen“ (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 EisbG), das heißt teilweise oder ausschließlich im Mischverkehr mit anderen Verkehrsarten auf der Fahrbahn verkehren. Hierunter fallen Straßenbahnen im engeren Sinne (z. B. Graz, Innsbruck, Linz). Die Maße für Bahnen, die am Straßenverkehr teilnehmen, sind zudem auf eine Breite von 2,65 Meter (§ 34 Abs. 3 Nr. 1 lit. a StrabVO) und eine Länge von 75 Meter (§ 58 StrabVO) begrenzt, während für U-Bahnen keine entsprechenden Höchstmaße gelten.
Bau und Betrieb von U-Bahnen sind bundesrechtlich durch die Straßenbahnverordnung 1999 (StrabVO) geregelt.
- Zulassungsverfahren
Die Zulassung von Vorhaben für den Bau und die Änderung von Betriebsanlagen von U-Bahnen erfolgt in Österreich im Wege einer Bewilligung gem. § 14 Abs. 1 Eisenbahngesetz (EisbG). Das Verfahren erfolgt auf Landesebene und auf Antrag des Vorhabenträgers bei der hierfür von der jeweiligen Landesregierung bestimmten Behörde (vgl. § 12 Abs. 1 EisbG). In Wien ist dies die für Bau-, Energie-, Eisenbahn- und Luftfahrtrecht zuständige Magistratsabteilung (MA) 64.[18]
Schweiz
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In der Schweiz sind die Begriffe „U-Bahn“ bzw. „Metro“ nicht gesondert legaldefiniert und fallen wie andere Schienenbahnen einschließlich Straßenbahnen unter die Regelungen des Eisenbahngesetzes.
- Zulassungsverfahren
Die Zulassung von Vorhaben für den Bau und die Änderung von Betriebsanlagen von U-Bahnen erfolgt in der Schweiz gem. Art. 18 EBG im Wege eines Plangenehmigungsverfahrens. Anders als in Deutschland und Österreich erfolgen Prüfung und Zulassung nicht regionalisiert, das heißt z. B. durch die Kantone, sondern auf Bundesebene durch das Bundesamt für Verkehr BAV (vgl. Art. 18 Abs. 2 EBG).[19]
Übersicht der Städte mit U-Bahnen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ende 2020 gab es weltweit 193 Städte bzw. Ballungsräume mit U-Bahn-Systemen im Sinne der UITP-Definition, die über eine kombinierte Streckenlänge von 17.221 Kilometern verfügten. Die Zählung nach Städten bedeutet, dass Netze, die technisch und betrieblich voneinander getrennt sind, verkehrlich jedoch ein zusammenhängendes Gesamtsystem bilden, nicht einzeln gezählt werden. Beispielsweise bilden die Linien der beiden Betreiber Tōkyō Metro und Toei zusammen das Netz der U-Bahn Tokio, ebenso werden London Underground und Docklands Light Railway als ein Gesamtsystem gezählt.[2]
Die globalen Regionen mit den höchsten Dichten von Systemen sind das westliche und zentrale Europa einschließlich der Westtürkei, Ostasien, das heißt insbesondere das östliche China, die koreanische Halbinsel bzw. die Republik Korea und Japan, und Südasien. Weitere kleinere Cluster bestehen in der dichtbesiedelten Region östlich der Großen Seen (Megaregion Boswash in den Vereinigten Staaten und Québec-Windsor-Korridor in Kanada), in den Küstenstaaten Brasiliens und im zentralen Vorderasien. Sehr gering ist die Dichte hingegen auf dem afrikanischen Kontinent, auf dem nur eine sehr geringe Zahl der zahlreichen Millionenstädte über ein System verfügt.
Städte mit U-Bahn |
Deutschland
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In Deutschland verfügen die vier Städte Berlin, Hamburg, München und Nürnberg über U-Bahn-Systeme, die den Definitionen des UITP und des VDV entsprechen, das heißt insbesondere vollständig unabhängig von anderen Verkehrsarten trassiert sind. Diese Netze sind jeweils vollständig normalspurig ausgeführt und werden mit seitlicher Stromschiene betrieben.
-
Liniennetz der U-Bahn Berlin
-
Liniennetz der U-Bahn Hamburg
-
Liniennetz der U-Bahn München
-
Liniennetz der U-Bahn Nürnberg
- Berlin
Die erste U-Bahn Deutschlands wurde am 15. Februar 1902 in Berlin auf der Strecke Potsdamer Platz – Stralauer Thor (heute aufgeteilt zwischen dem gemeinsamen Abschnitt von U1 und U3 und der U2) in Betrieb genommen.[20] Das Netz hat eine Gesamtlänge von 155,4 Kilometern und umfasst neun Linien, die sich auf die vier älteren sogenannten Kleinprofillinien U1 bis U4 für Fahrzeuge mit einer Breite von 2,3 Metern und die fünf ab 1923 in Betrieb genommenen sogenannten Großprofillinien U5 bis U9 für 2,65 Meter breite Fahrzeuge aufteilen. Die damals selbstständige Stadt Schöneberg eröffnete 1910 eine eigene U-Bahn-Strecke (die heutige U4) mit Umsteigemöglichkeit zum Berliner Netz an der Station Nollendorfplatz, wobei die Stationsbauwerke beider Bahnen zunächst voneinander getrennt waren und erst 1926 eine Gleisverbindung erhielten.
Hönow, der östliche Endpunkt der U5, lag zum Zeitpunkt seiner Eröffnung im Juni 1989 außerhalb Berlins im Bezirk Frankfurt (Oder). Im Rahmen der Vereinigung West- und Ost-Berlins im Zuge der Deutschen Wiedervereinigung erfolgte eine Grenzanpassung, durch die das Teilgebiet von Hönow, in dem der U-Bahnhof liegt, in den Berliner Ortsteil Hellersdorf eingegliedert wurde. Seitdem ist die Berliner U-Bahn die einzige in Deutschland, die ausschließlich auf dem Gebiet einer Gemeinde liegt.
- Hamburg
Am 15. Februar 1912 folgte die Hamburger Hochbahn mit der Strecke Rathaus – Berliner Tor – Barmbek (heute Teil der Ringlinie U3) als zweites System.[21] Das Streckennetz hat eine Länge von rund 106,4 Kilometern und umfasst vier Linien, wobei die U1 im Nordosten Hamburgs über zwei Streckenäste verfügt und die U2 und die U4 die Strecke zwischen Horner Rennbahn und Jungfernstieg gemeinsam nutzen. Die Strecke für eine fünfte Linie befindet sich in Bau und soll ab 2029 sukzessive den Fahrgastbetrieb aufnehmen.[22]
Die Strecke der U1 reicht an beiden Enden bis in das benachbarte Schleswig-Holstein. Der auf dem Gebiet der Stadt Norderstedt gelegene Streckenabschnitt sowie zwei U-Bahn-Fahrzeuge der Typs DT4 befinden sich im Eigentum der Stadtwerke Norderstedt bzw. ihrer Tochtergesellschaft Verkehrsgesellschaft Norderstedt, jedoch erfolgt der Betrieb auch hier durch die Hamburger Hochbahn AG als Eigentümer und Betreiber des Hauptteils des Netzes.[23]
- München
Am 19. Oktober 1971 wurde die Münchner U-Bahn mit der Strecke Kieferngarten – Goetheplatz (Stammstrecke 1, heute U6 und teilweise U3) als drittes System in Betrieb genommen. Es hat eine Gesamtlänge von rund 103 Kilometern und umfasst sechs ganztägig verkehrende Haupt- sowie zwei nur während der werktäglichen Hauptverkehrszeiten verkehrende Verstärkerlinien. Im zentralen Bereich Münchens verfügt das Netz über drei Stammstrecken, die von jeweils zwei Hauptlinien befahren werden.
Der nördliche Streckenabschnitt der U6 reicht bis nach Garching bei München im Landkreis München, der auch Eigentümer der Strecke ist, jedoch erfolgt der Betrieb auch hier durch die MVG als Eigentümer und Betreiber des Hauptteils des Netzes.[24]
- Nürnberg
Am 1. März 1972 ging mit der Strecke Langwasser Süd – Bauernfeindstraße der Linie U1 der Nürnberger U-Bahn das vierte und bislang jüngste deutsche System in Betrieb.[21] Es hat eine Länge von rund 38,2 Kilometern und umfasst drei Linien. Die Linien U2 und U3 werden fahrerlos betrieben und befahren zwischen Rathenauplatz und Rothenburger Straße dieselbe Strecke. Bis zur Umstellung der älteren Linie U2 auf fahrerlosen Betrieb im Jahr 2010 war Nürnberg die weltweit einzige Stadt, in der ein Mischbetrieb von fahrerlosen und fahrergeführten U-Bahn-Zügen auf derselben Strecke erfolgte.[25] Die ersten Baureihen der Münchner und Nürnberger U-Bahn (MVG Baureihe A und VAG Baureihe DT1) waren anfangs annähernd baugleich und konnten in beiden Systemen eingesetzt und miteinander gekuppelt werden, ein Austausch erfolgte u. a. anlässlich verschiedener Großveranstaltungen. Im Zuge später erfolgter Umbauten der älteren Fahrzeuge entfiel diese Kompatibilität, ebenso sind die neueren Baureihen der in den beiden Netzen eingesetzten Fahrzeuge nicht miteinander kompatibel.
Der nordwestliche Abschnitt der U1 führt größtenteils entlang der Strecke der ersten deutschen Eisenbahn nach Fürth, womit die Nürnberger U-Bahn als einziges System in Deutschland zwei Großstädte miteinander verbindet.
- Weitere Systeme mit unterirdischer Streckenführung
Neben den oben genannten verfügen zahlreiche Städte und Ballungsräume in Deutschland über Stadtbahnsysteme, die vollständig unabhängige, häufig U-Bahn-mäßig ausgebaute Streckenabschnitte mit Strecken kombinieren, die häufig von früheren und teilweise parallel weiterbetriebenen Straßenbahnsystemen übernommenen wurden. Hierzu gehören insbesondere die Netze in Bielefeld, Frankfurt am Main, Hannover, Karlsruhe, Köln und Bonn, Stuttgart und die Teilnetze der Stadtbahn Rhein-Ruhr.[26][27][28][21]
Einige der in Deutschland betriebenen S-Bahn-Systeme verfügen ebenfalls über längere Tunnelstrecken und weisen – insbesondere in den jeweiligen Innenstadtbereichen – eine mit U-Bahnen vergleichbare Haltestellen- und Taktdichte und eine ähnliche Bedeutung für den städtischen Nahverkehr auf. Hierzu zählen insbesondere die Netze in Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig, München und Stuttgart.
Österreich
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Wien
In Österreich verfügt die Bundeshauptstadt Wien über eine U-Bahn im Sinne der Definition des UITP. Das System wurde am 25. Februar 1978 mit der Strecke Karlsplatz – Reumannplatz (Linie U1) offiziell in Betrieb genommen. Bereits ab dem 8. Mai 1976 war allerdings auf der Strecke Heiligenstadt – Friedensbrücke (Linie U4) ein sogenannter erweiterter Probebetrieb mit Fahrgästen erfolgt.
Das Netz hat eine Streckenlänge von 83 Kilometern und umfasst fünf Linien,[29] die Strecke für eine sechste Linie befindet sich in Bau und soll ab 2026 sukzessive den Betrieb aufnehmen.[30] Weiterhin werden kleinere Teile der Wiener Straßenbahn, die U-Straßenbahn, und die Lokalbahn Wien–Baden im Tunnel geführt. Die Wiener U6 wird – anders als die anderen U-Bahn-Linien im deutschsprachigen Raum – nicht per Stromschiene, sondern per Oberleitung mit elektrischer Energie versorgt.
- Weitere Systeme mit unterirdischer Streckenführung
Die in Serfaus in Tirol verkehrende U-Bahn Serfaus ist eine 1280 Meter lange unterirdische Luftkissenschwebebahn mit Seilantrieb. Mindestens aufgrund seiner geringen Beförderungskapazität ist das System keine U-Bahn im Sinne des UITP (siehe hier).
In den 1990er Jahren und erneut ab 2018 untersuchte die Stadt Graz den Bau einer U-Bahn, nahm jedoch in beiden Fällen Abstand vom Vorhaben, nachdem die jeweils erstellten Machbarkeitsstudien aufzeigten, dass der Ausbau des bestehenden Straßenbahn- und S-Bahn-Netzes sinnvoller sei. Die Planungen der 1990er Jahre sahen ein radial von der Innenstadt ausgehendes Netz mit drei Linien vor, die zwischen Jakominiplatz und Hauptplatz eine kurze gemeinsame Stammstrecke befahren sollten.[31] Die ab 2018 entwickelten Überlegungen sahen ein rund 25 Kilometer langes, vollständig unterirdisches Netz mit zwei Strecken vor, die sich am Jakominiplatz kreuzen sollten. Die Baukosten wurden mit Stand Februar 2021 auf 3,3 Mrd. Euro prognostiziert, eine Umsetzung bis 2030 wurde zum selben Zeitpunkt als realistisch eingeschätzt.[32][33]
Die Haltestellen Brauhaus Puntigam und Hauptbahnhof der Grazer Straßenbahn liegen unter Erdgleiche, sind jedoch nach oben geöffnet, um den technischen Aufwand für den Brandschutz reduzieren.
Die Straßenbahn Linz verkehrt seit 2004 im Bereich des Hauptbahnhofs auf einer Tunnelstrecke mit drei unterirdischen Stationen als U-Straßenbahn. Das System wird lokal teilweise als Mini-U-Bahn bezeichnet, hat abseits der Tunnelstrecke jedoch eine weitgehend konventionelle straßenbündige Trassierung.
In Salzburg verläuft die Strecke der Lokalbahn im Bereich des Hauptbahnhofs auf einer Länge von etwa 300 Metern unterirdisch und endet in der Tunnelstation Hauptbahnhof. Die Stadt verfolgt eine unterirdische Verlängerung bis zum Mirabellplatz sowie einen weiterer Abschnitt unter dem Stadtkern. Das Projekt Regionalstadtbahn Salzburg sieht eine oberirdische Fortführung in das südliche Umland vor.
Schweiz
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Lausanne
Die Linie M2 der Métro Lausanne ist vollständig kreuzungsfrei trassiert und damit als U-Bahn im Sinne des UITP qualifiziert. Sie hat eine Länge von rund 5,9 Kilometern und überwindet zwischen ihren Endstationen 338 Höhenmeter und damit die größte Höhendifferenz aller U-Bahnen weltweit – die durchschnittliche Steigung beträgt hier 57,3 ‰; viele andere U-Bahnen limitieren die maximale Steigung auf 40 ‰ oder weniger. Die Strecke geht auf die 1,5 Kilometer lange Zahnradbahn Lausanne–Ouchy zurück, die für die Métro zwischen Januar 2006 und September 2007 auf gummibereifte Fahrzeuge und fahrerlosen Betrieb umgestellt und nach Epalinges verlängert wurde. Der Fahrgastbetrieb wurde am 18. September 2008 aufgenommen, der kommerzielle Betrieb am 27. Oktober desselben Jahres. Die Linie M1 der Métro verkehrt hingegen nicht vollständig kreuzungsfrei.
- Verworfene Planungen für Zürich
Die Stadt Zürich verfolgte in den 1960er und 1970er Jahre den Bau einer U-Bahn, deren erste Strecke von Dietikon über den Zürcher Hauptbahnhof zum Flughafen führen sollte und dabei die bedeutenden Siedlungsachsen entlang des Limmattals und des Glatttals erschlossen hätte. Das Vorhaben wurde im Mai 1973 in einer Volksabstimmung vom Zürcher Stimmvolk mehrheitlich abgelehnt. Ein bereits vor der Abstimmung genehmigter, als Vorleistung für die U-Bahn vorgesehener rund 1,4 Kilometer langer Tunnel wurde 1978 im Rohbau fertiggestellt und später in den Tramtunnel Milchbuck–Schwamendingen integriert, der seit 1986 von den Linien 7 und 9 der Zürcher Strassenbahn genutzt wird. Eine weitere Vorleistung ging im 1990 eröffneten Endbahnhof der Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn am Zürcher Hauptbahnhof auf.[34]
- Weitere Systeme mit unterirdischer Streckenführung
Die Standseilbahn Metro Alpin bei Saas-Fee im Kanton Wallis verläuft vollständig unterirdisch und wird teilweise als U-Bahn bezeichnet. Aufgrund ihrer geringen Beförderungskapazität bzw. der zu kleinen Fahrzeuge und der fehlenden Bedeutung für den städtischen Nahverkehr erfüllt sie jedoch nicht die Definition des UITP.
Bezeichnungen und Logos
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bezeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-
Ehemaliger Eingang der Station Wall Street an der ältesten U-Bahn-Strecke New Yorks
Originalentwurf von 1904 -
Ursprüngliches, flächiges roundel der London Underground als dekoratives Mosaik in der Station Maida Vale
Originalentwurf etwa 1915 -
Ursprünglicher Abgang zur Subterráneos-Station Plaza de Mayo, Buenos Aires;
die Beschilderung weist das Linienziel aus, nicht den Stationsnamen -
Station Ringvägen (heute: Skanstull) der ursprünglichen tunnelbana, eines Straßenbahntunnels
Originalentwurf von 1933
- Deutschsprachiger Raum
In Deutschland, Österreich und der Deutschschweiz wird das Verkehrsmittel als U-Bahn bezeichnet, insbesondere in Bezug auf die in diesen Ländern vorhandenen bzw. im Falle der Schweiz ehemals geplanten Netze. Das erste entsprechende System im deutschsprachigen Raum wurde ab Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin durch die Gesellschaft für elektrische Hoch- und Untergrundbahnen in Berlin angelegt und 1902 eröffnet. Während das Gesamtsystem in den ersten Jahrzehnten von Betreiberseite konsequent Hoch- und Untergrundbahn genannt wurde und die Bezeichnung Untergrundbahn auf die im Tunnel geführten Streckenabschnitte beschränkt war, wurde spätestens 1929 die Kurzbezeichnung U-Bahn eingeführt und pars pro toto für das Gesamtsystem verwendet.[35][20] Hamburg übernahm die Bezeichnung 1936.[28]
Im Deutschen nicht mehr gebräuchliche bzw. heute teilweise mit anderer Bedeutung verwendete Bezeichnungen sind Stadtbahn,[36] Schnellbahn,[37] Stadtschnellbahn,[38] Untergrundstadtbahn,[39] Untergrundschnellbahn,[40] Untergrundeisenbahn, Metropolitain-Schnellbahn,[41] Metropolitaneisenbahn oder Metropolitanbahn.[42] Der Begriff Schnellbahn wird regional (z. B. in Hamburg[43][44] und München)[45] und teilweise in der Literatur[21][46] als Sammelbegriff für U-Bahnen und S-Bahnen verwendet, soweit letztere wie beispielsweise in Berlin, Hamburg und München wesentliche Bedeutung für den städtischen Nahverkehr haben und in ihrer Betriebsweise U-Bahnen ähneln oder gleichen, das heißt insbesondere eine hohe Takt- und Stationsdichte aufweisen und mit entsprechenden Fahrzeugen (siehe hier) betrieben werden.
In Abgrenzung zur U-Bahn werden die übrigen städtischen Verkehrsträger auch als Oberflächenverkehr respektive Oberflächenverkehrsmittel bezeichnet.
- Weitere Bezeichnungen
Die außerhalb des deutschen Sprachraums am häufigsten verwendete Bezeichnung für das Verkehrsmittel ist Metro bzw. landessprachliche Variante hiervon (Métro, Metró, Metrô etc.). Der Begriff wurde erstmals bei der 1863 eröffneten Metropolitan Railway in London (später aufgegangen in den Sub-Surface-Linien der London Underground, u. a. der Metropolitan Line) und der 1899 gegründeten Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris, kurz Métro de Paris, verwendet und bedeutete jeweils sinngemäß (groß-)städtische Eisenbahn (vgl. Metropole) im Sinne einer Eisenbahn für den städtischen Raum. Von dort ausgehend wurde der Name u. a. in die meisten romanischen und slawischen Sprachen, ins Finnische und Ungarische sowie auch ins Englische übernommen. Darüber hinaus ist der Begriff auch im deutschsprachigen Raum allgemein bekannt, der Gebrauch beschränkt sich jedoch tendenziell auf Netze, die auch in der jeweiligen Landessprache als „Metro“ bezeichnet werden. In einigen Ländern ist der Begriff Metro kein reiner Gattungsname, insbesondere in Spanien und Frankreich ist er durch die Betreiber der einzelnen Systeme häufig als Marke geschützt.
In der Anglosphäre, das heißt im Engeren dem Vereinigten Königreich, der Republik Irland, den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Neuseeland, wird der Begriff rapid transit als allgemeine Bezeichnung für städtische Bahnsysteme verwendet, die auch U-Bahnen umfasst. Speziell für U-Bahnen wird der Begriff Subway (z. B. Boston, Glasgow, New York, Toronto) verwendet, Underground sowie Tube werden als Eigennamen ausschließlich für das Londoner System genutzt. Weiterhin ist in den Vereinigten Staaten und Kanada vielfach verbreitet, im Zusammenhang mit einem bestimmten System den jeweiligen Betreibernamen totum pro parte für die U-Bahn sowie auch insgesamt als Synonym für den lokalen ÖPNV zu verwenden. Teilweise werden rapid transit sowie Metro auch nur für die Betreibergesellschaft (z. B. Dallas Area Rapid Transit, Metro Los Angeles) verwendet, während die Verkehrsmittel selbst andere Namen tragen.[47][9][48][10][8]
Weiterer Gattungsnamen sind tunnelbana/T-bana im Schwedischen und tunnelbane/T-bane im Norwegischen (dt. jeweils: Tunnelbahn). Im Dänischen wird das analog zur deutschen Bezeichnung gebildete und gleichbedeutende undergrundbane, das auch dem Norwegischen als undergrunnsbane (Bokmål) bzw. undergrunn (Nynorsk) bekannt ist, für das Verkehrsmittel verwendet, während das einzige dänische System jedoch Metro heißt.
Weitere Bezeichnungen sind Földalatti (dt. [die] Unterirdische, von hu. föld für Erde und alatt für unter) speziell für die älteste Linie der Budapester U-Bahn, MTR (Mass Transit Railway) in Hongkong, MRT (Mass Rapid Transit) für die Netze in Manila, Singapur und Taipeh sowie Subte (von es. subterráneo; dt. unterirdisch) in Buenos Aires, das sich trotz der Pionierfunktion des Systems als erste U-Bahn der Hispanität nicht weiter verbreitet hat.
- Weitere Verwendungen der Begriffe Metro und rapid transit
- Beispiele für Verkehrssysteme, deren Namen vom Begriff Metro abgeleitet wurden
-
West Midlands Metro
Niederflurstraßenbahn, die teilweise eine frühere Eisenbahntrasse nutzt -
Metro do Porto
Niederflurstadtbahn mit Tunnel- und straßenbündigen Streckenabschnitten -
Métro léger de Charleroi
Hochflurstadtbahn mit Tunnel- und straßenbündigen Streckenabschnitten -
Metrotram Wolgograd
U-Straßenbahn
Der UITP definiert den Begriff Metro anhand spezifischer technischer und betrieblicher Merkmale, die insbesondere die vollständige Unabhängigkeit der Trassierung umfassen (siehe hier). Als Marke wird Metro jedoch teilweise auch für Schienenbahnen verwendet, die dieser eng gefassten Definition nicht entsprechen und die im deutschsprachigen Kontext als Straßen- oder Stadtbahn (z. B. Metro de Málaga, Metro do Porto, Muni Metro in San Francisco, West Midlands Metro im Raum Birmingham, Manchester Metrolink, Valley Metro Rail in Phoenix) oder S-Bahn (z. B. Metro Trains Melbourne, Metrô de Teresina, Metrorail Western Cape) bezeichnet würden.
Weiterhin wurden von Metro in verschiedenen Ländern und Sprachen Begriffe wie premetro/prémétro (dt. Vor-Metro, ursprünglich im Sinne einer Vorstufe zu einer Voll-Metro, deren Entwicklung langfristig angestrebt wird), light metro/métro léger/metro ligero/metropolitana leggera (dt. Leichtmetro), semimetro/semi-metro (dt. Halb-Metro) und metrotram/metrotranvia/metrotranvía abgeleitet. Auf nationaler Ebene sind diese Begriffe teilweise normiert, beispielsweise definiert die norma UNI 8379:2000 der italienischen Normierungsorganisation UNI neben dem Begriff metropolitana auch metropolitana leggera und tranvia veloce (dt. Schnellstraßenbahn) bzw. metrotranvia. Insgesamt bestehen international jedoch keine exakt einheitlichen Definitionen und die genannten Begriffe werden ähnlich der ausgeweiteten Verwendung von Metro sowohl als Gattungsnamen als auch als Eigenbezeichnungen bzw. Markennamen für verschiedene hoch- und niederflurige Systeme von Schnellstraßenbahnen (z. B. die Premetro in Buenos Aires) und U-Straßenbahnen (z. B. Prémétro d’Anvers, Prémétro de Bruxelles, Metrotram Wolgograd/Волгоградский метротрам) über Stadtbahnen (z. B. Métro léger de Charleroi, Metro Ligero de Madrid, Metrotranvía de Mendoza, Métro léger de Tunis) bis zu (Kleinprofil-)U-Bahnen (z. B. die als metropolitana leggera bezeichnete Linie M5 der Metro Mailand[49] und das als métro léger/light metro bezeichnete Réseau express métropolitain in Montreal)[50] verwendet.
Ausgehend vom englischen rapid transit wurde die Bezeichnung Bus Rapid Transit (kurz: BRT) als Gattungsname für Stadt- bzw. Schnellbussysteme mit besonders qualifizierter Infrastruktur (z. B. durchgängige oder weitgehende Führung auf eigener Spur und/oder Vorrangschaltung an Ampeln, komfortablere Fahrzeuge, stufenloser Einstieg durch angepasste Bussteige) und höherer Angebotsqualität entwickelt. Diese Systeme werden zudem teilweise als Metrobus vermarktet (z. B. Metrobüs in Istanbul, Metrobús in Mexiko-Stadt, Metrobus in Lahore, Metrobus-Q in Quito).
Die Verkehrsbetriebe bzw. -verbünde verschiedener deutscher Städte (u. a. Berlin, Hamburg und München) führten zu Beginn des 21. Jahrhunderts im Zuge der Neustrukturierung ihrer Stadtbusnetze den Begriff Metrobus für die wichtigsten Linien des jeweiligen Netzes ein. Die Berliner Verkehrsbetriebe führten dabei parallel die Bezeichnung Metrotram für die wichtigsten Linien der Straßenbahn ein, die Braunschweiger Verkehrs-GmbH bezeichnete zwischen 2009 und 2016 ebenfalls einzelne Bus- und Straßenbahn-Linien als Metrolinien.[51][52][53][54] Im Unterschied zu den oben genannten BRT-Systemen wurden diese Linien auf Grundlage und als Teil der bestehenden Infrastruktur eingeführt und nicht als technisch und betrieblich (weitgehend) eigenständiges System neu angelegt.
Die jeweils unter dem Namen „Metro“ auftretenden Verkehrsbetriebe der venezolanischen Hauptstadt Caracas und der kolumbianischen Großstadt Medellín wiederum bezeichnen die von ihnen als Teil des ÖPNV betriebenen Luftseilbahnen als Metrocable (von es. cable, dt. Seil; analog zur in verschiedenen englischsprachigen Regionen verwendeten Konstruktion Metrorail/Metro Rail).
Logos
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Logos verschiedener U-Bahn-Systeme
-
Diverse italienische
Metrosysteme -
Tōkyō Metro
Lateinisches M anstelle von メトロ (metoro) oder 地下鉄 (chikatetsu, dt. U-Bahn) -
Metro Pjöngjang
Erste Silbe von 지하철도 (chihach'ŏlto, dt. U-Bahn)

Das Verkehrsmittel U-Bahn wird in der Mehrheit der bedienten Städte und Regionen durch ein prägnantes Logo gekennzeichnet, etwa an Stationsbauwerken, auf Liniennetzplänen, in Wegeleitsystemen oder auf den Zügen selbst. Durch ihre Präsenz können sich diese Logos zu einem typischen Element des Stadtbildes entwickeln und über die U-Bahn hinaus als Symbol für eine ganze Stadt stehen (z. B. das roundel der London Underground).
Verbreitet sind insbesondere Zeichen, die auf den Namen des jeweiligen Systems Bezug nehmen. Entsprechend der weiten Verbreitung der Bezeichnung Metro (und seiner landessprachlichen Varianten) findet sich daher vor allem eine Vielzahl von Logos, die die Initiale „M“ aufgreifen, auch in Regionen, die nicht hauptsächlich das lateinische, kyrillische oder griechische Alphabet, in denen der Buchstabe „M“ identisch ist, verwenden. Andere Logos stellen illustrativ oder assoziativ den Themenkomplex Verkehr/Verbindung/Bewegung/Geschwindigkeit dar, verweisen auf die unterirdische Streckenführung oder sind weitgehend ungegenständlich. Verschiedene Betreiber (u. a. MARTA im Raum Atlanta, CTA im Raum Chicago, Metro Los Angeles, MTA im Staat New York, SEPTA im Raum Philadelphia, Toei in Tokio) verwenden allerdings kein spezifisches Logo für das jeweilige U-Bahn-System, sondern kennzeichnen alle von ihnen betriebenen Verkehrsmittel mit demselben Logo. Im Falle von Toei, dem Verkehrsamt der Präfektur Tokio, ist dieses identisch mit dem offiziellen Symbol der Präfektur.[55]
Während in den allermeisten Ländern jedes U-Bahn-System ein individuelles Zeichen verwendet, wird das Verkehrsmittel in Italien und Deutschland (s. u.) jeweils durch ein weitgehend einheitliches Logo gekennzeichnet. In den italienischen Metro-Städten Catania, Genua, Mailand, Neapel, Rom und Turin ist dies ein weißes, versales, in einer Groteskschrift gesetztes „M“ auf einer quadratischen roten Trägerfläche, wobei in Catania eine Modifikation durch Einbindung des Betreiberlogos und Kursivsetzung der M-Initiale erfolgt. Lediglich Brescia verwendet ein eigenes Logo.
- Deutschland, Österreich und die Schweiz

In den vier deutschen U-Bahn-Städten Berlin, Hamburg, München und Nürnberg wird die U-Bahn einheitlich durch ein weißes, versales, in einer Groteskschrift gesetztes „U“ auf einer quadratischen blauen Trägerfläche gekennzeichnet. Innerhalb dieses Grundaufbaus unterscheiden sich die Logos der einzelnen Systeme allerdings geringfügig in Größe und Proportionierung des U. Ein weißes U auf blauem Grund wurde in Berlin spätestens seit 1926 zur Kennzeichnung von Stationszugängen genutzt.[56] Als logoartiges Zeichen mit kompakter, jedoch zunächst kreisrunder Fläche wird es dort spätestens ab 1929 auf Liniennetzplänen verwendet,[35] eine rechteckige Version spätestens seit 1939.[20] Die heute gebräuchliche Form wurde im Juni 1991 eingeführt.[57]
Die deutschen Stadtbahnsysteme verwenden ebenfalls Logos nach dem genannten Muster bzw. hiervon abgeleitete Zeichen, teilweise in der Kombination „U-Stadtbahn“. Während das U-Logo bei den Voll-U-Bahnen zur Kennzeichnung aller Stationen unabhängig von ihrer Geländelage verwendet wird, beschränken verschiedene Betreiber von Stadtbahn-Systemen die Nutzung auf die Markierung unterirdischer bzw. nach U-Bahn-Standard ausgebauter Haltestellen und kennzeichnen andere Stationen mit dem regulären Verkehrszeichen 224 für Bus- und Straßenbahnhaltestellen.
Das von der einzigen österreichischen U-Bahn in Wien genutzte Logo ähnelt den bei den deutschen Systemen verwendeten, hat allerdings eine kreisförmige Trägerfläche.
Die Métro Lausanne verwendet eine stark abstrahierte Variante des Buchstaben „M“ in Form von drei parallelen, steigenden weißen Balken auf einer kreisförmigen, magentafarbenen Trägerfläche. Das Logo wurde mit der Eröffnung des Systems eingeführt.
Organisatorisches
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Eigentum und Betrieb
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Während die frühen U-Bahn-Systeme vorrangig als privatwirtschaftliche Unternehmungen entwickelt und betrieben wurden (siehe hier), vollzog sich im Laufe des 20. Jahrhunderts ein weitgehend flächendeckender Übergang von Planung, Bau, Eigentum und Betrieb in die öffentliche Hand einschließlich der Überführung bestehender Netze in öffentliches Eigentum (z. B. London 1933, Berlin 1938, New York 1940 und Paris 1949), sodass sich heute die Mehrheit der U-Bahn-Systeme in Europa, den Vereinigten Staaten, Kanada und Japan im öffentlichen Eigentum befindet. Hierbei sind gleichermaßen öffentlich-rechtliche wie privatrechtliche Organisations- und Rechtsformen verbreitet (siehe auch hier), wobei in Europa und Japan privatrechtlich verfasste Unternehmen im Eigentum der jeweiligen Kommune überwiegen, während Eigentum und Betrieb in den Vereinigten Staaten mehrheitlich in der Hand eigenständiger Nahverkehrsbehörden (engl. transportation/transit authorities) liegen, die vom jeweiligen Bundesstaat eingerichtet wurden und deren räumlicher Zuständigkeitsbereiche von einer Kernstadt und ihrem relativ eng gefassten Agglomerationsraum (z. B. Atlanta, Boston, Chicago) bis zu weitläufigen Stadtregionen (z. B. die Metropolitan Transportation Authority für große Teile der Tri-State area und die Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority für das gesamte Los Angeles County) reicht. Sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten ist der jeweilige Eigentümer und Betreiber eines U-Bahn-Netzes häufig auch der zentrale bzw. ein wesentlicher Betreiber des weiteren ÖPNV-Angebots in der jeweiligen Region, darüber hinaus obliegen den amerikanischen authorities häufig auch Planung, Organisation und Finanzierung sowie Ausbau und Unterhalt der physischen Infrastruktur für den gesamten ÖPNV in ihrem Zuständigkeitsbereich, womit sie in dieser Hinsicht den deutschen ÖPNV-Aufgabenträgern ähneln.[9][10][8][47][29][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69]
Verschiedene Netze befinden sich auch im alleinigen oder anteiligen Eigentum des jeweiligen Staates bzw. wurden durch ihn eingerichtet, hierzu gehören beispielsweise:
- Metro Bukarest – Metrorex S.A.: Verkehrsbetrieb in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft, die von der rumänischen Regierung gegründet wurde und direkt dem Verkehrsministerium untersteht. Die weiteren öffentlichen Verkehrsmittel in Bukarest (Straßenbahn, Oberleitungsbus und Stadtbus) werden von der städtischen Societatea de Transport Bucuresti STB SA betrieben.[60][70]
- Metro Delhi – Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (DMRC): Gemeinsamer Verkehrsbetrieb der indischen Bundesregierung und der Regierung des Nationalen Hauptstadtterritoriums Delhi (jeweils 50 %).[71]
- Métro Paris – Régie autonome des transports Parisien (RATP): Verkehrsbetrieb in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts (fr. établissement public, hier spezieller: établissement public à caractère industriel et commercial), die vom französischen Parlament durch Gesetz eingerichtet wurde und unter seiner Aufsicht steht.[72]
- U-Bahn Tokio – Tokyo Metro Co., Ltd.: Gemeinsamer Verkehrsbetrieb der japanischen Regierung (53,4 %) und der Regierung der Präfektur Tokio (46,6 %) in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft, der das größere der beiden Teilnetze der Tokioter U-Bahn betreibt. Die Gesellschaft entstand 2004 durch Privatisierung der staatlichen Nahverkehrsbehörde Teito Rapid Transit Authority, die wiederum durch die Verstaatlichung und Verschmelzung der privaten Tokyo Underground Railway Company und Tokyo Rapid Transit Railway Company im Jahr 1941 entstanden war. Das kleinere Teilnetz der U-Bahn wird durch Toei, das Verkehrsamt der Präfektur Tokio, betrieben, zu dem auch weitere Verkehrsmittel in Tokio gehören.[67]
Einzelne U-Bahnen befinden sich im Eigentum privater Unternehmen ohne (mehrheitliche) öffentliche Beteiligung, z. B. die privat finanzierte und betriebene Linie 9 der U-Bahn Seoul[73] oder die zum Netz der Metro Delhi gehörende Rapid Metro Gurgaon, deren Betrieb jedoch aufgrund finanzieller Engpässe im Jahr 2019 von der Delhi Metro Rail Corporation übernommen wurde.[74]
- Trennung von Infrastruktur und Betrieb
In verschiedenen Netzen erfolgt eine Trennung von Infrastruktur und Betrieb sowie teilweise auch von Planung und Ausbau, bei der nur einzelne der genannten Bereiche in der öffentlichen Hand verbleiben, während die anderen an Dritte vergeben werden, wobei hier neben Privatunternehmen auch öffentliche Unternehmen anderer Städte aktiv sind.
Beispielsweise wurde die Stockholm U-Bahn von 2001 bis 2009 durch ein Tochterunternehmen von Veolia Transport betrieben, während der Betrieb seit 2009 durch die zur mehrheitlich staatlichen Hongkonger MTR Corporation gehörende MTR Tunnelbanan AB erfolgt,[59] die wiederum 2025 den Betrieb an die Connecting Stockholm AB, ein Tochterunternehmen der britischen Go-Ahead-Gruppe und der Singapurer ComfortDelGro Corporation, übergeben wird.[75] Die physische Infrastruktur verbleibt dabei im Eigentum der Storstockholms Lokaltrafik AB, der Nahverkehrsplanungs- und -managementgesellschaft der Provinz Stockholm.
Ein Beispiel für die Vergabe der Infrastruktur an Private bei Verbleib des Betriebs in der öffentlichen Hand findet sich bei der London Underground; Transport for London (TfL), die für den Nahverkehr in Greater London zuständige Fachbehörde (engl. executive agency) der Greater London Authority, vergab Unterhaltung und Erneuerung der physischen Infrastruktur im Jahr 2002 in einem ÖPP-Modell für einen Zeitraum von 30 Jahren an die Privatunternehmen Tube Lines und Metronet, während der Fahrbetrieb weiterhin durch die London Underground Ltd., eine 100-prozentige Tochter von TfL, erbracht werden sollte. Infolge der Insolvenz von Metronet (2008) und Tube Lines (2010) wurden die ausgelagerten Aufgaben jedoch vorzeitig wieder von TfL übernommen.[47]
- Deutschland, Österreich und die Schweiz
Eigentum und Betrieb der U-Bahn-Systeme in Deutschland, Österreich und der Schweiz liegen jeweils in Hand eines (überwiegend) kommunalen Verkehrsunternehmens, das selbst oder durch eine Tochtergesellschaft auch einer der Hauptbetreiber des weiteren ÖPNV-Angebots in der jeweiligen Region ist.
Tarifierung und Fahrkarten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-
In der Mehrheit der japanischen Netze gelten entfernungsbasierte Preise für Einzelfahrten; im Bild ein Netzplan der U-Bahn Fukuoka mit Preisangaben ab Kaizuka (200 bis 350 Yen)
-
Historische Erste-Klasse-Fahrkarte der Métro Paris zum ermäßigten Preis, durch Lochung entwertet
-
Verschiedene Generationen von Zahlmarken der New York City Subway;
die MTA gab dieses System 2003 auf -
Der Preis für eine Metro-Fahrt betrug in allen Netzen der Sowjetunion von 1961 bis 1991 stabil 5 Kopeken und wurde direkt an der Bahnsteigsperre entrichtet
-
Smartcards wie die Oyster Card wurden seit der Jahrtausendwende weltweit in zahlreichen ÖPNV-Netzen eingeführt
Die rund 200 auf der Welt bestehenden U-Bahn-Systeme verwenden eine erhebliche Bandbreite unterschiedlicher Tarif- und hierauf aufbauender Fahrkartensysteme, die anhand folgender Merkmale grob beschrieben werden können:
- Grundsätzlich kann unterschieden werden zwischen Einheitstarifen, bei denen eine Fahrkarte stets für das gesamte Netz gilt, und Tarifen, bei denen der Preis nach einem bestimmten System individuell berechnet wird, beispielsweise auf Grundlage der zurückgelegten Strecke, der Anzahl der Stationen oder der durchquerten Tarifzonen/-ringe/-waben o. ä. In verschiedenen Netzen werden auch Karten angeboten, die grundsätzlich im gesamten Netz, jedoch nur für eine begrenzte Dauer (z. B. 60, 90 oder 120 Minuten) gelten.
- In zahlreichen Netzen wird ein differenziertes Fahrkartensortiment angeboten, das sich insbesondere an der unterschiedlichen Nutzungshäufigkeit orientiert (z. B. Einzelkarten für Gelegenheitsfahrer, Monatskarten für regelmäßige Nutzer, Mehrtages- und Wochenkarten z. B. für Touristen). Zu den Ausnahmen zählen beispielsweise das BART-System in der San Francisco Bay Area und die Metro Kolkata, für die ausschließlich Einzelkarten angeboten werden.[81][82]
- In verschiedenen Netzen werden die Fahrpreise nach Verkehrs- bzw. Tageszeit differenziert, beispielsweise wird in London während der Hauptverkehrszeiten ein Zuschlag für Einzelfahrten erhoben, während in Washington, D.C. und Vancouver am Abend und am Wochenende ein vergünstigter Einheitstarif anstatt des sonst angewendeten Entfernungs- bzw. Zonentarifs gilt.[47][9][11] Ebenso gibt es Tages- und Zeitkarten, die erst ab einem bestimmten Zeitpunkt (z. B. 9 oder 10 Uhr) bzw. nur zu bestimmten Zeiten (z. B. nur außerhalb der Hauptverkehrszeiten oder nur in den Abend- und Nachtstunden) genutzt werden können, jedoch günstiger als ganztägig gültige Karten sind.[83][84][85] Historisch gab es zudem vereinzelt Nachtzuschläge, so kostete eine Fahrt mit der Prager Metro zwischen 23 und 4 Uhr drei statt sonst einer Krone.
- In verschiedenen Netzen werden für bestimmte Strecken pauschale Zuschläge erhoben, die sich nicht in die sonstige Preisberechnungssystematik einfügen, beispielsweise für Fahrten durch die Transbay Tube unter der Bucht von San Francisco und für Fahrten zu den Flughäfen in Madrid und Barcelona.[11][86][87]
- Während verschiedene Netze weiterhin einfache Papierfahrkarten verwenden, nutzt eine große Anzahl von Systemen mittlerweile vorrangig oder ausschließlich elektronische Medien wie Magnetstreifenkarten, kontaktlose Smartcards und Mobilgeräte zur Speicherung von Fahrkarten oder Guthaben bzw. der entsprechenden digitalen Information, die elektronisch ausgelesen bzw. mittels RFID/NFC übertragen werden kann. In verschiedenen Netzen können zudem auch direkt reguläre Kredit- und Debitkarten mit denselben Funktionen verwendet werden.[88][89] In verschiedenen Netzen mit Einheitstarif werden jetonartige Zahlmarken aus Metall oder Kunststoff verwendet, die an der Bahnsteigsperre (s. u.) eingeworfen und dort einbehalten werden. Historisch war zudem in einigen Netzen der Einwurf gewöhnlicher Kursmünzen möglich (s. u.).
- Fahrkarten werden grundsätzlich vor dem Fahrtantritt gekauft, im Zuge der Digitalisierung des Fahrkartenwesens insbesondere seit Ende der 1990er Jahre wurde jedoch in zahlreichen Netzen eine automatische Fahrpreisberechnung als Alternative zum Vorabkauf eingeführt. Der Fahrgast bucht sich hierbei vor Fahrtbeginn ein und nach Fahrtende wieder aus und das System rechnet automatisch die für die zurückgelegte Strecke erforderliche Fahrkarte von einem vorher aufgeladenen Guthaben oder über eine hinterlegte Bankverbindung ab. Teilweise gilt hierbei eine automatische Preisobergrenze (engl. price/fare cap), bei der automatisch das jeweils günstigste Ticket abgerechnet wird und beispielsweise ab einer bestimmten Zahl von Einzelfahrten anstelle individueller Einzelkarten eine günstigere Tages- oder Wochenkarte berechnet wird.[90][91] Ebenso erlauben verschiedene Systeme, beispielsweise in Japan, für den Fall, dass für eine absolvierte Fahrt eine unzureichende Fahrkarte gelöst wurde, eine Nachzahlung bis zum Preis der korrekten Fahrkarte, ohne dass dies als Beförderungserschleichung bestraft wird.[67]
- Fahrkartenkontrolle
-
Zwei Fahrgäste der New York City Subway werfen Zahlmarken in eine Bahnsteigsperre ein, 1974
-
Moderne hohe Bahnsteigsperre in der Station Alby, Stockholms län, ausschließlich für kontaktlose Trägermedien
-
Ein Mann überspringt eine halbhohe Bahnsteigsperre in Moskau
-
Drehkreuze am Ausgang der Station
57th Street–Seventh Avenue in New York;
das Durchschreiten erfolgt ohne vorherige Fahrkartenkontrolle -
Nachzahlautomat (Fare Adjustment Machine) der Tōkyō Metro
-
Offener Zu- und Abgang in Hamburg; der fahrkartenpflichtige Bereich wird durch das in den Boden eingelassene Messingband markiert
In der Mehrheit der U-Bahn-Netze wird der Zugang zum und teilweise auch der Abgang vom Bahnsteig bzw. fahrkartenpflichtigen Bereich durch automatische Bahnsteigsperren reguliert, die sich gegen Vorlage einer gültigen Fahrkarte öffnen, sodass der Nachweis des Kartenbesitzes bereits vor Fahrtantritt erbracht werden muss. Abhängig von der Bauweise der Sperren und der Kooperationsbereitschaft anderer Fahrgäste besteht allerdings teilweise die Möglichkeit, Sperren zu übersteigen, zu durchkriechen oder sie gemeinsam mit einer anderen Person zu passieren, weshalb auch in Systemen mit Bahnsteigsperren teilweise Fahrkartenkontrolleure eingesetzt werden und/oder die Sperren zusätzlich durch Personal überwacht werden. In Netzen mit Einheitstarif, in denen der Preis unabhängig von der zurückgelegten Entfernung ist, wird häufig nur der Zugang kontrolliert, während der Abgang über Drehkreuze, sensorgesteuerte Automatiktore oder offene, teilweise überwachte Tore frei möglich ist. In Netzen mit individuell berechnetem Tarif wird hingegen auch der Ausgang kontrolliert, um sicherzustellen, dass die gelöste Fahrkarte für die gesamte zurückgelegte Strecke gültig ist. Wird hierbei eine Differenz festgestellt, kann in verschiedenen Systemen, u. a. in den meisten japanischen, eine Nachzahlung am Automaten und/oder beim Stationspersonal geleistet werden, ohne dass dies als Beförderungserschleichung bestraft wird.
In der geringeren Zahl der Systeme, darunter jenen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, werden keine Bahnsteigsperren eingesetzt und der fahrkartenpflichtige Bereich einer Station ist hier physisch frei zugänglich. Die Prüfung des Fahrkarten- oder Bahnsteigkarten-Besitzes erfolgt hier stichprobenartig durch Prüfdienste in den Zügen und auf den Stationen. In solchen Netzen werden häufig Fahrkartenentwerter verwendet, um die Karte vor Fahrtantritt mit Zugangszeit, -datum und -station auszuzeichnen, sodass die Fahrkarte nur einmalig verwendet und die Einhaltung einer zeitlich oder auf eine bestimmte Entfernung beschränkten Gültigkeit vom Prüfpersonal nachvollzogen werden kann. Eine Ausnahme hiervon ist beispielsweise Hamburg, da Einzel- und Tageskarten des Hamburger Verkehrsverbunds immer mit dem Ausgabeort versehen und bereits ab Kauf entwertet und ausschließlich zur sofortigen Verwendung vorgesehen sind. Außerhalb des deutschsprachigen Raums verwenden u. a. die U-Bahnen von Helsinki und Kopenhagen keine Bahnsteigsperren. Im englischsprachigen Raum, wo dieses System weniger verbreitet ist, wird es als proof-of-payment (dt. Zahlungsnachweis) bezeichnet.
- Tarifliche Integration

Ein aus Fahrgastperspektive besonders interessanter Aspekt ist die tarifliche Integration der U-Bahn und der weiteren öffentlichen Verkehrsmittel der jeweiligen Region, das heißt die Möglichkeit zur Nutzung des gesamten ÖPNV mit derselben Fahrkarte.
Das Niveau der Integration unterscheidet sich zwischen den verschiedenen Netzen; während die U-Bahn-Systeme in Europa und Kanada im Rahmen organisatorischer Strukturen wie Verkehrsverbünden mehrheitlich vollständig in das jeweilige Nahverkehrsnetz integriert sind, werden in den Vereinigten Staaten und Japan überwiegend keine einheitlichen oder nur teilweise integrierte Tarifsysteme verwendet, sodass bei der Nutzung der Verkehrsmittel unterschiedlicher Betreiber – und teilweise bei der Nutzung verschiedener Verkehrsmittel desselben Betreibers – separate Fahrkarten erforderlich sind. In den Vereinigten Staaten wird lediglich bei den Systemen in Atlanta, Boston, Cleveland, Honolulu, San Juan und Washington, D.C. ein einheitliches Tarifsystem für alle öffentlichen Verkehrsmittel der jeweiligen Region angewendet. In den anderen amerikanischen und in den japanischen Systemen werden jedoch teilweise kombinierte Karten für Verkehrsmittel verschiedener Betreiber bzw. die verschiedenen Verkehrsmittel desselben Betreibers, die günstiger als separat gelöste Fahrkarten sind, oder vergünstigte Umsteige-/Anschlusstarife angeboten. Zudem vereinfachen die verstärkt seit Ende der 1990er Jahre in zahlreichen Verkehrsnetzen eingeführten elektronischen Fahrkartensysteme das Reisen, indem sie Zahlung und Verwaltung der Fahrkarten der verschiedenen Betreiber mit einem einzigen Medium erlauben.[9][10][8][47][29][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69]
- Staaten des RGW
In der Sowjetunion galt von der Währungsreform des Jahres 1961 bis zur Auflösung der Union im Jahr 1991 landesweit in allen U-Bahnen einschließlich der beiden Metrotram-Systeme ein Einheitstarif von 5 Kopeken für eine Einzelfahrt. Dies war der gleiche Preis wie für eine Autobusfahrt, wohingegen der Oberleitungsbus (4 Kopeken) und die Straßenbahn (3 Kopeken) günstiger waren.[92] Auf den Stationen wurde direkt die entsprechende Kursmünze in die Bahnsteigsperren eingeworfen, ohne hierfür eine Fahrkarte bzw. einen Zahlungsbeleg zu erhalten. Fahrgäste konnten damit die Metro inklusive beliebiger Umstiege bis Betriebsschluss zeitlich unbegrenzt benutzen, solange sie den fahrkartenpflichtigen Bereich nicht verließen.[93][94] Zeitkarten wurden demgegenüber als Sichtkarten beim Stationspersonal vorgezeigt, das bei Bedarf auch passendes Kleingeld für die Passage der Münzsperren wechselte. Die Verwendung von Kursmünzen anstelle von Papierfahrkarten oder spezieller Zahlmarken für Einzelfahrten wurde in den 1970er Jahren auch bei den zu dieser Zeit neu eröffneten bzw. wesentlich erweiterten Betrieben in Budapest (1 Forint), Bukarest (1 Leu) und Prag (1 Krone) übernommen, jedoch um 1990 herum aufgegeben.
- Deutschland, Österreich und die Schweiz
Die U-Bahnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind jeweils Teil eines Verkehrsverbunds und tariflich vollständig mit den weiteren öffentlichen Verkehrsmitteln in ihrer jeweiligen Region integriert. Sie sind zudem in die nationalen (Nah-)Verkehrstickets der drei Länder (Deutschlandticket, KlimaTicket und Generalabonnement) integriert, ebenso gelten in Deutschland die jeweiligen Ländertickets.
| System | Verkehrs- und Tarifverbund | für das U-Bahn-Netz gültiges Tarifsystem | |
|---|---|---|---|
| U-Bahn Berlin |  |
Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg |
|
| U-Bahn Hamburg | Hamburger Verkehrsverbund |
| |
| U-Bahn München | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund |
| |
| U-Bahn Nürnberg |  |
Verkehrsverbund Großraum Nürnberg | |
| U-Bahn Wien | Verkehrsverbund Ost-Region |
| |
| Métro Lausanne |  |
Communauté tarifaire Vaudoise |
|
Geschichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste unterirdische Bahnstrecken in London
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die erste unterirdische Eisenbahnstrecke der Welt war die 6 Kilometer lange Metropolitan Railway, die am 10. Januar 1863 zwischen den Bahnhöfen Paddington und Farringdon in London eröffnet wurde. Sie ist bis in die Gegenwart in Betrieb und ging später in den Subsurface-Linien der Londoner U-Bahn (Metropolitan Line, Circle, Hammersmith & City und District Line) auf.
Die Tunnelstrecke der Metropolitan Railway wurde anfänglich mit dampflokomotivbespannten Zügen befahren, was jedoch auf Dauer keine akzeptable Lösung darstellte und außer bei der Wiener Stadtbahn keine Nachahmung in anderen Städten fand. Ein wichtiger Schritt für die Entwicklung des unterirdischen Stadtverkehrs war daher die Einführung elektrischer Fahrmotoren. Die erste elektrisch betriebene U-Bahn, die somit auch dem heutigen Verständnis des Verkehrsmittels entspricht, war die City and South London Railway, die am 4. November 1890 ebenfalls in London zwischen Stockwell und King William Street eröffnet wurde. Wie die Ursprungsstrecke der Metropolitan Railway ist auch die der City and South London Railway bis heute erhalten und bildete die Grundlage der heutigen Northern Line der Londoner U-Bahn.
Zentrale Gründe für die Elektrifizierung waren die höhere Effizienz elektrischer Traktion gegenüber Dampflokomotiven[101] (bei Einsatz desselben Primärenergieträgers ist der Wirkungsgrad der Kombination von Dampfkraft[102] und Elektromotor doppelt bis viermal so hoch)[103] und die so ermöglichte Vermeidung von Abgasen und Abdampf im Tunnel,[104] die neben einer gesundheitlichen Belastung von Fahrgästen und Personal eine Feuergefahr darstellten und die Kühlgrenztemperatur im Tunnel erheblich erhöhen konnten, da sie sowohl Abwärme abgaben als auch die Luftfeuchtigkeit durch Emission von Wasserdampf erhöhten. Für Betriebsfahrten im Tunnel wurden speziell entwickelte abgasärmere Dampflokomotiven verwendet, beispielsweise auf der Central Line.[105] Mittlerweile werden für derartige Zwecke Akkumulator- oder Diesellokomotiven oder Fahrzeuge verwendet, die die reguläre Stromversorgung der U-Bahn-Fahrzeuge über Stromschiene oder Oberleitung nutzen.
Eine bedeutende eisenbahn- und technologiegeschichtliche Leistung der City and South London Railway lag im Nachweis der Verlässlichkeit und Alltagstauglichkeit des elektrischen Antriebs für Bahnen, womit die zentrale Voraussetzung für deren weitere Verbreitung geschaffen wurde.
Frühe U- und Hochbahnen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die ersten U-Bahn-Systeme außerhalb Londons entstanden in Haupt- und Großstädten West- und Mitteleuropas und der Vereinigten Staaten, die über den verkehrlichen Bedarf für ein entsprechendes Massenverkehrsmittel, das für Planung und Bau erforderliche ingenieurtechnische Wissen und die Fähigkeit zur Mobilisierung des erforderlichen öffentlichen und/oder privaten Kapitels verfügten.
Europa
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Liverpool

Die erste elektrische städtische Bahn des Vereinigten Königreichs außerhalb Londons und die erste elektrische Hochbahn der Welt war die am 4. Februar 1893 eröffnete Liverpool Overhead Railway (LOR). Die anfangs rund 10 Kilometer lange Nord-Süd-Strecke verlief zwischen dem Alexandra Dock und dem Herculaneum Dock durch das Liverpooler Hafengebiet entlang des Mersey. Im Rahmen einer 1896 fertiggestellten Verlängerung erhielt die Bahn den etwas landeinwärts gelegenen Tunnelbahnhof Dingle als neuen südlichen Endpunkt, 1905 erfolgte im Norden eine Verlängerung zum Bahnhof Seaforth & Litherland der Lancashire and Yorkshire Railway, über deren Netz die Züge der LOR zwischen 1906 und 1914 bis nach Southport durchgebunden wurden. Zudem gab es zwischen 1906 und 1908 regelmäßige, danach bis in die 1950er Jahre sporadische Verbindungen in die Ortschaft Aintree am Rande Liverpools. Der Betrieb erfolgte über Stromschiene, der Namensbestandteil Overhead bezog sich entsprechend nicht auf eine Elektrifizierung mit Oberleitung (engl. overhead line), sondern auf die Führung der Strecke über Kopfhöhe.
Da keine Mittel für die dringend erforderliche Sanierung und Modernisierung des Systems zur Verfügung standen, wurde die Strecke am 30. Dezember 1956 stillgelegt und der Viadukt bereits 1957/1958 zurückgebaut.[106] Die LOR ist damit das einzige U-Bahn-System der Welt, das vollständig eingestellt wurde.
- Budapest

Die erste elektrische Untergrundbahn auf dem europäischen Festland und nach der Londoner City and South London Railway die zweite auf der Welt wurde am 2. Mai 1896 mit der Földalatti in Budapest nach Entwurf des Berliner Unternehmens Siemens & Halske eröffnet. Sie verlief über eine Strecke von rund 3,7 Kilometern größtenteils in einfacher Tiefenlage unter der Prachtstraße Andrássy út vom Gizella tér (heute: Vörösmarty tér) in der Innenstadt zum Széchenyi-Heilbad und dem Stadtwäldchen. Die ursprüngliche oberirdische Endstation dort wurde 1973 im Zuge der Verlängerung der Linie nach Mexikói út aufgelassen und durch eine Tunnelstation ersetzt. Die Strecke wurde in offener Bauweise errichtet, aufgrund eines die Trasse kreuzenden Abwasserkanals wurde die Tunnelhöhe auf lediglich 2,85 Meter begrenzt, weshalb für die Bahn ein spezielles, sehr niedriges Fahrzeug konstruiert werden musste. Die Stromversorgung erfolgte über eine direkt unter der Tunneldecke montierte Oberleitung.
Die Földalatti diente Siemens & Halske auch als Test- und Demonstrationsanlage für das neuartige Verkehrsmittel U-Bahn, nachdem die seit den 1880er Jahren laufenden Verhandlungen des Unternehmens über den Bau eines entsprechenden Vorhabens in Berlin noch andauerten (s. u.).[61]
- Glasgow

Am 14. Dezember 1896 ging mit der Glasgow District Subway die dritte Untergrundbahn der Welt, die dritte Metro des Vereinigten Königreichs und das bis heute einzige System Schottlands in Betrieb. Sie befährt eine rund 10½ Kilometer lange, vollständig im Tunnel liegende Ringstrecke in der Innenstadt und den westlich und südlich davon gelegenen Stadtteilen nördlich und südlich des Clyde. Sie verband zum Zeitpunkt ihrer Eröffnung u. a. die innerstädtischen Fernbahnhöfe St. Enoch (1966 stillgelegt) und Queen Street (über die Station Buchanan Street), zudem liegt der Fernbahnhof Glasgow Central in fußläufiger Entfernung zur Station St. Enoch.
Erste Überlegungen für das System wurden 1887 vorgelegt und sahen eine Ost-West-Strecke zwischen dem Stadtzentrum rund um Buchanan und Argyle Street und dem vornehmen West End vor, 1888 wurden die Planungen durch eine Strecke südlich des Clyde und zwei Verbindungen unter dem Fluss hindurch zu einer Ringstrecke erweitert. Die Bauarbeiten wurden 1891 aufgenommen, der Großteil der beiden eingleisigen Tunnelröhren wurde bergmännisch und zu großen Teilen unter bestehenden Straßen erstellt, südlich des Clyde entstanden zwei kurze Abschnitte in offener Bauweise. Die tiefer gelegenen Tunnelabschnitte, die u. a. zur Unterquerung des Flusses erforderlich waren, wurden im Schildvortrieb aufgefahren.
Der Betrieb erfolgte zunächst mit Kabelantrieb, ab 1935 elektrisch über eine seitliche Stromschiene. Die Subway verwendet die seltene Spurweite von 1219 mm (4 englische Fuß), die ansonsten hauptsächlich bei Straßen- und einigen Nebenbahnen eingesetzt wurde, und hat einen Tunneldurchmesser von lediglich 3,35 Metern, weshalb nach heutigen Vorstellungen ungewöhnlich kompakte Fahrzeuge mit einer Breite von lediglich 2,34 Metern und einer lichten Höhe im Innenraum von weniger als 2 Metern eingesetzt werden. Eine weitere Besonderheit ist, dass das System seit seiner Eröffnung nie erweitert wurde.[106][47]
- Paris

Die Stadt Paris und die Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris nahmen am 19. Juli 1900 den ersten Abschnitt der heutigen Linie 1 der Métro und damit die fünfte U-Bahn Europas in Betrieb. Sie verlief auf einer rund 10,3 Kilometer langen, vollständig unterirdischen Ost-West-Strecke von der Porte Maillot an der westlichen Stadtgrenze über das Zentrum am nördlichen Ufer der Seine bis zur Porte de Vincennes am östlichen Rand der Stadt. Sie folgte dabei zu großen Teilen dem bestehenden Straßennetz und verband eine Reihe bedeutender öffentlicher Einrichtungen und Bauwerke miteinander, darunter den Arc de Triomphe, die Avenue des Champs Élysées, die Place de la Condorde, das Louvre-Museum, das Pariser Rathaus sowie das Ausstellungsgelände der Weltausstellung von 1900 (siehe auch hier).
Die Stadt Paris war selbst Initiator und wesentliche planende, steuernde und finanzierende Instanz beim Bau der Métro und verfolgte von Anfang an den Aufbau eines sinnvoll strukturierten Gesamtnetzes. Dieses hatte eine Gesamtlänge von rund 65 Kilometern und setzte sich aus jeweils zwei Durchmesserlinien in Ost-West- (heutige Linien 1 und 3) und Nord-Süd-Richtung (Linien 4 und 5) sowie einer auf zwei Linien aufgeteilten Ringstrecke (Linien 2 und 6) zusammen. Die Bauarbeiten wurden im Frühjahr 1898 aufgenommen, die Umsetzung des gesamten Grundnetzes erfolgte bis 1910. Parallel wurden zudem umfassende Ausbauplanungen erarbeitet, deren Umsetzung sich aufgrund des Ersten Weltkriegs jedoch größtenteils bis in die 1930er Jahre verzögerte. Zudem baute die unabhängige Société du chemin de fer électrique souterrain Nord-Sud de Paris gleichzeitig zur Umsetzung des städtischen Netzes zwei private Nord-Süd-Strecken (heutige Linien 12 und 13), die 1910 und 1911 in Betrieb genommen wurden.[107]
- Wuppertal
1901 nahmen die bergischen Industriestädte Barmen und Elberfeld unter dem Namen Einschienige Hängebahn System Eugen Langen das heute als Wuppertaler Schwebebahn bekannte System in Betrieb. Die Hängebahn bildet eine Sonderform der Hochbahn, bei der die Züge nicht auf Schienen fahren, sondern unter dem Fahrbalken hängen. Nach heutigem deutschem Recht gehören Schwebebahnen wie U-Bahnen zur Gruppe der unabhängigen Bahnen innerhalb der Straßenbahnen (vgl. § 1 Abs. 2 Nr. 2 BOStrab i. V. m. § 4 Abs. 2 PBefG), werden allerdings durch den UITP nicht als U-Bahnen bzw. Metros anerkannt (siehe hier).
- Berlin

Die erste U-Bahn Deutschlands wurde am 15. Februar 1902 von der privaten Hochbahngesellschaft mit der Elektrischen Hoch- und Untergrundbahn in Berlin eröffnet. Der erste Teil der sogenannten Stammstrecke führte vom Bahnhof Potsdamer Platz über rund 6 Kilometer nach Osten bis Stralauer Tor (östlich von Schlesisches Tor; ab 1924 Osthafen, im Zweiten Weltkrieg zerstört und nicht wieder aufgebaut). Der zweite Hauptteil der Stammstrecke zum Bahnhof Zoologischer Garten folgte knapp einen Monat später am 11. März 1902, die beiden verbliebenen kurzen Teilstücke nach Warschauer Brücke (heute: Warschauer Straße) und Knie (heute: Ernst-Reuter-Platz) gingen bis Ende desselben Jahres in Betrieb. Die Stammstrecke verlief größtenteils als Hochbahn, lediglich die Station Potsdamer Platz und der in Charlottenburg gelegene Abschnitt verliefen im Tunnel.
In rascher Folge wurden Erweiterungen umgesetzt, bis zum Jahr 1913 wurde – unter Einbeziehung der zur gleichen Zeit gebauten kommunalen U-Bahnen der damals selbstständigen Städte Schöneberg, Wilmersdorf und Dahlem – eine Streckenlänge von rund 36 Kilometern erreicht. Ab 1912 nahmen die Stadt Berlin und die AEG zudem Planungen für eigene Nord-Süd-Strecken zwischen Seestraße und Belle-Alliance-Straße (heute: Mehringdamm; U6) zur Erschließung der Innenstadt und zwischen Gesundbrunnen und Neukölln (U8) auf. Die Bauarbeiten für beide Strecken wurden vor Beginn des Ersten Weltkriegs aufgenommen, jedoch erst nach Kriegsende abgeschlossen. Bereits ab 1908 hatte die Hochbahngesellschaft zudem Planungen für eine Ost-West-Strecke zwischen Alexanderplatz und Friedrichsfelde erarbeitet (heute: U5), die jedoch erst nach dem Krieg weitergeführt wurden.
Dem U-Bahn-Bau ging ein längerer Planungs- und Abstimmungsprozess voraus; bereits ab 1880 hatten Siemens & Halske und die AEG der Stadt Berlin verschiedene konkurrierende Projektvorschläge für Hoch- und Untergrundbahnen vorgelegt, die jedoch u. a. mit Verweis auf fehlende Erfahrungen mit dem Bau von Eisenbahntunneln und elektrisch betriebenen Bahnen, der für den Tunnelbau ungeeigneten Beschaffenheit des Berliner Untergrundes und aus städtebaulich-stadtgestalterischen Gründen abgelehnt wurden. Nach umfangreichen Entwürfen und Erörterungen erreichte Siemens & Halske zuletzt die Zustimmung für den Bau eines Netzes, der Baubeginn erfolgte am 10. September 1896, rund vier Monate nach Eröffnung der vom Unternehmen für Budapest entworfenen und gebauten Földalatti. Am 12. April 1897 gründete Siemens & Halske gemeinsam mit der Deutschen Bank die Hochbahngesellschaft als Betreiber der künftigen U-Bahn.[20]
Parallel zur Umsetzung der Planung von Siemens & Halske eröffnete die AEG am 18. Dezember 1899 den Spreetunnel Stralau–Treptow, den ersten Unterwassertunnel und ersten im Schildvortrieb errichteten Tunnel Deutschlands. Dieser wurde durch die Straßenbahn der Berliner Ostbahnen befahren und diente der AEG als Versuchsanlage für den Bau von U-Bahn-Tunneln.
- Athen
1904 wurde die rund 9,7 Kilometer lange Vorortbahn zwischen Piräus und Athen elektrifiziert. Die Strecke verlief größtenteils oberirdisch, verfügte in Athen jedoch über einen mehrere hundert Meter langen Tunnel vor der 1895 eröffneten Endstation Omonia. Die Strecke wurde bis 1957 in insgesamt sechs Etappen nach Nordosten bis Kifissia verlängert und im Jahr 2000 nach umfangreichen Modernisierungen als Linie 1 in das zu diesem Zeitpunkt neu geschaffene Netz der Metro Athen integriert. Bis dahin wurde die Bahn lediglich Ilektrikós (dt. Elektrische) genannt.[60]
- Hamburg

Die letzte Eröffnung eines europäischen Betriebs vor Beginn des Ersten Weltkriegs erfolgte exakt zehn Jahre nach Eröffnung der Berliner Hoch- und Untergrundbahn am 15. Februar 1912 mit Inbetriebnahme der Hamburger Hochbahn. Die erste Strecke führte über rund 6,6 Kilometer vom Bahnhof Barmbeck (heute: Barmbek) über Berliner Tor und den erst sechs Jahre zuvor eröffneten Hauptbahnhof zum Rathaus im Zentrum der Innenstadt. Sie war Teil einer rund 17,5 Kilometer langen Ringstrecke durch die innere Stadt, die in drei weiteren Etappen schon bis zum 29. Juni 1912 vervollständigt wurde. Bis September 1915 wurden zudem Anschlussstrecken zum Hellkamp in Eimsbüttel, nach Ohlsdorf und nach Rothenburgsort (im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt und anschließend abgebaut) fertiggestellt, sodass die Gesamtlänge des Netzes rund 27,9 Kilometer erreichte. Die Ringstrecke und der Ast nach Rothenburgsort verliefen größtenteils in Hochlage auf Viadukten, im nördlichen Teil des Rings auch auf einem Bahndamm, im Tunnel verliefen die Strecken in der Innenstadt, in Eimsbüttel und auf St. Pauli. Die Tunnelstrecken waren jeweils in offener Bauweise und mit Ausnahme der Stationen am Hauptbahnhof und am Berliner Tor in einfacher bzw. geringer Tiefenlage unter dem Straßenniveau angelegt worden.
Wie der Berliner Hoch- und Untergrundbahn ging der Hamburger Hochbahn eine längere Planungsgeschichte voraus; bereits Mitte der 1890er Jahre, das heißt während des Baus der Budapester Földalatti und etwa zum Zeitpunkt der Finalisierung der Berliner Planungen, trugen Siemens & Halske und AEG dem Senat einen gemeinsamen Entwurf für eine elektrische Hoch- und Untergrund nach Berliner Vorbild an. Nach einem eingehenden Systemvergleich, in dessen Rahmen u. a. auch eine Hängebahn nach Wuppertaler Vorbild und eine Unterpflasterstraßenbahn untersucht worden waren, entschieden sich Senat und Bürgerschaft für die grundsätzliche Verfolgung des Vorschlags des Berliner Konsortiums. Die Planungen wurden in enger Abstimmung mit Hamburg vertieft und sahen zuletzt die besagte Ringstrecke und ihre drei Anschlussstrecken vor. Der Beschluss der Bürgerschaft zur Beauftragung des Konsortiums mit dem Bau erfolgte am 2. Mai 1906, der Baubeginn folgte am 7. Oktober desselben Jahres.
Anders als Berlin hatte sich Hamburg bereits früh für die Finanzierung der U-Bahn aus dem eigenen Haushalt und die Trennung von Infrastruktur und Betrieb entschieden. Die Gründung der Hamburger Hochbahn AG (HHA) als gemeinsame Betriebsgesellschaft von Siemens & Halske und AEG erfolgte am 27. Mai 1911, nachdem das Konsortium im Vergabeverfahren als einziger Interessent eine Bewerbung eingereicht hatte.[108]
Nord- und Südamerika
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Parallel zur Entwicklung in Europa wurden rund um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert auch in den Metropolen der Ostküste der Vereinigten Staaten und in Chicago sowie im argentinischen Buenos Aires erste U-Bahn-Netze aufgebaut.
- Boston


Die Stadt Boston nahm im März 1895 die Arbeiten an der Tremont Street Subway auf, einem Straßenbahntunnel, mit dem ein Großteil des sehr dichten innerstädtischen Straßenbahnverkehrs unter die Erde geführt und so sowohl der Nahverkehr verbessert als auch die Oberfläche entlastet werden sollte. Der Tunnel wurde zwischen September 1897 und September 1898 in mehreren Etappen zwischen Boylston im Süden und Haymarket in der Nähe des nördlichen Hauptbahnhofs North Station in Betrieb genommen und war die erste unterirdische Schienenstrecke auf dem amerikanischen Kontinent.
Parallel zum Bau der städtischen Subway beauftragte Boston die private Boston Elevated Railway Company mit dem Bau einer Hochbahn, die Ausgangspunkt der heutigen Orange Line der Boston Subway wurde. Die Bauarbeiten begannen im März 1899, die Eröffnung erfolgte im Sommer 1901; zunächst ging am 10. Juni die Main Line Elevated von Sullivan Square im Norden über die North Station und die Innenstadt bis Dudley im Süden in Betrieb, am 22. August folgte mit der Atlantic Avenue Elevated eine zweite Strecke durch den zentralen Stadtbereich, die südlich der Station City Square nach Osten aus der Main Line ausfädelte, in südliche Richtung über den Hafen führte und nördlich von Dover wieder in die Main Line einfädelte. Die Bahn war nach der Metropolitan West Side Elevated Railroad in Chicago (s. u.) die zweite in Amerika, die von Anfang an mit elektrischen Triebzügen betrieben wurden.
In der Innenstadt wurde die Main Line anfangs über die Tremont Street Subway geführt, nachdem sich die Stadt dort aus städtebaulichen Gründen gegen eine Führung als Hochbahn entschieden hatte. Die größtenteils viergleisig ausgebaute Subway gab hierfür die äußeren Gleise an die Elevated ab, während die inneren Gleisen weiterhin von der Straßenbahn genutzt wurden. Der lediglich zweigleisige Abschnitt zwischen Park Street und Scollay Square (heute: Government Center) wurde vollständig an die Elevated abgegeben, sodass kein durchgehender Straßenbahnbetrieb durch die Subway mehr möglich war, was deren Attraktivität erheblich schmälerte. Die Elevated wurde daher bereits im November 1908 in eine neu gebaute separate Tunnelstrecke unter der östlich parallel verlaufenden Washington Street verlegt, sodass der durchgehende Straßenbahnbetrieb durch die Subway wieder aufgenommen werden konnte – sie ist heute Teil der Stammstrecke der Green Line. Der Streckenverlauf erfuhr im Laufe des 20. Jahrhunderts weitere umfassende Änderungen, sodass der Verlauf der heutigen Orange Line im Wesentlichen vollständig von dem der ursprünglichen Elevated abweicht; die Hafenstrecke wurde 1938 aufgrund der zwischenzeitlich deutlich zurückgegangenen Nachfrage stillgelegt und die beiden Außenstrecken wurden in den 1970er und 1980er Jahren durch weiter westlich gelegene Neubaustrecken ersetzt.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts nahm Boston die Arbeiten an der Cambridge-Dorchester Line, der späteren Red Line, auf, um die bereits damals bedeutenden Hochschuleinrichtungen in Cambridge mit der Bostoner Innenstadt und dem Stadtteil South Boston zu verbinden. Zur Erhöhung der Beförderungskapazität wurden ein größeres Fahrzeugprofil als bei der Orange Line sowie größere Kurvenradien und Stationsabstände zur Erhöhung der Reisegeschwindigkeit gewählt. Die Linie wurden am 23. März 1912 zwischen Harvard und Park Street Under (heute: Park Street) eröffnet, im Süden wurde die Strecke zwischen April 1915 und Juni 1918 in insgesamt vier Etappen bis Andrew verlängert. Die Strecke verläuft größtenteils unterirdisch, lediglich die Querung des Charles River zwischen Cambridge und Boston erfolgte oberirdisch über die Longfellow Bridge. Die Tunnel wurden überwiegend in offener Bauweise hergestellt, unter dem Beacon Hill im Westen der Bostoner Innenstadt bergmännisch und zwischen South Station und Broadway unter dem Fort Point Channel im Schildvortrieb. In den 1920er Jahren wurde die Linie größtenteils auf ehemaligen Strecken der Old Colony Railroad nach Dorchester verlängert, der heutige südwestliche Endpunkt Ashmont wurde 1928 erreicht. Auf Netzplänen wird zudem die 1929 eröffnete Ashmont–Mattapan High Speed Line als Teil der Red Line dargestellt, es handelt sich hierbei allerdings um eine Straßenbahnstrecke ohne durchgebundenen Betrieb.
Im Dezember 1904 wurde mit dem East Boston Tunnel einer zweiter Straßenbahntunnel eröffnet, der Grundlage der heutigen Blue Line ist. Er verband Court Street (heute: Government Center) in der Innenstadt unter dem Boston Harbor hindurch mit East Boston, 1916 wurde der Tunnel von Court Street bis Bowdoin verlängert und an das dortige oberirdische Straßenbahnnetz angeschlossen. Die Umstellung auf U-Bahn-Betrieb erfolgte 1924.[9]
- New York City


Im heutigen New Yorker Bezirk Manhattan entstand bereits zwischen 1868 und 1880 ein Netz normalspuriger Hochbahnstrecken, das zum großen Teil den Verläufen der 2nd, 3rd, 6th und 9th Avenue von Lower Manhattan im Süden bis an den Harlem River im Norden folgten und mit dampfbespannten Zügen betrieben wurde. Ab 1885 entstand im heutigen Bezirk Brooklyn ein separates, im Wesentlichen nach denselben Parametern wie in Manhattan geplanten Hochbahnnetz, das im Wesentlichen radial vom Brooklyner Zentrum am East River im Nordwesten ausging. Die Strecken in Manhattan wurde bis Ende des 19. Jahrhunderts von der Manhattan Railway Company übernommen, in Brooklyn erfolgte parallel die Übernahme durch die Brooklyn Rapid Transit Company (BRT, ab 1923 Brooklyn-Manhattan Transit Corporation (BMT)). Beide Netze wurden unter ihren neuen Eigentümern bis Mitte des Jahres 1900 über seitliche Stromschiene elektrifiziert.
Parallel hierzu wurde ab März 1900 mit der Manhattan Main Line, der heutigen Seventh Avenue Line, die erste U-Bahn-Strecke New Yorks errichtet, die in Hinblick auf eine mögliche Verknüpfung nach denselben Parametern entworfen wurde wie die bestehenden Hochbahnstrecken. 1902 gründeten der hinter der U-Bahn stehende Unternehmer John B. McDonald und der Bankier August Belmont die Interborough Rapid Transit Company (IRT), die bis 1903 alle Hochbahnstrecken der Manhattan Railway Company übernahm. Die Manhattan Main Line nahm am 27. Oktober 1904 den Betrieb auf und führte vom Rathaus im Süden (die ursprüngliche Endstation City Hall wurde 1945 geschlossen) über den Grand Central Terminal, den Times Square und entlang des Broadways bis zur 145th Street im Norden, wo sich die Strecke in einen nördlichen (heutige Linie 1) und einen nordöstlichen Ast (heutige Linie 2 sowie teilweise Linie 5) teilte. Die Strecke wurde bis 1908 im Norden in die Bronx und im Süden durch den Brooklyn–Battery Tunnel (heute: Joralemon Tunnel), den ersten Tunnel unter dem East River, zum heutigen Atlantic Terminal der Long Island Rail Road im Brooklyner Zentrum verlängert. Der Großteil der Strecke wurde in offener Bauweise in relativ geringer Tiefe und von Anfang an viergleisige für den Expressbetrieb (siehe hier) angelegt, die Tunnelbau unter dem East River erfolgte bergmännisch. Ebenfalls 1908 eröffnete die BRT über die kurz zuvor fertiggestellte Williamsburg Bridge ihre erste Hochbahnstrecke von Brooklyn nach Manhattan (heutige Linien J/Z und Linie M).
IRT und BRT verfolgten umfangreiche Ausbauplanungen, zentrale Schritte hierbei waren die Planungen für die Triborough Subway (dt. Drei-Bezirke-U-Bahn, gemeint sind Manhattan, Brooklyn und die Bronx) und der Abschluss der hierauf aufbauenden Dual Contracts zwischen der Stadt New York, IRT und BRT im März 1913. Die konsolidierten Planungen sahen neben der Modernisierung aller bestehenden Hochbahnstrecken den Neubau weiterer U-Bahn-Strecken in den Netzen beider Betreiber und insbesondere die Verlängerung in das bisherige Hauptbedienungsgebiet des jeweils anderen vor, wodurch zahlreiche weitgehend parallel verlaufende Strecken entstanden, die in direkter Konkurrenz zueinander standen und nicht miteinander verknüpft waren. Der Großteil der Arbeiten wurde bis Anfang der 1930er Jahre abgeschlossen, womit die meisten der bis heute bestehenden IRT- und BRT/BMT-Strecken geschaffen wurden. Beide Betreiber errichteten ihre Strecken mit Normalspur und Stromschiene, die Strecken der BRT/BMT waren allerdings für ein größeres Fahrzeugprofil und mit größeren Kurvenradien entworfen, sodass dort breitere Züge mit längeren Wagen eingesetzt werden konnten.
Während der Umsetzung der in den Dual Contracts fixierten Vorhaben gründete New York mit dem Independent City-Owned Subway System (ICOSS), später Independent Subway System (IND) eine eigene städtische U-Bahn-Gesellschaft, deren Strecken in Manhattan, der Bronx und im Zentrum von Brooklyn ebenfalls zu großen Teilen parallel zu denen von IRT und BRT/BMT verlaufen, allerdings auch den Bezirk Queens wesentlich besser als bislang anbinden sollten. Die Strecken wurden nach denselben technischen Spezifikationen wie die der BRT/BMT geplant, wodurch die spätere Verknüpfung zwischen beiden Netzen ermöglicht wurde. Die Bauarbeiten wurden 1925 aufgenommen, die fast vollständig unterirdisch verlaufenden Strecken wurden zwischen 1932 und 1940 in Betrieb genommen.
1940 wurden IRT und BMT ins öffentliche Eigentum überführt und mit der IND unter die Kontrolle der städtischen Verkehrsbehörde gestellt. 1953 folgte die Einrichtung einer übergreifende New York City Transit Authority, die 1968 in der heutigen Metropolitan Transportation Authority (MTA) aufging. Nach der Kommunalisierung erfuhr das Netz eine weitreichende Bereinigung, in deren Rahmen die vier ursprünglichen Hochbahnstrecken in Manhattan und größere Teile des ursprünglichen Brooklyner Netzes aus dem späten 19. Jahrhundert, die zu großen Teilen parallel zu den jüngeren U-Bahn-Strecken verliefen, bis 1955 sukzessive stillgelegt wurden.[9]
- Chicago


Die Grundlage des heutigen Netzes der Chicago Elevated ist eine Reihe von Hochbahnstrecken, die über einen relativ kurzen Zeitraum von rund 20 Jahren rund um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert von fünf privaten Gesellschaften errichtet wurden.
Als erstes eröffnete die Chicago and South Side Rapid Transit Railroad (ab 1897: South Side Elevated Railroad, kurz South Side L; heutiger Südast der Green Line) am 6. Juni 1892 eine 5,8 Kilometer lange Nord-Süd-Strecke zwischen Roosevelt südlich der Innenstadt und 39th Street. Die Strecke wurde bis April 1893 in mehreren Schritten nach Süden zum Gelände der in diesem Jahr stattfindenden Weltausstellung verlängert (siehe auch hier), wurde jedoch nach Ende der Ausstellung und in den 1980er und 1990er Jahren in mehreren Schritte bis zur heutigen Endstation Cottage Grove verkürzt. Zwischen 1903 und 1908 erhielt die Strecke vier Zweigstrecken, die jedoch mit Ausnahme des Astes zur heutigen südwestlichen Endstation Ashland/63rd in den 1950er Jahren stillgelegt wurden.
Am 28. Oktober 1893 nahm mit der Lake Street Elevated Railroad (ab 1904: Chicago & Oak Park Elevated, kurz weiterhin Lake Street L; heutiger Westast der Green Line) die zweite Hochbahnstrecke den Betrieb auf. Sie führte von einer Endhaltestelle in der Nähe der heutigen Station Washington/Wells über die Lake Street nach Westen bis California und wurde bis 1910 in mehreren Schritten bis zum heutigen Endpunkt Harlem/Lake verlängert. Im Osten wurde die Strecke 1895 von Clinton nach State/Lake verlängert, womit der nördliche Schenkel der späteren Loop (s. u.) geschaffen wurde.
Am 6. Mai 1895 folgte die Metropolitan West Side Elevated Railroad (Met), die bis 1896 ein eigenes Netz mit einer kurzen Stammstrecke zwischen dem westlichen Rand der Innenstadt und Marshfield Station bzw. Marshfield Junction (östlich der heutigen Kreuzung des Westasts der Blue und der Pink Line) und vier Streckenästen in den Westen und Nordwesten der Stadt aufbaute. Mit Ausnahme des kurzen Astes zum Humboldt Park bestehen diese Strecken im Wesentlichen bis heute; der nordwestliche Ast zum Logan Square (Eröffnung: 25. Mai 1895) ist heute Teil des nordwestlichen Astes der Blue Line, der westliche Ast über Cicero (19. Juni 1895) bis Forest Park (11. März 1905), der allerdings in den 1950er Jahren in Mittellage der Interstate 290 verlegt wurde, bildet den Westast der Blue Line und der zwischen 1896 und 1912 kontinuierlich nach Südwesten verlängerte Ast bis 54th/Cermak ist heute der Hauptteil der Pink Line.
Die South Side und Lake Street L wurden wie die frühen Hochbahnen in New York anfangs mit regulären Personenzügen mit Dampflokomotiven betrieben, jedoch bereits bis Mai 1896 (Lake Street L) und Mitte 1898 (South Side L) und damit vor New York mit seitlicher Stromschiene elektrifiziert. Der westliche Abschnitt der Lake Street L zwischen Laramie und Harlem/Lake wurde aufgrund der ursprünglich ebenerdigen Führung mit zahlreichen Bahnübergängen über Oberleitung elektrifiziert und mit Zwei-System-Fahrzeuge mit seitlichem und Dachstromabnehmer bedient. Die Met war die erste Hochbahn der Vereinigten Staaten, die bereits zu ihrer Eröffnung Mitte 1895 elektrisch betrieben wurde, nachdem sie ursprünglich ebenfalls für Dampfbetrieb geplant worden war. Während auf der Lake Street L und der Met wie bei den ersten elektrifizierten Bahnen in New York Elektrolokomotiven mit Reisewagen oder Einzeltriebwagen mit nicht angetriebenen Beiwagen verwendet wurden, setzte die South Side L als weltweit erstes System Triebwagen in Mehrfachtraktion nach dem System Sprague ein, dem heutigen Standard für U-Bahn-Fahrzeuge.
Am 3. Oktober 1897 eröffnete der Union Loop der Union Elevated Railway, eine rund 2,9 Kilometer lange Ringstrecke, die die Innenstadt entlang von Wabash Avenue, Van Buren Street, der heutigen Wells Street und der bestehenden Strecke der Lake Street L durchquerte und an die die Strecken der drei bestehenden Hochbahngesellschaften angeschlossen wurden, sodass diese eine direkte Anbindung der Innenstadt erhielten. Gleichzeitig nahmen South Side und Lake Street L den gemeinsamen bzw. wechselseitigen Betrieb ihrer Strecken auf. Die neuen Verbindungen erhöhten die Attraktivität des Netzes schlagartig, aufgrund der niveaugleichen Kreuzungen und Abzweigungen auf dem Loop (von denen jene im Nordwesten und Südosten bis heute in Betrieb sind) war die Kapazität der Strecke allerdings bereits bei Eröffnung weitgehend ausgeschöpft.
Am 31. Mai 1900 folgte mit der Northwestern Elevated Railroad die letzte Hochbahngesellschaft, die den Loop mit Wilson im Norden Chicagos verband. Im Mai 1907 wurde ab Belmont ein Ast in nordwestliche Richtung bis Western eröffnet, der Ende desselben Jahres Kimball erreichte. Die Strecke wird heute von der Brown Line bedient. Die Nordstrecke wurde 1908 größtenteils ebenerdig bis Central und schließlich 1912 zu ihrem heutigen Endpunkt Linden verlängert, jedoch bis 1931 in Dammlage verlegt. Sie wird heute von der Purple und der Red Line bedient.
1924 wurden die einzelnen Hochbahngesellschaften zur Chicago Rapid Transit Company (CRT) vereinigt, die zum 1. Oktober 1947 zusammen dem ebenfalls privaten Straßenbahnunternehmen Chicago Surface Lines in der städtischen Chicago Transit Authority (CTA) aufging.[8]
- Philadelphia
In Philadelphia nahm die Philadelphia Rapid Transit Company 1903 die Arbeiten am ersten Teilstück der Market Street Subway-Elevated, der heutigen Market–Frankford Line, auf. Die Strecke ging am 4. März 1907 in Betrieb und führte in Ost-West-Richtung entlang der Market Street, einer der historischen Hauptachsen Philadelphias, von der Station 15th Street beim Rathaus über den Hauptbahnhof an der 30th Street bis zur 69th Street in Upper Darby kurz hinter der Stadtgrenze im Westen. Die Strecke verlief zwischen 15th Street und 22nd Street im Tunnel, danach bis zur 63rd Street als Hochbahn und auf dem kurzen Abschnitt in Upper Darby ebenerdig. Der Tunnel wurde in offener Bauweise in geringer Tiefe angelegt und war von Anfang an viergleisig, um auf den äußeren Gleisen die Subway–Surface Trolleys aus dem Westen Philadelphias in die Innenstadt führen zu können. Der Betrieb war hier bereits am 18. Dezember 1905 aufgenommen worden.
Im Osten wurde die Strecke am 3. August 1908 unterirdisch bis 2nd Street verlängert, bis Oktober 1908 folgten zwei weitere kurze, größtenteils als Hochbahn angelegte Erweiterungen zur Station South Street, wo ein Übergang zu den Fähren über den Delaware River in das benachbarte New Jersey bestand. 1922 wurde die Strecke nördlich von 2nd Street an die neu gebaute Hochbahnstrecke der Frankford Elevated angeschlossen, sodass der durchgehende Betrieb bis in den nordöstlich des Zentrums gelegenen Stadtteil Frankford aufgenommen werden konnte und die spätere Market–Frankford Line im Wesentlichen ihren heutigen Verlauf und ihre heutige Gesamtlänge von 20,8 Kilometern erreichte. Der kurze östliche Ast zur South Street wurde 1939 stillgelegt, nachdem der Fährverkehr infolge der Eröffnung der Benjamin Franklin Bridge 1926 weitestgehend an Bedeutung verloren hatte.
Die Market–Frankford Line wird seit 1968 durch die regionalen Verkehrsbetriebe SEPTA betrieben und bildet heute mit der ebenfalls zu SEPTA gehörenden Broad Street Line (Eröffnung: 1. September 1928) und der größtenteils östlich des Delaware River verlaufenden PATCO Speedline der Port Authority Transit Corporation (Eröffnung in der heutigen Form: 4. Januar 1969) ein zusammenhängendes U-Bahn-Netz, wobei zwischen den Linien der beiden Betreiber keine vollständige tarifliche Integration besteht. Ab 69th Street bildet zudem die heute als Norristown High Speed Line bezeichnete Linie seit 1907 eine logische Verlängerung der Market–Frankford Line in nordwestliche Richtung. Die Strecke ist ebenfalls vollständig kreuzungsfrei trassiert und über Stromschiene elektrifiziert, wird allerdings mit deutlich geringerer Taktdichte und mit schienenbusartigen Einzelwagen betrieben, zudem werden außer den Endhaltestelle alle Stationen nur als Bedarfshalt bedient.[9]
- New Jersey

Parallel zum Bau der ersten U-Bahn-Strecke der IRT in New York City wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein weiteres System entwickelt, mit dem das westlich des Hudson Rivers in New Jersey gelegene, dichtbesiedelte Hudson County mit den Städten Hoboken und Jersey City an New York angebunden werden sollte. Ausgangspunkt der Planung war die Schaffung einer festen Verbindung zwischen den Mitte des 19. Jahrhunderts am Westufer des Hudson eröffneten Endbahnhöfen mehrerer großer Eisenbahngesellschaften und New York, nachdem bislang nur ein Übersetzen mit der Fähre möglich war. Nach erfolglosen Versuchen in den 1870er bis 1890er Jahren wurden 1902 die Arbeiten an einem ersten zweigleisigen Tunnel zwischen Hoboken und dem am Osterufer des Hudson gegenüberliegenden mittleren Lower Manhattan aufgenommen, ab 1906 wurde ein zweiter Tunnel zwischen Jersey City und dem südlichen Lower Manhattan gebaut.
Die private Hudson & Manhattan Railroad nahm am 26. Februar 1908 den Betrieb zwischen Hoboken und 6th Avenue/19th Street über den nördlichen Tunnel auf, einen Monat nach Inbetriebnahme der ersten Unterwasserquerung der IRT nach Brooklyn. Die Strecke wurde bis November 1910 in zwei Schritten zum heutigen Endpunkt 33rd Street verlängert. Die Strecke verlief auch in Manhattan vollständig im Tunnel, bis 12th Street wurde der Tunnel bergmännisch, zwischen 12th und 33rd Street in offener Bauweise erstellt. Die ursprüngliche Endstation wurde in den 1930er Jahren im Zuge des Baus der benachbarten 6th Avenue Subway weitreichend umgebaut und rückte hierbei näher an die 32nd Street, die Station an der 28th Street wurde aufgrund des nun als zu gering eingestuften Stationsabstands stillgelegt. Die Station 19th Street wurde 1954 zur Erhöhung der Reisegeschwindigkeit aufgegeben.
Der Betrieb im südlichen Tunnel wurde im Sommer 1909 zwischen Exchange Place in Jersey City und Hudson Terminal auf der New Yorker Seite, etwa am Standort der heutigen Station World Trade Center, aufgenommen.
Bis November 1911 wurde das Netz im Wesentlichen auf seinen heutigen Umfang ausgebaut, lediglich der westliche Endpunkt in Newark wurde 1937 um rund 600 Meter von Park Place zur Pennsylvania Station verlegt. Das Netz hat seitdem eine Länge von 22,2 Kilometern, davon 11,5 Kilometer im Tunnel. Das System wurde 1962 von der Port Authority of New York and New Jersey übernommen und wird seitdem unter der Marke PATH betrieben.[9]
- Buenos Aires
1913 ging in Buenos Aires die erste U-Bahn-Strecke der südlichen Hemisphäre und der spanischsprachigen Welt in Betrieb, die später in der Linie A der Subte aufging.
Untergrundbahnen für den Güterverkehr
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Parallel zur Entwicklung des Verkehrsmittels U-Bahn für den Personenverkehr wurden auch Netze für den innerstädtischen Güterverkehr angelegt.
Zwischen 1899 und 1906 baute die Chicago Tunnel Company eine Güter-U-Bahn auf, deren Netz zum Zeitpunkt seiner größten Ausdehnung eine Länge von 97 Kilometern mit Strecken unter dem Großteil der Straßen der Innenstadt umfasste. Mit insgesamt 149 Lokomotiven und 3000 Güterwagen wurden Ladegut und Kohle von den Güterbahnhöfen der Eisenbahn zu Warenhäusern, Büros und Lagern in der Innenstadt und Asche von dort wegbefördert. Der aufkommende Lastwagenverkehr und die Umstellung von Kohle- auf Gasheizung führten ab den 1940er Jahren zu einem erheblichen Rückgang der Umsätze, die Betreibergesellschaft meldete 1956 Insolvenz an. Das Netz wurde 1959 stillgelegt, die Tunnel wurden jedoch erhalten und werden bis in die Gegenwart zur Verlegung von Strom- und Telefonleitungen verwendet.
Nach Vorbild des Chicagoer Systems entstand 1927 in London die London Post Office Railway (ab 1987 offiziell Mail Rail). Sie verband auf einer 10,5 Kilometer langen Ost-West-Strecke das Postsortieramt am Bahnhof Paddington mit sieben anderen Postämtern, der östliche Endpunkt lag beim Bezirkspostamt im Stadtteil Whitechapel. Da fünf der angeschlossenen Ämter im Laufe der Zeit geschlossen wurden, wurde die Anlage 2003 stillgelegt.
Weitere Beispiele sind die 450 Meter lange Post-U-Bahn München (1910 bis 1988) und jene in Zürich (1938 bis 1981).
Auch Kasemattenbahnen und Grubenbahnen können als Güter-U-Bahnen bezeichnet werden, wobei diese auch dem Personentransport dienen können.
U-Bahn-Bau zwischen den Weltkriegen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs endete im Wesentlichen die erste Phase des U-Bahn-Baus. Gleichzeitig hatte das System U-Bahn in allen wesentlichen Komponenten und Parametern eine erste Reife erreicht, deren Erkenntnisse maßgeblich für den Ausbau bestehender und die Anlegung neuer Netze wurden; der elektrische Betrieb war erprobt und etabliert und durch bedeutende Fortschritte bei der Tunnelbautechnik und die Verfügbarkeit der Rolltreppe, die den zügigen und komfortablen Transport großer Mengen von Fahrgästen zwischen tiefliegenden Tunnelbahnhöfen und der Oberfläche ermöglichte, hatte sich die Untergrundbahn gegenüber der Hochbahn als bevorzugte Trassierungsvariante durchgesetzt. In Nordamerika, insbesondere in New York, wurden sogar in erheblichem Umfang bestehende Hochbahnstrecken zurückgebaut und durch Tunnelstrecken ersetzt. Die Fahrzeuge der ältesten Systeme, deren Abmessungen sich noch stark an Straßenbahnwagen orientiert hatten, wurden mittlerweile als zu klein für die wachsende Zahl von Fahrgästen betrachtet. Die verbesserten Methoden des Tunnelbaus ermöglichten auch hier Verbesserungen durch größere Tunnelprofile, die den Einsatz größerer Fahrzeuge erlaubten, deren Abmessungen sich stärker an Eisenbahnwagen orientierten und eine höhere Kapazität boten. Durch Einbeziehung dieser neuen Erkenntnisse und Technologien bei der Erweiterung bestehender Netze entstanden in einigen Städten technisch nicht miteinander kompatible Teilnetze, beispielsweise die ab 1923 in Betrieb genommenen Strecken des Großprofilnetzes in Berlin (Linien U5 bis U9), deren breitere Züge nicht auf den älteren Strecken (Linien U1 bis U4) eingesetzt werden können (siehe auch hier).
Zwischen den Weltkriegen gingen in Europa nur drei Netze neu in Betrieb: 1919 in der spanischen Hauptstadt Madrid, 1924 im katalanischen Barcelona und 1935 in Moskau. Weiterhin wurden 1938 in Rom die Arbeiten für eine erste Strecke aufgenommen, infolge des Kriegseintritts Italiens jedoch 1942 eingestellt (siehe auch hier). Im restlichen Europa verhinderten die Instabilität der Zwischenkriegszeit und später die Weltwirtschaftskrise den Bau neuer Netze. Außerhalb Europas wurden in Tokio (1927) und Osaka (1933) die ersten U-Bahnen Asiens in Betrieb genommen.
- Madrid

Vorschläge für eine U-Bahn in Madrid reichen zurück bis 1886, jedoch legte erst 1914 eine Gruppe von Ingenieuren einen Entwurf vor, der Grundlage für ein konkretes Projekt wurde. Dieser Entwurf sah ein doppelkreuzförmiges Netz aus jeweils zwei Nord-Süd- und Ost-West-Strecken vor, das im weiteren Verlauf der Planungen zu einem Radialnetz mit drei Strecken, die sich an der Puerta del Sol (Station Sol) im Zentrum der Innenstadt treffen (Linien 1, 2 und 3), und einer ergänzenden Tangentialstrecke in Ost-West-Richtung (Linie 4) weiterentwickelt wurde.
Die Arbeiten für die Strecke der Linie 1 wurden 1917 aufgenommen. Während das Königreich Spanien im Ersten Weltkrieg neutral war, stellte die kriegsbedingt angespannte Versorgungslage mit Baumaterialien in Europa dennoch eine Herausforderung für das Vorhaben dar. Die Strecke wurde am 17. Oktober 1919 eröffnet und führte über rund 3½ Kilometer von Sol über die Haupteinkaufsstraße Gran Vía bis Cuatro Caminos am damaligen nördlichen Stadtrand Madrids. Im Dezember 1921 folgte eine Erweiterung von Sol in südwestliche Richtung zum Hauptbahnhof Atocha, die im Mai 1923 nochmals bis Puente de Vallecas verlängert wurde. Im Norden erhielt die Strecke im März 1929 eine Verlängerung bis Tetuán, womit sie eine Länge von 9,4 Kilometern erreichte. Der erste Abschnitt der Linie 2 wurde am 11. Juni 1924 eröffnet und führte von Sol über 3,8 Kilometer nach Osten bis Ventas. Westlich von Sol wurde die Linie auf einer zweiten Nord-Süd-Strecke durch die Innenstadt verlängert; im Dezember 1925 zunächst bis Quevedo, im September 1929 bis Cuatro Caminos, wo sie erneut auf die Linie 1 traf. Im September 1932 erhielt die Linie eine 1,1 Kilometer lange Zweigstrecke zwischen Goya und Diego de León, die jedoch im Jahr 1958 an die Linie 4 abgegeben wurde. Ebenfalls im Dezember 1925 hatte die Linie zudem ab Ópera einen rund 1,1 Kilometer langen Abzweig zur Estación del Norte (heute: Príncipe Pío) erhalten, der jedoch seit seiner Eröffnung als eigenständige Linie betrieben wird (Linie R für es. „ramal“, dt. „Abzweig“). Der erste, 1,4 Kilometer lange Abschnitt der Linie 3 folgte am 9. August 1936, wenige Wochen nach Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs, zwischen Sol und Embajadores im Süden. Der weitere Ausbau wurde durch die fortschreitenden Kriegshandlungen gehemmt und nach Ende des Konflikts im April 1939 war Madrid wie andere spanische Städte von zahlreichen Kriegsschäden betroffen. Da sich das nunmehr franquistische Spanien im Zweiten Weltkrieg im Wesentlichen nicht an den aktiven Kriegshandlungen beteiligte, spielte der Konflikt für den Alltag des Landes eine insgesamt geringere Rolle, wie schon im Ersten Weltkrieg war der U-Bahn-Bau jedoch von Engpässen bei der Versorgung mit bestimmten Materialien betroffen. Trotz dieser Umstände konnten im Juli 1941 eine Verlängerung der Linie 3 von Sol in nordwestliche Richtung bis Argüelles und 1944 die Linie 4 zwischen Argüelles und Goya in Betrieb genommen werden.
Konstruktiv orientierten sich die Planer der ersten vier Linien eng an der Métro Paris mit bergmännisch angelegten Tunneln und Gewölbestationen, wobei die günstigen Bodenverhältnisse in Madrid den Bau eines vollständig unterirdischen Netzes vereinfachten. Anders als in Paris wurde eine Stromversorgung über Oberleitung und die seltene, von der damaligen Madrider Straßenbahn übernommene Spurweite von 1445 mm gewählt. Das Gesamtvorhaben wurde maßgeblich durch König Alfons XIII. befördert, der die U-Bahn als bedeutenden Beitrag zur Modernisierung Madrids betrachtete und eine Million Peseten aus seinem Privatvermögen beisteuerte und so auch zur Gewinnung weiterer Geldgeber beitrug. Zur Anerkennung seines Engagements erhielt die für Bau- und Betrieb der Metro gegründete Gesellschaft den Namen Compañía Metropolitano Alfons XIII, der jedoch nach Ausrufung der Zweiten Republik im Jahr 1931 in Compañia Metropolitano de Madrid geändert wurde.[109][65]
- Barcelona
In Barcelona errichteten ab Anfang der 1920er Jahre die zwei privaten Unternehmen Gran Metropolità de Barcelona (kurz: Gran Metro) und Ferrocarril Metropolità de Barcelona (Metro Transversal) die ersten U-Bahn-Strecken. Als erstes eröffnete die Gran Metro am 30. Dezember 1924 eine 2,8 Kilometer lange Strecke von der Plaça de Catalunya im Zentrum der Innenstadt über die Passeig de Gràcia bis Lesseps nordwestlich der Innenstadt. 1925 erhielt die Strecke eine kurze Verlängerung in Richtung der Küste unter der Rambla bis Liceu. Ende 1926 kam eine 1,2 Kilometer lange Zweigstrecke von Passeig de Gràcia unter der Via Laeitana bis Jaume I hinzu, die Anfang 1934 bis Correos (westlich der heutigen Station Barceloneta, 1972 geschlossen) verlängert wurde. Die Metro Transversal eröffnete anderthalb Jahre nach der Gran Metro am 10. Juni 1926 eine 3,9 Kilometer lange Strecke zwischen Catalunya, die damit zum Knoten zwischen den Strecken der beiden Gesellschaften wurde, und Bordeta (westlich der heutigen Station Mercat Nou, 1983 geschlossen). Die Strecke wurde 1932 und 1933 in insgesamt drei Etappen nach Westen bis Santa Eulàlia und nach Osten über Arc de Triomf nach Marina verlängert und wuchs damit auf insgesamt 6,1 Kilometer. An der Plaça d'Espanya wurde zudem gleichzeitig mit der U-Bahn-Station der Metro Transversal ein Bahnhof für die Vorortbahnen der Ferrocarrils Catalans (heute: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)) errichtet. Gran Metro und Metro Transversal wurden 1961 in die städtischen Verkehrsbetriebe Ferrocarril Metropolità de Barcelona eingegliedert. Die beiden Äste der Gran Metro wurden 1972 getrennt, die Strecke zwischen Liceu und Lesseps wurde 1973 zur Linie L3 und die Zweigstrecke nach Correos wurde in die Linie L4 integriert. Die Strecke der Metro Transversal ging gleichzeitig in der Linie L1 auf.
Die Strecken von Gran Metro und Metro Transversal verliefen größtenteils bzw. ausschließlich unterirdisch und folgten in wesentlichen Teilen bestehenden Straßenverläufen, wurden jedoch vorwiegend bergmännisch aufgefahren, nur vereinzelt wurden Tunnel in offener Bauweise angelegt. Während die Strecke der Gran Metro in Normalspur (1435 mm) gebaut wurde, wurde die Metro Transversal mit Spanischer Breitspur (1672 mm) und einem Wagenprofil von 3,1 Metern entworfen, da zunächst eine Verbindung der Haupteisenbahnstrecken aus südlicher und nördlicher Richtung über den Tunnel vorgesehen war. Diese Planungen wurden später nicht umgesetzt, stattdessen wurden gemeinsame viergleisige Tunnelbauwerke für U-Bahn und Nahverkehrszüge angelegt, zunächst mit der Verlängerung von Catalunya nach Arc de Triomf Anfang der 1930er Jahre, dann in den 1950er Jahren bis zur U-Bahn-Station Fabra i Puig bzw. dem Bahnhof Sant Andreu Arsenal.[65]
- Moskau

(dt. „Ganz Moskau baut eine U-Bahn“); Plakat von Gustavs Klucis zum Aufruf der Moskauer Bevölkerung zur Beteiligung am Metro-Bau
Die erste U-Bahn der Sowjetunion wurde am 15. Mai 1935 in Moskau mit dem ersten Abschnitt der heutigen Sokolnitscheskaja-Linie eröffnet. Die Strecke führte über 8,4 Kilometer von Sokolniki nordöstlich des Zentralbezirks über die Innenstadt bis zur heutigen Station Park Kultury im Südwesten der Innenstadt.
Erste Überlegungen für eine U-Bahn waren bereits im Kaiserreich entwickelt worden, konnten jedoch u. a. aufgrund des Eintritts Russlands in den Ersten Weltkrieg und später aufgrund der Instabilität infolge der Russischen Revolution zunächst nicht weiter verfolgt werden. Die Planungen wurden erst nach Gründung der Sowjetunion (30. Dezember 1922) wieder aufgenommen und sind nicht zuletzt auch im Kontext des Ausbaus Moskaus zur Hauptstadt der Sowjetunion und Schaufenster des Sozialismus zu betrachten, nachdem die Stadt erst 1918 nach Gründung der RSFSR die Funktion der russischen Hauptstadt von Sankt Petersburg übernommen hatte. Darüber hinaus sollte das Vorhaben die Modernisierungs-, Transformations- und Ordnungskraft des Sozialismus und der sozialistischen Führung unter der Kommunistischen Partei demonstrieren.[110]
Im Rahmen der Planungen wurden unter anderem die bestehenden Systeme in New York, London und Berlin untersucht und technische Berater aus dem Vereinigten Königreich verpflichtet, die allerdings nach Vorwürfen der Spionage und Sabotage und einem anschließenden Schauprozess von ihren Aufgaben entbunden und 1933 ausgewiesen wurde.[111] Für den Bau wurden Industrie- und Bergarbeiter, Mitglieder des Komsomol und große Teile der Moskauer Zivilbevölkerung eingesetzt, weshalb das Vorhaben als Gemeinschaftsaufgabe und -leistung des gesamten Landes unter Führung der Kommunistischen Partei präsentiert wurde.[112]
Eine zentrale und das System bis in die Gegenwart auszeichnende Besonderheit waren die sehr großzügig dimensionierten und äußerst aufwändig ausgestalteten Stationen, die ideologisch grundiert als Paläste der Volkes und Paläste der Arbeiterklasse bezeichnet wurden (siehe auch hier).[113] Der besondere gestalterische Anspruch sollte dabei bewusst auch die Bedeutung öffentlicher bzw. der Allgemeinheit gewidmeter Güter im Sozialismus unterstreichen und das System von den gestalterisch schlichteren Netzen im kapitalistischen Ausland abheben. Eine weitere Besonderheit ist die von Anfang an eingeplante sehr große Tiefenlage der Stationen, um diese gleichzeitig als Luftschutzbunker nutzen zu können.[114] Zum ersten und bislang einzigen Mal zu diesem Zweck genutzt wurden die Anlagen wenige Jahre nach Eröffnung der Metro, als die Moskauer Bevölkerung im Jahr 1941 Schutz vor den Luftangriffen der Wehrmacht suchte (siehe auch hier).[115]
Das Moskauer System begründete in vielerlei Hinsicht technische und konzeptionelle Standards, die prägend für die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts realisierten U-Bahn-Projekte in anderen Städten der Sowjetunion und anderer RGW-Staaten wurden (siehe auch hier).
- Tokio

通開間草淺野上
(dt. sinngemäß: „Die einzige U-Bahn Asiens, Ueno nach Asakusa, wird eröffnet“); zeitgenössisches Werbeplakat anlässlich der Eröffnung der ersten U-Bahn-Strecke Tokios
Die erste U-Bahn Asiens wurde am 30. Dezember 1927 in Tokio eröffnet. Die 2,2 Kilometer lange Strecke der privaten Tokyo Underground Railway Company verband die Fernbahnhöfe Asakusa und Ueno nordöstlich des Zentrums Tokios und wurde bis 1934 in mehreren Schritten bis zum Bahnhof Shimbashi im südlichen Teil des Zentrums verlängert. Zwischen 1935 und 1938 baute die ebenfalls private Tokyo Rapid Transit Railway Company eine Strecke vom erst 1932 nach Tokio eingemeindeten Shibuya nach Shimbashi. Am 16. September 1939 wurde der durchgehende wechselseitige Betrieb zwischen beiden Betreibern aufgenommen, womit die Strecke ihre finale Länge von rund 14,4 Kilometern erreichte. Sie erschließt seitdem das Gebiet der heutigen fünf zentralen Bezirke Chiyoda, Chūō, Minato, Shibuya und Taitō und u. a. das bereits 1939 bedeutende Geschäfts-, Einkaufs- und Vergnügungsviertel Ginza rund um die gleichnamige Hauptstraße. Nach ihr wird die Linie seit 1953 als Ginza Line bezeichnet, um sie von der zu dieser Zeit in Bau befindlichen zweiten Tokioter U-Bahn-Linie, der Marunouchi Line, zu unterscheiden. In Hinblick auf Fahrzeuge und Infrastruktur orientierten sich die Planer der späteren Ginza Line stark an den bestehenden europäischen und nordamerikanischen Netzen, u. a. an Berlin und New York, und übernahmen u. a. die dort verwendete Normalspur – im Gegensatz zur sonst in Japan üblichen Kapspur – und die Elektrifizierung über eine seitliche Stromschiene.
Tokyo Underground Railway Company und Tokyo Rapid Transit Railway Company wurden 1941 durch die Regierung zur Teito Rapid Transit Authority verschmolzen und verstaatlicht, um Planung, Bau und Betrieb weiterer Strecken in Tokio und seinem Umland zu übernehmen. Das Unternehmen befindet sich seitdem im gemeinsamen Eigentum des japanischen Staates und der Stadt Tokio bzw. seit Auflösung der Stadt Tokio als eigenständiger Gebietskörperschaft 1943 der zum selben Zeitpunkt neu konstituierten Präfektur Tokio. 2004 erfolgten die formale Privatisierung und die Umbenennung in Tokyo Metro Company (ja. 東京メトロ, Tōkyō Metoro). Neben ihr gibt es seit 1960 das zur Präfektur Tokio gehörende Tokyo Metropolitan Government Transportation Bureau, das unter dem Namen Toei als zweite U-Bahn-Gesellschaft agiert und heute vier der 13 Linien des Tokioter Netzes betreibt.[67]
- Osaka
Osaka nahm bereits in der ersten Hälfte der 1920er Jahre parallel zum Bau der ersten Strecke in Tokio Planungen für eine eigene U-Bahn auf, die 1925 im Beschluss über den Bau eines 54,8 Kilometer langen Netzes mir vier Linien mündeten. Der Baubeginn erfolgte 1930, der erste, 3 Kilometer lange Abschnitt der Midōsuji Line wurde am 20. Mai 1933 eröffnet und führte im Wesentlichen entlang der gleichnamigen Nord-Süd-Hauptstraße von den wichtigen Fernbahnhöfen Umeda und Osaka im Norden der Innenstadt nach Shinsaibashi im Zentrum. Die Strecke wurde bis 1938 in zwei Schritten über den Bahnhof Namba bis zum Bahnhof Tennōji verlängert und erreichte damit eine Länge von 7,5 Kilometern. Die bereits laufenden Arbeiten für eine weitere Verlängerung mussten 1943 aufgrund der laufenden Kriegshandlungen unterbrochen werden und konnten erst 1952 abgeschlossen werden.
Wie bei der Ginza Line in Tokio orientierte sich die Planung in Osaka an bestehenden europäischen und nordamerikanischen Netzen und übernahm ebenfalls Normalspur und Stromschiene. Die Strecke wurde durch das städtische Osaka Municipal Transportation Bureau gebaut und war die erste U-Bahn-Strecke Japans, die aus öffentlichen Mitteln finanziert wurde. Die U-Bahn befindet sich bis heute im Eigentum der Stadt, 2018 wurde sie jedoch in Hinblick auf eine mögliche spätere Privatisierung an die neu gegründete städtische Osaka Metro Company (ja. 東京メトロ, Ōsaka Metoro) übertragen.[69]
1940er bis 1970er Jahre: Weiterer Ausbau in Europa, Nordamerika und Japan
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Während und unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg ruhte der U-Bahn-Bau nahezu überall auf der Welt, wurde jedoch schon bald wieder aufgenommen. Bis in die frühen 1970er Jahre beschränkten sich neue Netze weiterhin auf Haupt- und Großstädte in West- und Mitteleuropa, Nordamerika, Japan und in der Sowjetunion (siehe hier).
Das erste neue System nach dem Krieg und die erste U-Bahn Nordeuropas wurde 1950 in Stockholm mit dem ersten Abschnitt der Grünen Linie zwischen Slussen und Hökarängen in Betrieb genommen, wobei der Abschnitt zwischen Johanneshov (heute: Gullmarsplan) und Blåsut aus einer bestehenden Vorortstraßenbahn hervorging. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass das im Krieg offiziell neutrale Schweden nicht an aktiven Kriegshandlungen beteiligt war und seine U-Bahn-Planungen und den Bau von Strecken und weiterer Infrastruktur, die bereits für den späteren U-Bahn-Betrieb ausgelegt waren, auch während der Kriegsjahre verfolgen konnte.[116]
Es folgten Toronto (1954) als größte Stadt Kanadas und Hauptstadt der Provinz Ontario, die italienische Hauptstadt Rom (1955) mit der ersten U-Bahn des Landes (siehe auch hier), Cleveland (1955), das zu diesem Zeitpunkt zu den bevölkerungsreichsten Städten der Vereinigten Staaten zählte und ein bedeutender Industriestandort war, Nagoya (1957) als Hauptstadt der Präfektur Aichi und ebenfalls bedeutendes Industrieszentrum sowie die portugiesische Hauptstadt Lissabon (1959). In den 1960er Jahren folgten Mailand (1964) als zweitgrößte Stadt Italiens und Hauptstadt der Lombardei, Norwegens Hauptstadt Oslo (1966), Montreal (1966) als zweitgrößte Stadt Kanadas und größtes urbanes Zentrum der Provinz Québec, das niederländische Wirtschafts- und Logistikzentrum Rotterdam (1968), Mexiko-Stadt (1969) als Hauptstadt und größte Stadt des Landes, München (1971) als Hauptstadt und größte Stadt Bayerns sowie Gastgeber der Olympischen Sommerspiele 1972, Sapporo (1972) als Hauptstadt und größte Stadt der Präfektur Hokkaidō sowie Gastgeber der Olympischen Winterspiele 1972 (siehe auch hier), Nürnberg (1972) als zweitgrößte Stadt Bayerns, San Francisco (1972) als Zentrum einer der größten Ballungsräume der Vereinigten Staaten und Yokohama als bedeutende Hafen- und Industriestadt in der Metropolregion Tokio und Hauptstadt der Präfektur Kanagawa.[117]
- Massenmotorisierung und die funktionsgetrennte und autogerechte Stadt
In Westeuropa, Nordamerika und Japan wurden Stadt- und Verkehrsplanung von den 1950er bis in die 1970er Jahre – in den Vereinigten Staaten vielfach auch bis in die Gegenwart – maßgeblich von der Massenmotorisierung und den eng hiermit und miteinander verbundenen planerischen Leitbildern der funktionsgetrennten Stadt im Sinne der Charta von Athen und der autogerechten Stadt geprägt, die in den kriegszerstörten Städten Europas und Japans damit auch vielfach planerische Grundlage des Wiederaufbaus wurden.
Infolge der planerisch gewünschten funktionalen Entmischung der Städte mit weitgehender räumlicher Trennung von Wohn-, Arbeits-, Versorgungs- und Freizeitstandorten und zusätzlich verstärkt durch die gleichzeitige Suburbanisierung, das heißt des Wachstums der Siedlungsgebiete in ihren bisherigen Randbereichen, ergab sich ein grundsätzlich erhöhter Mobilitätsbedarf. Während dieser in den weiterhin verdichteten städtischen Räumen und den neu entstehenden Großwohnsiedlungen effizient durch den ÖPNV bedient werden konnte und in zahlreichen Städten neben umfangreichen Ausbauvorhaben für den Kfz-Verkehr auch ehrgeizige ÖPNV-Vorhaben verfolgt wurden (s. u.), waren die wachsenden Siedlungen in der Vorstadt, am Stadtrand und auf der bildlichen oder tatsächlichen grünen Wiese häufig vorrangig auf den motorisierten Individualverkehr ausgerichtet bzw. wurden durch ihn maßgeblich ermöglicht und befördert und boten sich aufgrund ihrer teilweise geringen bis sehr geringen baulichen Dichte nicht für eine ÖPNV-Erschließung an.
Die rapide wachsende Zahl privater Kraftfahrzeuge führte in zahlreichen europäischen Städten zu Konflikten mit der Straßenbahn, die nach dem Krieg noch vielfach die Hauptlast des städtischen Nahverkehrs trug und mit dem Kfz-Verkehr um begrenzte Verkehrsflächen konkurrierte. Die Städte des Kontinents gelangten in der Frage des weiteren Umgangs mit dem Verkehrsmittel Straßenbahn bzw. der Weiterentwicklung ihrer ÖPNV-Netze zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen; in Frankreich (siehe hier) und im Vereinigten Königreich (siehe hier) wurde die bereits in den 1920er und 1930er Jahren begonnene Stilllegung der Straßenbahnnetze mit wenigen Ausnahmen bis zum Beginn der 1960er Jahre abgeschlossen und der städtische Nahverkehr abseits der bereits bestehenden U-Bahn-Systeme in London, Glasgow und Paris auf Busse umgestellt.[47][118] Während auch in der Bundesrepublik die Straßenbahnbetriebe zahlreicher kleinerer Städte geschlossen wurden (siehe hier), favorisierte eine große Zahl der deutschen Großstädte grundsätzlich den Erhalt der Straßenbahn, betrachtete jedoch Anpassungen als erforderlich (s. u.).
Neubauplanungen in der Bundesrepublik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Um den wachsenden Spannungen zwischen Straßenbahn und privaten Kraftfahrzeugen zu begegnen, wurde zunächst vielfach die Verlegung bestehender innerstädtischer Straßenbahnstrecken, die durch die am stärksten vom Kfz-Verkehr in Anspruch genommenen Straßen verliefen, in neue Tunnel verfolgt, sodass Straßenbahn und MIV auf getrennten Ebenen unabhängig voneinander verkehren sollten. Die weniger belasteten Außenstrecken sollten im Wesentlichen erhalten und an die neuen Tunnel angeschlossen und auch durch Neubaustrecken an der Oberfläche ergänzt oder ersetzt werden. Planungen für solche Unterpflasterstraßenbahnen (U-Strab) wurden u. a. in München (Beschlussfassung im Stadtrat: 1959),[119] Stuttgart (1961),[120] Köln (1962)[121] und Nürnberg (1963)[122] sowie in verschiedenen Städten des Ruhrgebiets verfolgt.[123][124]
Wenige Jahre nach ihrer Entscheidung für den Ausbau der bestehenden Straßenbahnnetze und teilweise während der bereits laufenden Umsetzung erster Streckentunnel entschieden sich einige der genannten Städte, anstelle der U-Strab eine vollständig kreuzungsfrei trassierte U-Bahn zu bauen bzw. ihr Netz langfristig in diese Richtung zu entwickeln. Köln,[121] München[119] und Nürnberg[122] fassten entsprechende Beschlüsse im Laufe des Jahres 1965 – München beschloss zu diesem Zeitpunkt ein U-Bahn-Zielnetz für die gesamte Stadt, hatte jedoch bereits 1963 den perspektivischen Ausbau der zu diesem Zeitpunkt geplanten U-Strab-Strecken für eine Voll-U-Bahn beschlossen –, Stuttgart 1969.[120] Hinzu kamen Frankfurt, das zuvor den Bau einer U-Strab untersucht, jedoch verworfen und stattdessen bereits 1961 die langfristige Weiterentwicklung seines Straßenbahnnetzes zu einer U-Bahn beschlossen hatte,[125] Bremen, das ebenfalls die langfristige Umwandlung seines Straßenbahnnetzes zur Voll-U-Bahn verfolgte,[21] sowie Hannover (1965)[126] und Düsseldorf (1968),[123] die ebenfalls eine U-Strab geprüft, jedoch nicht weiter verfolgt hatten.
Ab Ende der 1960er Jahre erarbeitete das Land Nordrhein-Westfalen parallel zu den einzelnen Städten eine umfassende Rahmenplanung für den städtischen und stadtregionalen Schienennahverkehr, die für die drei Ballungsräume Rhein-Ruhr, Köln/Bonn und Bielefeld U-Bahn-Netze auf Grundlage einheitlicher technischer Parameter vorsah und durch besondere Fördermaßnahmen des Landes begleitet wurde. Die gemeinsamen technischen Merkmale umfassten insbesondere die vollständig kreuzungsfreie Trassierung, Elektrifizierung über Stromschiene, Stationen mit 115 Meter langen Hochbahnsteigen und den Einsatz eines einheitlichen Fahrzeugtyps, 1972 konkretisiert im Konzept des sogenannten A-Wagens. Die Spezifikationen wurden maßgeblich durch die Ende der 1960er Jahre bereits in Bau befindlichen U-Strab-Tunnel in Essen beeinflusst, die sich ihrerseits an den Großprofillinien der Berliner U-Bahn orientierten. Obschon es sich bei den geplanten Systemen aufgrund der kreuzungsfreien Trassierung um U-Bahnen gehandelt hätte (siehe hier), verwendete Nordrhein-Westfalen die Bezeichnung Stadtbahn, um die städteverbindende Funktion des Verkehrsmittels zu betonen. Der 1969 vorgestellte Leitplan Öffentlicher Personennahverkehr beinhaltete für das Ruhrgebiet den Aufbau eines rund 200 Kilometer langen Netzes, nach Einbeziehung Düsseldorfs Anfang der 1970er Jahre betrug die projektierte Länge rund 300 Kilometer. Die Umsetzung der Gesamtmaßnahme sollte bis zum Jahr 2000 erfolgen, ein Grundnetz besonders wichtiger Strecken mit einer Gesamtlänge von rund 100 Kilometern sollte bereits 1980 fertiggestellt werden. 1969 gründeten die Ruhrgebiets-Städte Bochum, Castrop-Rauxel, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen und Recklinghausen sowie die damals noch selbstständige Stadt Wattenscheid die Stadtbahngesellschaft Ruhr, nach Beitritt Hattingens und Düsseldorfs 1971 bzw. 1972 Stadtbahngesellschaft Rhein-Ruhr, als gemeinsame Planungs- und Koordinierungsinstanz für die Umsetzung der Stadtbahn. Die bestehenden und teilweise bereits in Umsetzung befindlichen Planungen in Düsseldorf und den Städten des Ruhrgebiets sowie in Köln wurden in die Rahmenplanung integriert und an deren technische Vorgaben angepasst. Bielefeld, das zuvor eine U-Strab geprüft, jedoch nicht weiter verfolgt hatte, beschloss 1970 den Umbau seines Straßenbahnnetzes auf Grundlage der neuen gemeinsamen Parameter.[123][124]
Nachdem die Bauarbeiten für die einzelnen Netze kurze Zeit nach den jeweiligen Beschlussfassungen aufgenommen und erste U-Bahn-mäßig ausgebaute Strecken in Betrieb genommen worden waren, zeichnete sich bereits ab den 1970er Jahren in der Mehrzahl der potentiellen deutschen U-Bahn-Städte ab, dass der Bau vollständig kreuzungsfrei trassierter Netze im bislang vorgesehenen Umfang allenfalls sehr langfristig erreicht werden könnte und dass insbesondere die Finanzierung nicht gesichert war. In der Folge nahmen die Städte nach und nach Abstand von den bisherigen Planungen und wandelten sie erneut in Richtung eines Mischsystems ab, das die als Teil der U-Bahn-Planung entworfenen Tunnelstrecken mit oberirdischen, bevorzugt auf unabhängigem oder besonderem Bahnkörper geführten Außenstrecken kombiniert. Die Netze wurden unter dieser neuen Maßgabe weiterentwickelt und gingen letztlich in den heutigen Stadtbahn-Systemen von Bielefeld, Frankfurt, Hannover, Köln und Bonn sowie Stuttgart und den Teilnetzen der Stadtbahn Rhein-Ruhr auf.[120][121][123][124][125][126] Bremen gab seine U-Bahn-Planungen vor dem Bau der geplanten Tunnelstrecken auf und modernisierte sein Straßenbahnnetz konventionell, hatte allerdings in den 1960er und 1970er Jahren in Hinblick auf den späteren U-Bahn-Betrieb mehrere kreuzungsfreie, teilweise in Hochlage geführte Streckenerweiterungen realisiert.[21] Lediglich München und Nürnberg setzten ihre Planungen weitgehend entsprechend der ursprünglichen Konzeption um und stellten vollständig kreuzungsfrei trassierte U-Bahn-Netze her. Gleichzeitig behielten beide Städte ihre Straßenbahnen und entwickelten auch diese weiter.
Neue Betriebe in Osteuropa
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-
Arbeiter beim Bau der Budapester Metro in einem Streckentunnel, 1953
-
Bergmännisch aufgefahrener Rolltreppentunnel an der Station Arsenalna der Metro Kiew; zahlreiche der nach sowjetischem Muster gebauten Systeme verzichten auf Festtreppen und Aufzüge
-
Baureihe 81-717/714 (links) und der bis in die 1970er Jahre produzierte Vorgängertyp „E“ (rechts) von Metrowagonmasch: Standardfahrzeuge zahlreicher osteuropäischer Netze
Die Prinzipien der Charta von Athen übten auch auf die Stadtplanung in den sozialistischen Staaten des östlichen Mitteleuropas und Osteuropas erheblichen Einfluss aus. Da sich der private Pkw-Besitz jedoch nicht in derselben Geschwindigkeit wie in Westeuropa entwickelte, spielte der ÖPNV hier eine wesentlich größere Rolle und bestehende Straßenbahnnetze wurden hier grundsätzlich erhalten.
Ab Mitte des 20. Jahrhunderts wurden in zahlreichen Städten der Sowjetunion und anderer RGW-Staaten neue U-Bahnen aufgebaut, wobei die Inbetriebnahme teilweise erst nach Auflösung von RGW (Juni 1991) und Sowjetunion (Dezember 1991) erfolgte und die ursprünglich geplanten Zielnetze teilweise bis in die Gegenwart nicht realisiert wurden. Zu den in dieser Zeit realisierten bzw. initiierten Systemen gehören u. a. Leningrad (Eröffnung: 1955), Kiew (1960), Tbilissi (1966), Baku (1967), Prag (1974), Charkiw (1975), Taschkent (1977), Bukarest (1979), Jerewan (1981), Minsk (1984), Nischni Nowgorod (1985), Samara (1987), Dnipro (1995), Warschau (1995), Sofia (1998), Kasan (2005) und Almaty (2011). In Budapest wurden zusätzlich zur 1896 eröffneten ersten Linie zwei weitere Linien gebaut, der erste Abschnitt eröffnete hier 1970. Hinzu kamen U-Straßenbahnen, beispielsweise in Wolgograd und Krywyj Rih.
Für Aşgabat, Bischkek, Chișinău, Duschanbe, Tallinn und Vilnius, die Hauptstädte der weiteren Unionsrepubliken, wurden zu Zeiten der Sowjetunion keine U-Bahn-Planungen verfolgt, da diese damals weniger als eine Million Einwohner hatten, was als grundsätzliche Voraussetzung für den Bau einer U-Bahn angesetzt wurde.
Die technischen Grundlagen basierten in den meisten der neu geschaffenen Netze auf einem Technologietransfer von der Moskauer Metro und waren daher relativ einheitlich und wiesen zahlreiche Parallelen zum Moskauer Netz auf. In den meisten Städten wurde ein Sekantennetz mit drei Linien entworfen, die einander jeweils einmal kreuzen, sodass sich drei Umsteigepunkte zwischen den Linien ergeben und jede Station im Netz mit maximal einmaligem Umstieg erreicht werden kann. Im Gegenzug wird ein besonders aufwendiger Umsteigeknoten mit drei Ebenen und zahlreichen Verbindungsgängen vermieden. Der durchschnittliche Abstand zwischen den Stationen ist größer als in den anderen europäischen Netzen der gleichen Periode, was eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit ermöglicht, jedoch eine gröbere Erschließungswirkung und damit längere Zu- und Abgangswege für einen Teil der Fahrgäste bedingt. Als Rollmaterial wurden – entsprechend der für den RGW typischen arbeitsteiligen Spezialisierung der nationalen Industrien auf bestimmte Produkte und Leistungen – in den meisten Netzen Fahrzeuge des russischen Herstellers Metrowagonmasch eingesetzt, u. a. der ab 1976 hergestellten Baureihe 81-717/714, die teilweise bis in die Gegenwart verwendet werden. Einzelne Prototypen in der Tschechoslowakei, wo ČKD Tatra 1970 die Baureihe R1 vorstellte, und in Ungarn, wo Ganz 1986 einen Zug des Typs G2 baute, blieben hingegen ohne nachhaltigen Erfolg. Wie in Moskau wurden Tunnel und Stationen häufig in erheblicher Tiefe angelegt, um im Kriegsfalls als Luftschutzbunker genutzt werden zu können (siehe auch hier). Weiterhin wurde auch die von der Moskauer Metro bekannte aufwändige architektonische Ausgestaltung einzelner Stationen übernommen (siehe auch hier).
Für die Spurweite wurde das im jeweiligen Land bei der Eisenbahn übliche Maß übernommen, das heißt für die meisten Netze russische Breitspur (1520 bis 1524 mm), in der Tschechoslowakei (Prag), in Polen (Warschau) und Bulgarien (Sofia) Normalspur (1435 mm). Die Spurweite des Bukarester Netzes weicht mit 1432 mm geringfügig von der ansonsten auch in Rumänien verwendeten Normalspur ab. Die Stromversorgung erfolgte in allen Netzen über eine seitliche Stromschiene, meist mit 825 V Gleichspannung, in Prag, Bukarest und Warschau abweichend mit 750 V Gleichspannung, wie auch bei den vier deutschen U-Bahnen.
Die 1973 eröffnete U-Bahn der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang weist ebenfalls die oben genannten Merkmale auf, insbesondere die extrem tiefe Lage von Tunneln und Stationen, die großen Haltestellenabstände, die reichhaltige Ausgestaltung der Stationen, die hier einen starken Fokus auf großformatige, als Mosaik ausgeführte Wandbilder hat (siehe auch hier), und die Verwendung von Zugfolgeuhren. Anders als in den osteuropäischen Netzen wurden jedoch in China produzierte Fahrzeuge des Typs DK4 und keine sowjetischen Fabrikate eingesetzt.
- Sonderfälle Berlin, Bukarest und Belgrad

Unter den U-Bahnen in den Mitgliedstaaten des RGW nahmen die Systeme in Ost-Berlin und Bukarest eine Sonderstellung ein.
In Ost-Berlin, das neben Budapest und Moskau als einzige Stadt im Ostblock bereits vor dem Zweiten Weltkrieg über eine U-Bahn verfügt hatte, wurden die bestehenden technischen Parameter beibehalten und es wurden keine Planungen nach Muster der oben genannten Vorhaben verfolgt. Die in der DDR realisierten Erweiterungsvorhaben umfassten mit der 1973 eröffneten Station Tierpark der heutigen U5 lediglich eine unterirdische Haltestelle, ansonsten beschränkte sich der Ausbau auf oberirdische Erweiterungen. Tierpark wurde als Verlängerung einer bestehenden Tunnelstrecke in einer für das Berliner Netz üblichen Tiefenlage angelegt und weist eine sachliche Gestaltung auf, die sich in die Stilistik des bestehenden Netzes einfügt.[127] Als Rollmaterial wurden die vorhandenen Vorkriegsbaureihen sowie in der DDR produzierte Fahrzeuge der Baureihe E verwendet.[128]
In Bukarest war es erklärtes Ziel von Staatspräsident Nicolae Ceaușescu, die U-Bahn nach Möglichkeit ohne ausländische Hilfe und ausländische Technologien zu planen und umzusetzen, um die Unabhängigkeit und Leistungsfähigkeit Rumäniens, seiner Industrie und seines Ingenieurwesens zu demonstrieren, weshalb sich das System in einer Reihe markanter Punkte von anderen osteuropäischen Netzen unterscheidet. Zunächst sah das Anfang der 1970er Jahre erarbeitete Zielnetz zwei sich an der Piața Unirii kreuzende Durchmesserlinien und eine 35 Kilometer lange Halbringlinie durch den Norden, Westen und Süden der Stadt vor und unterschied sich damit von den ansonsten geplanten Sekantennetzen. Allerdings wurden die Planungen im weiteren Verlauf abgeändert, u. a. mehrfach nach persönlicher Intervention Nicolae und Elena Ceaușescus. Der Anspruch auf technologische Unabhängigkeit zeigte sich u. a. im Einsatz von in Rumänien entwickelten und produzierten Fahrzeugen des Typs REM vom Hersteller Astra IVA. Ungewöhnlich war zudem der Betrieb durch die Staatsbahn Căile Ferate Române (CFR)[129] im Unterschied zu den ansonsten auch in Osteuropa üblichen kommunalen Betreibern. Der gegenwärtige Betreiber Metrorex S.A. untersteht ebenfalls unmittelbar dem rumänischen Verkehrsministerium. Weiterhin verzichtete Bukarest weitgehend auf die reichhaltige Ausgestaltung von Stationen und wählte stattdessen insgesamt reduziertere und diszipliniertere Entwürfe.[60]
Belgrad, zunächst Hauptstadt des ebenfalls sozialistischen, jedoch blockfreien Jugoslawiens und ab 1992 Hauptstadt der diversen Nachfolgestaaten Jugoslawiens, beschäftigt sich seit 1968 mit dem Bau einer eigenen U-Bahn, brachte jedoch lange Zeit keines der verschiedenen im Laufe der Jahrzehnte vorgeschlagenen Netze zur Umsetzung.[60] Im Mai 2023 schloss die Stadt jedoch mit einem internationalen Konsortium aus Power China, Alstom Aegis, Systra und DB Engineering & Consulting einen Vertrag über den Bau einer ersten von drei geplanten Linien. Die Eröffnung ist für das Jahr 2030 avisiert.[130][131]
- Unvollendete und verworfene Projekte
Neben den oben genannten und letztlich realisierten Systemen wurden in den 1980er Jahren auch Planungen für Netze in Riga, Donezk, Omsk und Tscheljabinsk entwickelt. Das Vorhaben in Riga stand 1990 unmittelbar vor dem Baubeginn, wurde jedoch im zeitlichen Umfeld der Spätphase der Singenden Revolution und der Unabhängigkeitserklärung Lettlands zunächst nicht umgesetzt und nach Auflösung der Sowjetunion und unter dem Eindruck des seit 1990 konstanten Bevölkerungsrückgangs in der Stadt und im gesamten Land[132] insgesamt verworfen.[59] In Donezk, Omsk und Tscheljabinsk wurden die Arbeiten an den ersten Streckenabschnitten jeweils 1992 aufgenommen, jedoch in allen drei Städten bislang nicht abgeschlossen bzw. in Omsk 2018 offiziell eingestellt. In Donezk ist in Hinblick auf eine mögliche Fertigstellung zu berücksichtigen, dass die Stadt im Rahmen des russisch-ukrainischen Krieges seit 2014 umkämpft ist bzw. von offenen Kriegshandlungen betroffen ist.
1970er Jahre: Globale Expansion
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Während der U-Bahn-Bau bis zur Mitte den 20. Jahrhunderts maßgeblich durch Haupt- und Großstädte Westeuropas, der Vereinigten Staaten und Japans dominiert wurde und sich weltweit auf weniger als zwei Dutzend Städte beschränkte, wuchs die Zahl der Netze ab der zweiten Hälfte des Jahrhunderts verstärkt und erstmals auch in anderen Weltteilen in bedeutendem Umfang.
Insbesondere ab den 1970er Jahren entwickelte sich das Wachstum sprunghaft und umfasste außerhalb der weiterhin steigenden Zahl von Netzen in Westeuropa und Nordamerika und der neuen Systeme in Lateinamerika und den sozialistischen Staaten des östlichen Europas im Schwerpunkt die Haupt- und Großstädte Asiens.
Frühes 21. Jahrhundert: Neuer Schwerpunkt in Asien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das in den 1970er Jahren begonnene Wachstum setzt sich in das frühe 21. Jahrhundert fort. Während in den frühen U-Bahn-Regionen Westeuropa, Nordamerika und Japan nur noch wenige neue Netze angelegt bzw. projektiert werden und sich das Wachstum vorrangig auf den Ausbau bestehender Systeme konzentriert, bilden ab der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts vor allem Ost- und Südasien die wichtigsten globalen Entwicklungsschwerpunkte; gab es bis zum Jahr 2010 insgesamt 39 Systeme in diesen Regionen, die mit Ausnahme der drei japanischen Netze in Tokio (Inbetriebnahme: 1927), Osaka (1933) und Nagoya (1957) alle nach 1970 eröffnet worden waren, wurden zwischen 2010 und 2020 insgesamt 44 Systeme neu in Betrieb genommen.[2] Mit 22 Netzen entfiel die Hälfte davon auf China, weitere elf auf Indien. Im gleichen Zeitraum ergab sich zudem ein deutliches Wachstum im Nahen Osten und Nordafrika von drei auf zehn Systeme.
Seit Beginn der 2020er Jahre wurden weltweit weitere 20 Netze, der Großteil hiervon ebenfalls in China eröffnet. Am 30. Juni 2023 wurde mit der Skyline in der hawaiianischen Hauptstadt Honolulu die erste U-Bahn Polynesiens und Ende 2023 mit der Blue Line des Lagos Rail Mass Transit das erste System im subsaharischen Afrika und das nach Kairo und Algier dritte auf dem gesamten afrikanischen Kontinent in Betrieb genommen. Ebenfalls im Jahr 2023 eröffneten die Systeme in Sydney als erstes Netz Australiens und das Réseau express métropolitain in Montreal, das die bestehende Metro der Stadt ergänzt.
In allen Teilen der Welt sind weiterhin neue Netze und Erweiterungen bestehender Systeme in Planung oder Umsetzung. In Europa wird in Belgrad,[130] Cluj-Napoca,[133] Dublin[134] und Thessaloniki[135] der Bau neuer Netze verfolgt, hinzu kommen die Systeme in Donezk und Tscheljabinsk, die sich seit 1992 in Bau befinden, deren Eröffnung jedoch weiterhin nicht absehbar ist.
Sonderthema U-Bahn-Vorhaben anlässlich von Großveranstaltungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Großveranstaltungen wie Weltausstellungen, Olympische Spiele, Fußball-Weltmeisterschaften und Fußball-Europameisterschaften sind vielfach Anlassgeber und Katalysator für weitreichende stadt- und verkehrsplanerische Entwicklungsprozesse und für erhebliche Investitionen in Erneuerung, Modernisierung und Ausbau öffentlicher sowie privater Infrastruktur, um beispielsweise Bauland zu mobilisieren und zu erschließen, Sportanlagen und Ausstellungsgebäude zu errichten und Verkehrssysteme auf Straße und Schiene für den Transport von Besuchern, Personal und Material während der Veranstaltung und ggf. für die Nachnutzung und weitere Entwicklung des Veranstaltungsgeländes herzustellen und anzupassen.
Neben der unmittelbaren praktischen Dimension sind solche Investitionen auch im Kontext der bedeutenden Schaufensterfunktion zu betrachten, mit der Veranstaltungen der genannten Art für die Gastgeberstadt und häufig für das gesamte Land verbunden sind, da sie die Gelegenheit eröffnen, einer globalen Öffentlichkeit Besonderheiten, Qualitäten und Leistungen des Gastgebers – bzw. eine vom Gastgeber gewünschte Version hiervon – zu präsentieren. Aus diesem Repräsentationsgedanken ergeben sich häufig ein erhöhter Anspruch an Qualität und Maßstab von Infrastruktureinrichtungen und eine größere Bereitschaft lokaler und nationaler Geldgeber zur Bereitstellung der zur Umsetzung erforderlichen Mittel.[136] Ebenso befördern das Vorhandensein eines gesetzten Eröffnungsdatums und teilweise auch der Wunsch nach Vermeidung eines Gesichtsverlustes infolge der Nichterreichtung zugesagter Leistungen eine zügige Umsetzung und die Bereitstellung ggf. erforderlicher zusätzlicher Ressourcen.
Nachfolgend eine Auswahl von Großveranstaltungen, die Ausgangspunkt und/oder Beförderer von U-Bahn-Vorhaben waren.
Welt- und Großausstellungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Weltausstellung 1893, Chicago: Die erste Hochbahnlinie Chicagos, die im Juni 1892 eröffnete Chicago and South Side Rapid Transit Railroad, erhielt 1893 mit der Jackson Park Branch (heute: East 63rd Branch) eine Verlängerung zum Gelände der Chicagoer Weltausstellung. Die Endstation Jackson Park lag im Westen des Areals und wurde am 12. Mai 1893, eine Woche nach Eröffnung der Ausstellung, in Betrieb genommen und mit deren Abschluss am 31. Oktober 1893 geschlossen. Die Jackson Park Branch wurde bis zur nächstgelegenen Station Stony Island verkürzt, die hiernach den Namen Jackson Park übernahm. Die Strecke wurde 1982 bis University und 1994 bis zu ihrem heutigen Endpunkt Cottage Grove zurückgezogen und ist heute Teil der Green Line.[8]
- Budapester Millenniumsausstellung 1896: Die erste U-Bahn-Linie Budapests wurde anlässlich der Feierlichkeiten zum 1000-jährigen Jubiläum der ungarischen Landnahme gebaut, weshalb sie auch Millenniums-U-Bahn (hu. Millenniumi Földalatti Vasút) genannt wird.[137] Die Strecke verband das Zentrum der Innenstadt am heutigen Vörösmarty tér mit dem Gelände der Millenniumsausstellung im Stadtwäldchen, die ursprüngliche oberirdische Endstation dort wurde 1973 im Zuge der Verlängerung der Linie nach Mexikói út aufgelassen und durch eine Tunnelstation ersetzt.
- Weltausstellung und Olympische Sommerspiele 1900, Paris: Der Entscheidung für den Bau der Métro ging eine längere Systemdiskussion zwischen der französischen Regierung, die eine Eisenbahnstrecke zur Verbindung der bestehenden Pariser Kopfbahnhöfe favorisierte, und der Stadt Paris, die ein stärker auf die städtischen Verkehrsbedürfnisse ausgerichtetes System wünschte, voraus. Die erfolgreiche Bewerbung von Paris für die Ausrichtung der Weltausstellung und der Olympischen Spiele im Jahr 1900 mit verschiedenen über das Stadtgebiet verteilten Veranstaltungsstätten unterstützte die Argumentation der Stadt zugunsten eines städtischen Nahverkehrsmittels.[107] Die erste Strecke der Métro erschloss entsprechend die Anlagen der Weltausstellung, die sich auf einen größeren Bereich westlich des Pariser Zentrums mit Ausstellungsgebäuden auf dem Champ de Mars, in den Jardins du Trocadéro und an der Esplanade des Invalides (u. a. Station Trocadéro) und auf den Bois de Vincennes am östlichen Stadtrand (östliche Endstation Porte de Vincennes) verteilten.
- Weltausstellung 1939/1940, New York: Das Gelände der New Yorker Weltausstellung von 1939 und 1940 im Flushing Meadows–Corona Park wurde durch eine temporäre Zweigstrecke der städtischen Independent Subway, die World's Fair Railroad, bedient. Diese nutzte eine bestehende Betriebsstrecke östlich der Station 71st–Continental Avenues (heute: Forest Hills–71st Avenue) auf der IND Queens Boulevard Line zum Betriebshof Jamaica Yard und eine anschließende Neubaustrecke zum Ausstellungsgelände mit der einzigen Station World’s Fair. Die Strecke wurde am Eröffnungstag der Ausstellung am 30. April 1939 in Betrieb genommen und von der Linie GG bedient, die im Westen bis zur Station Smith–Ninth Streets in Brooklyn verlief. Nach Abschluss der Ausstellung Ende Oktober 1940 wurde die Strecke Ende desselben Jahres bis zum Betriebshof zurückgebaut.
- Weltausstellung 1942, Rom (abgesagt): Die erste U-Bahn-Strecke Roms sollte die Innenstadt und den Hauptbahnhof Roma Termini mit dem Gelände der für 1942 geplanten Weltausstellung im Süden der Stadt verbinden. Der Tunnelbau begann 1938, die Arbeiten wurden jedoch wie auch die Ausstellung selbst nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, an dem das faschistisch regierte Italien als Achsenmacht teilnahm, aufgegeben. Die zu diesem Zeitpunkt bereits fertiggestellten Tunnelstücke wurden im Krieg als Luftschutzbunker verwendet.
Die Arbeiten wurden nach Ende des Kriegs wieder aufgenommen, die erste Strecke der heutigen Linie B wurde schließlich im Februar 1955 zwischen Termini und Laurentina eröffnet und diente wenige Jahre später der Anbindung der Wettkampfstätten der Olympischen Sommerspiele 1960, die auf dem zuvor für die Weltausstellung vorgesehenen Gelände errichtet worden waren (Stationen EUR Marconi – heute: EUR Palasport – und EUR Fermi).[66]
- Weltausstellung 1967, Montreal: Die Ligne jaune, die das Gelände der Weltausstellung auf der Île Sainte-Hélène im Sankt-Lorenz-Strom sowie die seinerzeit rapide wachsende Vorstadt Longueuil am östlichen Ufer des Flusses erschließt, war kein Bestandteil des 1961 beschlossenen U-Bahn-Grundnetzes, sondern wurde erst nach Vergabe der Ausstellung an Montreal im Jahr 1962 in die Planungen aufgenommen. Die Linie wurde am 31. März 1967 zwischen dem innerstädtischen Netzknoten Berri-de Montigny (heute: Berri-UQAM) und Longueuil (heute: Longueuil–Université-de-Sherbrooke) in Betrieb genommen, die Station am Weltausstellungsgelände, Île Sainte-Hélène (heute: Jean-Drapeau), folgte jedoch erst am 28. April 1967, einen Tag nach der offiziellen Eröffnung der Ausstellung.[138][139]
- Weltausstellung 1986, Vancouver: Die erste Strecke des SkyTrain-Netzes, die heutige Expo Line, entstand im Vorfeld der Weltausstellung von 1986 und sollte u. a. die wichtigsten Ausstellungsflächen erschließen.
Die Stadt Vancouver hatte sich bereits seit Ende der 1960er Jahre mit der Wiedereinführung eines städtischen Schienenverkehrssystems beschäftigt. Nachdem sich hierfür zunächst eine Stadtbahn, wie sie zur gleichen Zeit in Calgary und Edmonton umgesetzt wurde, als favorisiertes System abgezeichnet hatte, entschied sich die Stadt 1981 mit Blick auf die Verkehrserfordernisse der Weltausstellung und unter dem Eindruck des Expo-Themenschwerpunkts Verkehr und Kommunikation für die Umsetzung des in Kanada entwickelten, damals neuartigen Intermediate Capacity Transit System, das zur selben Zeit bei der Scarborough Line in Toronto umgesetzt wurde. Das System diente damit gleichzeitig als Demonstrationsanlage für die Technologie, die zudem im speziellen Kontext der Weltausstellung den Innovationsanspruch des Technologiestandorts Kanada gegenüber der internationalen Öffentlichkeit unterstreichen sollte.
Der Baubeginn erfolgte 1983, die Inbetriebnahme am 11. Dezember 1985, rund sechs Monate vor Beginn der Weltausstellung am 2. Mai 1986. Die Strecke verlief von Waterfront im Norden der Innenstadt in südöstliche Richtung durch den Osten Vancouvers und Burnaby bis New Westminster. Die Linie erschloss dabei den kanadischen Expo-Pavillon (Station Waterfront) und das anlässlich der Ausstellung errichtete und für die Eröffnungs- und Abschlussfeierlichkeiten genutzte BC Place Stadium (Stadium, heute: Stadium–Chinatown), während das Hauptausstellungsgelände am Nordufer des False Creek nicht direkt angebunden wurde. Dies erfolgte erst 2009 mit Inbetriebnahme der Station Yaletown–Roundhouse der Canada Line.[11]
- Weltausstellung 1998, Lissabon: Die Linha Vermelha wurde maßgeblich zur Erschließung des Weltausstellungsgeländes und der angrenzenden städtebaulichen Entwicklungsgebiete im Nordosten Lissabons, dem heutigen Parque das Nações, gebaut. Die gut 5 Kilometer lange Strecke zwischen der Bestandsstation Alameda der Linha Verde und der neuen Station Oriente am Ausstellungsgelände wurde am 19. Mai 1998, drei Tage vor Eröffnung der Ausstellung, in Betrieb genommen. Am selben Tag wie die Metro nahm zudem der neue, direkt über der Metrostation gelegene Lissabonner Ostbahnhof an der portugiesischen Hauptschienenmagistrale Linha do Norte den Betrieb auf.[64]
- Weltausstellung 2005, Präfektur Aichi: Die Magnetschwebebahn Linimo bzw. offiziell Tōbu Kyūryō Line wurde zur Anbindung des Weltausstellungsgeländes an den Nahverkehr sowie zur Förderung der städtebaulichen Entwicklung der Stadt Nagakute, auf deren Gebiet die Strecke mehrheitlich liegt, gebaut. Das System wurde am 6. März 2005, rund drei Wochen vor Eröffnung der Ausstellung, in Betrieb genommen und führt über eine 8,9 Kilometer lange Ost-West-Strecke vom östlichen Endpunkt der Higashiyama Line der U-Bahn Nagoya in Fujigaoka bis zum Bahnhof Yakusa an der Aichi-Ringlinie.[68] Das Hauptgelände der Ausstellung wurde durch die Station Bampaku Kaijō (dt. Expo-Gelände) erschlossen, die im Jahr 2006 entsprechend der nach Abschluss der Ausstellung erfolgten Umnutzung des Areals in Aichikyūhaku-kinen-kōen (dt. Aichi-Expo-Gedenkpark) umbenannt wurde.
Nachdem das System zunächst nur wegen seines verkehrlichen Nutzens ausgewählt worden war, entwickelte es sich im Laufe der Zeit zu einem inoffiziellen Demonstrationsprojekt der Weltausstellung im Themenbereich Mobilität,[140] ähnlich der späteren Expo Line in Vancouver, die allerdings von Anfang an in den inhaltlichen Kontext ihrer Ausstellung gestellt worden war.
Olympische und Paralympische Spiele
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Olympische Winterspiele 1972, Sapporo: Als Reaktion auf sein rapides Bevölkerungswachstums seit Beginn der 1960er Jahre hatte Sapporo bereits frühzeitig die langfristige Entwicklung eines U-Bahn-Netzes beschlossen. Nach Vergabe der Winterspiele an die Stadt im April 1966 setzten Sapporo und die Präfektur Hokkaidō ein umfangreiches Infrastrukturprogramm auf, in dessen Rahmen ab 1969 auch die erste U-Bahn-Strecke der Stadt gebaut wurde. Die Namboku Line wurde am 16. Dezember 1971, anderthalb Monate vor Eröffnung der Spiele am 3. Februar 1972, zwischen Kita-Nijūyo-Jō im Norden der Stadt, dem Bahnhof Sapporo, der Innenstadt und Makomanai im Süden eröffnet. Die südliche Endstation liegt etwa 20 Minuten Fußweg vom Olympiagelände im Makomanai-Park entfernt.[68][141]
- Olympische Sommerspiele 1972, München: Ein bedeutender Einflussfaktor auf den Bau der Münchner U-Bahn war die Vergabe der Sommerspiele an die Stadt im Jahr 1966, in deren Folge die bereits laufenden Bauarbeiten erheblich beschleunigt und die Erschließung des Olympiageländes priorisiert wurde. Die erste Strecke zwischen Goetheplatz und Kieferngarten konnte so bereits am 19. Oktober 1971, rund vier Jahre vor dem ursprünglichen Zieldatum, eröffnet werden. Die Verlängerung bzw. der Abzweig von der Station Münchner Freiheit zum Bahnhof Olympiazentrum wurde am 8. Mai 1972, rund dreieinhalb Monate vor Eröffnung der Spiele, in Betrieb genommen[21] und von der neu eingerichteten Linie U3 bedient, die daher auch als Olympialinie bekannt wurde.[142]
- Olympische Sommerspiele 1976, Montreal: Die Vergabe der Spiele an Montreal beförderte die Umsetzung der zweiten Ausbauphase der Ligne verte, um den Olympiapark an die U-Bahn anzuschließen. Die Verlängerung von der bisherigen Endstation Frontenac bis zur heutigen Endstation Honoré-Beaugrand, die das Olympiagelände mit den Stationen Pie-IX und Viau erschließt, erfolgte am 6. Juni 1976, sechs Wochen vor Eröffnung der Spiele.
- Olympische Sommerspiele 2004, Athen: Im Hinblick auf die Olympischen Spiele eröffnete Athen vier Jahre vor Eröffnung der Wettkämpfe mit den Linien 2 und 3 zwei neue U-Bahn-Strecken, das für den Bau der neuen Linien zuständige Baukonsortium hieß entsprechend Olympiako Metro. Gleichzeitig wurde die schon seit dem 19. Jahrhundert bestehende und seit 1904 elektrisch betriebene Vorortbahn nach Piräus als Linie 1 in das neu geschaffene U-Bahn-Netz integriert, nachdem sie zuvor lediglich Ilektrikós (dt. Elektrische) genannt wurde. Der im Athener Vorort Marousi gelegene Olympia-Sportkomplex, zu dem u. a. das Olympiastadion gehört, wurde bzw. wird durch die direkt am Hauptzugang des Geländes gelegene Station Eirini/Irini (Ειρήνη) der Linie 1 erschlossen.
- Olympische Winterspiele 2006, Turin: Die Stadt Turin beschloss bereits 1995 den Bau einer U-Bahn, konnte das Vorhaben aufgrund fehlender Finanzmittel jedoch zunächst nicht umsetzen. Nach Vergabe der Winterspiele an Turin im Juni 1999 erklärte sich die italienische Regierung im selben Jahr zu einer 60-prozentigen Beteiligung an den Gesamtkosten bereit und ermöglichte so die Realisierung. Die Arbeiten wurden im Jahr 2000 aufgenommen und konnten auf dem ersten Abschnitt der Linie 1 zwischen Fermi am westlichen Stadtrand und XVIII Dicembre in Nähe des Bahnhofs Porta Susa bis zum 4. Februar 2006, sechs Tage vor Eröffnung der Spiele, abgeschlossen werden.[66] Die Strecke erschließt allerdings keine der Turiner Wettkampfstätten, die alle im Süden der Stadt lagen, und diente daher allgemein der Verbesserung des ÖPNV in der Stadt.
- Olympische Winterspiele 2010, Vancouver: Wie zuvor die Expo Line für die Weltausstellung von 1986 wurde die Canada Line maßgeblich in Hinblick auf die Winterspiele im Jahr 2010 geplant und realisiert. Die rund 19,2 Kilometer lange Strecke wurde am 17. August 2009, rund sechs Monate vor Eröffnung der Spiele am 12. Februar 2010, in Betrieb genommen und verbindet die Innenstadt von Vancouver im Norden mit dem Zentrum der Stadt Richmond und dem ebenfalls auf dem Gebiet von Richmond gelegenen internationalen Flughafen Vancouver im Süden bzw. Südwesten. In Vancouver erschließt die Strecke das für die Eröffnungs- und Schlussfeier und die Siegerehrungen genutzte BC Place Stadium und die für einen Teil der Eishockey-Wettbewerbe genutzte heutige Rogers Arena (jeweils Station Yaletown–Roundhouse zusammen mit Stadium–Chinatown der Expo Line), das olympische Dorf (Olympic Village zusammen mit Main Street–Science World der Expo Line) und den für die Curling-Wettbewerbe genutzten Hillcrest Park (King Edward) sowie in Richmond das für die Eisschnelllauf-Wettbewerbe genutzte Richmond Olympic Oval (Lansdowne).
Analog zur Expo Line wurde für die Linie zunächst der Name Olympic Line vorgeschlagen, auf Drängen der kanadischen Bundesregierung wurde jedoch letztlich Canada Line gewählt, um den nationalen Beitrag zur Finanzierung des Vorhabens zu würdigen.[11]
- Olympische Sommerspiele 2012, London: In Vorbereitung auf die Spiele erhielt die Docklands Light Railway einen zusätzlichen Streckenast zwischen Canning Town, dem wichtigen Verkehrsknoten Stratford und dem Regionalbahnhof Stratford International, mit dem u. a. umsteigefreie Verbindungen zwischen dem unmittelbar westlich von Stratford gelegenen Olympiapark und den im Messezentrum ExCeL eingerichteten temporären Wettkampfstätten (Station Custom House) sowie dem London City Airport und dem Bahnhof Woolwich Arsenal geschaffen wurden. Die Strecke wurde auf der früheren Trasse der North London Line errichtet, die hierfür bis Stratford verkürzt wurde, und verläuft parallel zur Jubilee Line. Die Verlängerung wurde am 31. August 2011, rund elf Monate vor Eröffnung der Spiele, in Betrieb genommen.[47]
- Olympische Sommerspiele 2024, Paris: Die Realisierung der im Rahmen des Großprojekts Grand Paris Express geplanten Verlängerungen der Métrolinie 14 von Olympiades zum Flughafen Orly im Süden und von Mairie de Saint-Ouen nach Saint-Denis – Pleyel im Norden wurde in Hinblick auf die Austragung der Sommerspiele vom ursprünglichen Zieljahr 2027 auf 2024 vorgezogen, die Eröffnung beider Strecken erfolgte am 24. Juni, rund einen Monat vor der Eröffnungsfeier am 26. Juli. Die nördliche Endstation Saint-Denis – Pleyel liegt rund 15 Minuten Fußweg vom Stade de France, das während der Spiele als Olympiastadion und als Austragungsort für die Leichtathletik- und Rugby-Wettbewerbe sowie für den Hauptteil der Abschlussfeier diente, und dem Centre Aquatique Olympique, in dem die Wettbewerbe im Wasserspringen, Synchronschwimmen und die Vorrundenspiele im Wasserball stattfanden, entfernt. Weiterhin wurde mit der direkten U-Bahn-Anbindung des Flughafens Orly an das Pariser Zentrum (u. a. mit den zentralen Netzknoten Châtelet - Les Halles und Saint-Lazare) ein bedeutender Beitrag zu dessen verkehrlicher Integration geleistet.[143]
- Olympische Sommerspiele 2024/2028, Hamburg (aufgegebene Bewerbung): Die Freie und Hansestadt Hamburg erwog im Rahmen ihrer geplanten Bewerbung für die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2024 bzw. 2028 eine Verlängerung der U4 über den bisherigen südlichen Endpunkt Elbbrücken hinaus auf den Kleinen Grasbrook, auf dem der Großteil der Wettkampfstätten und das olympische Dorf angesiedelt werden sollten. Die Strecke sollte allerdings erst in der Nachnutzung des Areals in Betrieb genommen werden, die insbesondere eine Konversion zugunsten einer regulären Wohnnutzung vorsah.[144]
Nachdem die Hamburger Bevölkerung die Bewerbung im November 2015 im Rahmen eines Referendums ablehnte, wurden die Planungen auf zunächst unbestimmte Zeit zurückgestellt,[145] jedoch bereits 2017 im Kontext des Stadtentwicklungsprojektes Grasbrook, das die Entwicklung eines größeren Teils des zuvor für das Olympiagelände vorgesehenen Areals beinhaltet, erneut aufgegriffen.[146]
Fußballmeisterschaften
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Fußball-Europameisterschaft 2008, Gastgeberstadt Wien: Die Stadt Wien beschloss bereits 1998 die Verlängerung der U2 vom bisherigen innerstädtischen Endpunkt Schottentor in den Stadtteil Aspern im 22. Gemeindebezirk östlich der Donau. Die Umsetzung des ersten Bauabschnitts bis zur Station Stadion am Ernst-Happel-Stadion wurde in Hinblick auf die Fußball-Europameisterschaft priorisiert vorangetrieben. Die Inbetriebnahme erfolgte am 10. Mai 2008, rund einen Monat vor dem ersten im Ernst-Happel-Stadion durchgeführten Spiel des Wettbewerbs am 8. Juni 2008.
- Fußball-Weltmeisterschaft 2018, Gastgeberstadt Nischni Nowgorod: Die Sormowsko-Meschtscherskaja-Linie wurde von der zentralen Station Moskovskaya am Moskauer Bahnhof um gut zwei Kilometer und eine Station nach Norden bis Strelka verlängert, um das dort gelegene neue WM-Stadion zu erschließen. Die Inbetriebnahme erfolgte am 12. Juni 2018, knapp eine Woche vor dem ersten Spiel in der Stadt.[147][148]
- Fußball-Weltmeisterschaft 2022, Großraum Doha: Die Realisierung der U-Bahn wurde nach Vergabe der Weltmeisterschaft an Katar Ende 2010 priorisiert und konnte bereits im Mai 2019, rund dreieinhalb Jahre vor Beginn des Wettbewerbs, abgeschlossen werden.
Übersicht Pionierbetriebe bis 1914
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über unabhängig trassierte städtische Bahnen und Bahnstrecken bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs.
| Stadt | Land | Betrieb | Eröffnung | El. Betrieb | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Brooklyn, heute New York City |
Atlantic Avenue Tunnel | 3. Dezember 1844 | nein | Der auch als Cobble Hill Tunnel bekannte, knapp 500 Meter lange Abschnitt der Long Island Rail Road wurde zunächst in einem Graben gebaut und 1850 überwölbt und mit der Atlantic Avenue überbaut, weshalb der Tunnel in der Literatur vereinzelt als erste U-Bahn der Welt bezeichnet wird. Es handelte sich jedoch um einen Eisenbahntunnel ohne Bahnhöfe. Er wurde 1861 stillgelegt. | |
| London | Metropolitan Railway | 10. Januar 1863 | ja | Eröffnet als unterirdische Verlängerung der Great Western Railway zwischen Farringdon und Paddington mit sieben Stationen; zunächst Dampfbetrieb, Elektrifizierung ab 1905; erste Erweiterung 1868. Die Strecke ist heute Teil der Metropolitan Line und der Hammersmith & City Line der London Underground. | |
| New York City | West Side and Yonkers Patent Railway | 1867 | nein | Hochbahn mit Kabelantrieb (später Dampfbetrieb) in der Greenwich Street und der 9th Avenue. | |
| London | District Railway | 24. Dezember 1868 | ja | erster Abschnitt: von Westminster nach South Kensington; zunächst Tochtergesellschaft, dann Konkurrent der Metropolitan Railway, baute und nutzte ab 1884 gemeinsam mit dieser die Ringstrecke der heutigen Circle Line der London Underground. | |
| New York City | Beach Pneumatic Transit | 26. Februar 1870 | nein | mit Schildvortrieb erbauter Tunnel unter dem Broadway, pneumatischer Antrieb (ähnlich einer Rohrpost), Pendelverkehr mit nur einem Wagen; 1873 geschlossen und 1912 im Zuge des Baus der BMT Broadway Line abgebrochen. | |
| London | Tower Subway | 2. August 1870 | nein | erste in bergmännischer Bauweise gebaute Untergrundbahn, Kabelantrieb, Pendelverkehr mit nur einem Wagen unter der Themse hindurch; bereits am 24. Dezember desselben Jahres stillgelegt. | |
| New York City und Brooklyn | 24. September 1883 | ja | Hochbahn über die Brooklyn Bridge; Kabelantrieb, 1896 elektrifiziert und von der Brooklyn Rapid Transit (BRT) übernommen. | ||
| Brooklyn, heute New York City |
Brooklyn Rapid Transit | 13. Mai 1885 | nein | erste Hochbahn in Brooklyn, verlief von der Brooklyn Bridge entlang der Lexington Avenue zum Brooklyner Broadway; Dampfbetrieb. | |
| London | City and South London Railway | 4. November 1890 | ja | erste elektrisch betriebene U-Bahn der Welt, erster Streckenabschnitt von King William Street (1900 stillgelegt) bis Stockwell; bergmännische Bauweise (tube), Unterfahrung der Themse. | |
| Chicago | Chicago and South Side Rapid Transit Railroad | 27. Mai 1892 | ja | anfangs Dampfbetrieb, nach Elektrifizierung 1896 erste elektrische Hochbahn außerhalb Europas und zweite weltweit. Die Strecke verlief von der Congress Street zur 39. Straße südlich des Zentrums. Heute Teil des Südasts der Green Line. 1893, 1895 und´1900 nahmen drei weitere Hochbahngesellschaften den Betrieb auf. 1897 wurde mit der Union Loop und gemeinsame Ringstrecke im Stadtzentrum eröffnet. | |
| Liverpool | Liverpool Overhead Railway | 4. Februar 1893 | ja | Die erste elektrische Hochbahn der Welt verlief auf einer rund 10 Kilometer langen Strecke mit 14 Stationen durch das Liverpooler Hafengebiet zwischen Innenstadt und Mersey. Bei späteren Erweiterungen entstand ein Tunnelbahnhof. Das Netz wurde am 30. Dezember 1956 stillgelegt und die Anlagen danach abgebrochen. | |
| Budapest | Millenniumi Földalatti Vasút | 2. Mai 1896 | ja | Erste U-Bahn Kontinentaleuropas, erbaut anlässlich des 1000. Geburtstags Ungarns, gelegen unter der zum gleichen Anlass geplanten Prachtstraße Andrássy út. Die Strecke war 3,7 Kilometer lang und umfasste neun Stationen. Heute Linie M1 der Metró Budapest. | |
| Glasgow | Glasgow District Subway | 14. Dezember 1896 | ja | 10,5 Kilometer lange Ringstrecke mit 14 Stationen; zunächst Kabelbetrieb, elektrischer Betrieb ab 1935; 1977–1980 wegen Umbau komplett außer Betrieb; wurde nach der Erstinbetriebnahme nie erweitert. | |
| Boston | Tremont Street Subway | 1. September 1897 | ja | erste unterirdische Bahnstrecke außerhalb Europas, Straßenbahntunnel mit drei Stationen. Von 1901 bis 1908 auch von Zügen der späteren Orange Line der Boston Subway genutzt, heute Teil der Stammstrecke der Green Line. | |
| Wien | Wiener Stadtbahn | 1. Juni 1898 | ja | Das in den Jahren 1898 bis 1901 in Betrieb genommene engere Netz war 37,9 Kilometer lang und verlief vor allem entlang des Gürtels als Hochbahn auf einer Viaduktstrecke, entlang der Wien im offenen Einschnitt und in Tunneln; Dampfbetrieb, Elektrifizierung 1925; heute Teil der Linien U4 und U6 der Wiener U-Bahn. | |
| Paris | Métropolitain de Paris | 19. Juli 1900 | ja | Die erste Strecke der Métro Paris verlief von der Porte de Vincennes in Ost-West-Richtung durch die Stadt zur Porte Maillot und ist heute Teil der Linie 1. Da die Planung von Anfang an durch die Stadtverwaltung und nicht durch konkurrierende Privatunternehmen erfolgte, entstand von Beginn an ein sinnvoll zusammenhängendes Netz. | |
| Boston | Main Line Elevated | 10. Juni 1901 | ja | Vier Jahre nach dem Straßenbahntunnel erhielt Boston eine U-Bahn. Sie verlief weitgehend als Hochbahn und nutzte im Zentrum zunächst den Tramtunnel, wurde 1908 jedoch in den parallelen Washington Street Tunnel verlegt; heute Teil der Orange Line. | |
| Berlin und Charlottenburg | Elektrische Hoch- und Untergrundbahn | 15. Februar 1902 | ja | Die ersten U-Bahnen in Deutschland verliefen in Berlin und der damals selbstständigen Nachbarstadt Charlottenburg auf Viadukten. Nur die Station Potsdamer Platz und die drei Haltestellen in Charlottenburg lagen im Tunnel. | |
| New York City | Interborough Rapid Transit | 28. Oktober 1904 | ja | Erste Tunnelstrecke der New Yorker U-Bahn, Grundlage der späteren Subway. Die 14,5 Kilometer lange Strecke verlief vom Rathaus zur 145. Straße in Harlem. | |
| Philadelphia | Philadelphia Rapid Transit Company (PRT) | 4. März 1907 | ja | Hochbahn entlang der Market Street, zwischen der 22. Straße am Ufer des Schuylkill und der 2. Straße am Ufer des Delaware Streckenführung im Tunnel. Zwischen 22. Straße und Rathaus viergleisiger Tunnel mit kombiniertem Straßenbahnbetrieb auf den außenliegenden Kreise; heute Teil der Market–Frankford Line. | |
| New York City, Hoboken und Jersey City | Hudson and Manhattan Railroad | 26. Februar 1908 | ja | Untergrundbahn zwischen Manhattan und New Jersey. Kernstück war ein Tunnel auf dem Grund des Hudson River, 1909 folgte ein zweiter Tunnel unter dem Fluss. Der Betrieb ging 1962 an die Hafenbehörde über, die auf dem Grundstück des innerstädtischen Endbahnhofs das World Trade Center errichten ließ. | |
| Schöneberg, heute Berlin |
Städtische Untergrundbahn | 1. Dezember 1910 | ja | Schöneberg bei Berlin eröffnete 1910 die zweite U-Bahn in Deutschland und die erste kommunal betriebene U-Bahn. Die Strecke war rund 3 Kilometer lang, verfügte über fünf Stationen und verlief vollständig im Tunnel; heute als U4 ins Netz der Berliner U-Bahn integriert. | |
| Hamburg | Hamburger Hochbahn | 15. Februar 1912 | ja | Ringstrecke rund um die Alsterseen mit drei Streckenästen, Führung in Tunnel-, Viadukt- und Dammlage. Der erste Abschnitt verlief von Rathaus über Berliner Tor nach Barmbek. Entsprach im Wesentlichen der heutigen Linie U3 der Hamburger U-Bahn. | |
| Deutsch-Wilmersdorf und Königliche Domäne Dahlem, heute Berlin | Untergrundbahn Wilmersdorf | 12. Oktober 1913 | ja | Die Untergrundbahn der damals selbstständigen Stadt Wilmersdorf war rund 9 Kilometer lang und umfasste zehn Stationen. Sie führte vom Charlottenburger U-Bahnhof Wittenbergplatz bis Thielplatz (heute: Freie Universität (Thielplatz)). Die Strecke wurde in weiten Abschnitten als Einschnittsbahn ausgeführt und ist heute Teil der Linie U3 der Berliner U-Bahn. | |
| Buenos Aires | Subte | 1. Dezember 1913 | ja | Erste U-Bahn auf der Südhalbkugel und in der spanischsprachigen Welt; die erste Strecke führte von der Plaza de Mayo bis Plaza Miserere; heute Teil der Linie A. |
Übersicht Inbetriebnahmen nach Jahrzehnten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Anzahl der neuen U-Bahn-Netze pro Jahrzehnt:[2][65][67]

Technik und Infrastruktur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Auf technisch-betrieblicher Ebene ist das Verkehrsmittel U-Bahn ein komplexes System, das entlang einer Vielzahl unterschiedlicher Parameter variiert werden kann, sodass die einzelnen auf der Welt betriebenen Netze deutliche Unterschiede zueinander aufweisen.
Es gibt sowohl Systeme, in denen alle Strecken nach einheitlichen Spezifikationen entworfen sind und in denen alle Fahrzeuge grundsätzlich freizügig im gesamten Netz eingesetzt werden können (z. B. Montreal, München, Oslo, Stockholm), als auch Systeme, in denen die einzelnen Strecken nach unterschiedlichen Standards ausgebaut sind und sich beispielsweise in Hinblick auf das Lichtraumprofil der Fahrzeuge (z. B. Berlin, London, Madrid, New York), die Spurweite (z. B. Barcelona, São Paulo, Tokio), Kurvenradien und die hiermit mögliche Länge der Einzelwagen (z. B. Boston, New York), die Bahnsteig- bzw. maximale Fahrzeuglänge (z. B. Hamburg, Madrid, Vancouver), die manuelle oder (teil)automatische Betriebssteuerung (z. B. Mailand, Paris, Rom, Nürnberg) oder die Stromversorgung über Stromschiene oder Oberleitung (z. B. Mailand, São Paulo, Tokio) und die verwendete Betriebsspannung oder Polarität unterscheiden und die daher aus mehreren betrieblich und technisch nicht oder nur eingeschränkt kompatiblen Teilnetzen bestehen.
Gründe für derartige Unterschiede innerhalb desselben Systems umfassen beispielsweise die Umsetzung neuerer technischer Entwicklungen und Standards, die Korrektur älterer Spezifikationen, die im Nachhinein als unzulänglich oder nachteilig beurteilt werden wie zu geringe Bahnsteiglängen und Fahrzeuge mit zu geringer Kapazität, die Reduzierung der Baukosten durch günstigere Bauverfahren (z. B. Ōedo Line in Tokio) oder vereinfachte und reduzierte Ausbaustandards (z. B. auf den Außenstrecken der Linien 7, 9 und 12 in Madrid),[65] die bewusste Differenzierung der Beförderungskapazitäten der einzelnen Linien (z. B. Wenhu Line in Taipeh, historisch Scarborough Line in Toronto), die Vereinigung mehrerer zuvor unabhängiger Netze (z. B. London, New York) bzw. die Integration bestehender Strecken anderer Bahnen (z. B. Linie C in Lyon) oder die Ermöglichung des wechselseitigen Betriebs mit Strecken, die nach anderen Standards ausgebaut sind (z. B. Linie L1 in Barcelona (wechselseitiger Betrieb nicht umgesetzt),[65] Mita Line und Shinjuku Line in Tokio).
Die nachträgliche Änderung von Parametern auf bestehenden Strecken kann mit erheblichem baulichem, zeitlichem und finanziellem Aufwand verbunden sein, weshalb aus Perspektive der Betreiber im Allgemeinen eine ausgeprägte Pfadabhängigkeit oder zumindest die ausgeprägte Tendenz besteht, die für eine Strecke einmal gewählten Standards dauerhaft fortzuführen. Gleichwohl gibt es eine Vielzahl von Beispielen für Anpassungen bestimmter technischer Aspekte auf bestehenden Linien, insbesondere für die vergleichsweise einfache Umstellung der Stromversorgung von Stromschiene zu Oberleitung bzw. umgekehrt, jedoch auch für die nachträgliche Verlängerung von Bahnsteigen, um den Einsatz längerer Züge zu ermöglichen (z. B. Hamburg, Lissabon, Toulouse).[149][64]
Vorteile technisch homogener Systeme können beispielsweise der flexible Einsatz von Fahrzeugen im gesamten Netz, die Möglichkeit zur Nutzung derselben Betriebswerkstätten und anderer Infrastruktur durch alle Fahrzeuge und Skalenvorteile bei der Beschaffung von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen sein.
Trasse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Streckenführung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-
Streckentunnel der Metro Moskau
-
Oberirdische Strecke der London Underground
-
Verkehrswegebündelung mit
U-Bahn (BART) in Mittellage zwischen den Richtungsfahrbahnen einer Autobahn (Interstate 580) -
U-Bahn-Strecke auf der unteren Ebene der Manhattan Bridge, New York
-
Oberirdischer Tubus der Metro Prag
Das wesentliche Kriterium der Trassierung ist die vollständige Unabhängigkeit von anderen Verkehrsarten, was auch den Ausschluss von Bahnübergängen umfasst. Ebenso dürfen – nach aktuellen Anforderungen – die verschiedenen Streckengleise einer U-Bahn-Strecke einander nicht höhengleich kreuzen, sondern müssen durch Überwerfungsbauwerke höhenfrei entflochten werden.[5] Innerhalb dieser Maßgabe können U-Bahn-Strecken im Tunnel, im Einschnitt, auf Dämmen, als Hochbahn auf Viadukten oder zu ebener Erde angelegt werden, wobei die Unabhängigkeit in letzterem Falle durch die Einzäunung der Trasse gesichert wird. Zentraler Vorteil der strikten Trennung ist die Erhöhung der Betriebssicherheit und -stabilität durch Ausschluss und Reduzierung potenzieller Störungs- und Unfallquellen wie blockierten Gleisen in Folge von Verkehrsstaus oder liegengebliebenen Kraftfahrzeugen. Ebenso wird die Gefahr von Kollisionen mit Kraftfahrzeugen, Personen und kreuzenden Zügen ausgeschlossen.
Der Anteil der verschiedenen Streckenführungen unterscheidet sich zwischen den einzelnen Netzen. Während in den frühesten europäischen U-Bahn-Städten London und Paris die ersten Strecken von Beginn an zu großen Teilen in Tunneln angelegt wurden, favorisierten andere frühe Betriebe eine Führung als Hochbahn, was insbesondere an den zu diesem Zeitpunkt noch begrenzten ingenieurtechnischen Erfahrungen beim Bau von Verkehrstunneln, den deutlich geringeren Herstellungskosten von Viadukt- gegenüber Tunnelstrecken und dem Betrieb einiger der frühesten Strecken mit Dampflokomotiven lag, die sich für Tunnelstrecken nur bedingt eigneten und von denen U-Bahn-Betreiber bereits im frühen 20. Jahrhundert Abstand nahmen (siehe auch hier). Eine wesentliche ingenieurtechnische Herausforderung vor allem beim frühen Tunnelbau war der statische Auftrieb des hohlen, luftgefüllten Tunnels in grundwasserführenden und grundwassernahen Bodenschichten, weiterhin bestand bzw. besteht die Gefahr von Setzungen von Straßen und Gebäuden. In felsigem Untergrund, wie z. B. in Stockholm, ist der Tunnelbau hingegen vergleichsweise einfach zu realisieren. Mit reifendem technischem Wissen wurden jedoch auch in Städten mit hohem Grundwasserstand bzw. insgesamt anspruchsvollem Untergrund vermehrt Tunnelstrecken angelegt.
Tendenziell werden Tunnelstrecken vorrangig in verdichteten Siedlungsbereichen, insbesondere in Innenstädten, angelegt, in denen eine Trassierung im Einschnitt, zu ebener Erde oder in Höhenlage vielfach nur unter erheblichen Eingriffen in bestehende bauliche Substanz, in Frei- und Grünraumstrukturen oder in Straßenquerschnitte möglich wäre, als Belastung des städtebaulichen Bildes betrachtet würde und/oder Konflikte in Hinblick auf die Lärmbelastung des Trassenumfeldes auslöste, die durch die unterirdische Streckenführung ebenfalls ausgeschlossen werden können. Außerhalb der Zentren werden Strecken hingegen vielfach oberirdisch bzw. außerhalb von Tunneln geführt.
Spurweiten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Mehrheit der U-Bahn-Systeme verwendet die im jeweiligen Land bei den Eisenbahn-Vollbahnen übliche Spurweite, das heißt im Großteil Europas, in Nordamerika, Nordafrika, Vorderasien und China die Normalspur (1435 mm) und in den ehemals vom Kaiserreich Russland beherrschten Staaten die Russische Breitspur (1520 bis 1524 mm).
Darüber hinaus ist die Normalspur auch in Netzen von Ländern verbreitet, die ansonsten andere Spurweiten verwenden. Beispielsweise nutzen weder Lissabon noch die spanischen Netze die in Portugal und Spanien übliche Iberische Breitspur (1668 mm), sondern mehrheitlich ebenfalls Normalspur sowie in einigen spanischen Netzen Meterspur. Barcelona nutzt mit Meterspur, Normalspur und dem alten spanischen Maß von 1674 mm insgesamt drei Spurweiten, Madrid zudem ausschließlich die seltene Weite von 1445 mm. Die japanischen Systeme verwenden sowohl die aus dem regulären Eisenbahnnetz stammende Kapspur (1067 mm) als auch Normalspur, die in Japan erstmals 1927 bei der späteren Ginza Line der U-Bahn Tokio realisiert und bei der Eisenbahn erst mit dem Bau des Shinkansen-Hochgeschwindigkeitsnetzes eingeführt wurde. Die Tokioter Toei verwendet neben Kap- und Normalspur zusätzlich die Schottische Spur (1372 mm). Die Systeme auf dem indischen Subkontinent verwenden ebenfalls mehrheitlich Normalspur, lediglich Delhi und Kolkata haben auch in Indischer Breitspur trassierte (1676 mm) Strecken.
Demgegenüber gibt es in den Regionen, die ansonsten Normal- oder Russische Breitspur verwenden, wenige Systeme mit abweichenden Spurweiten. Zu den wenigen Beispielen gehören das System der San Francisco Bay Area mit Indischer Breitspur, die Market–Frankford Line in Philadelphia mit Pennsylvania-Spur (1581 mm) und die Glasgow Subway mit der Englischen 4-Fuß-Spur (1219 mm).
Ein Vorteil der Verwendung der national üblichen Spurweite ist die Möglichkeit zur Überführung der Fahrzeuge über das Eisenbahnnetz, wobei sie mitunter in reguläre Güterzüge eingestellt werden.
Ein- und Mehrgleisigkeit
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
U-Bahn-Strecken sind grundsätzlich zweigleisig ausgebaut mit separaten Streckengleisen für beide Fahrtrichtungen, um eine hohe Taktdichte zu ermöglichen und Redundanzen für den Fall des Ausfalls eines Gleises zu schaffen. Strecken, auf denen zusätzliche Expressverbindungen angeboten werden (siehe hier), sind häufig drei- bis viergleisig ausgebaut, um schnellere und langsamere Züge voneinander trennen bzw. aneinander vorbeileiten zu können.
Einzelne Netze verfügen über eingleisige bzw. nur in eine Fahrtrichtung bediente Streckenabschnitte, hierzu gehören beispielsweise:
- Hamburg: Der durch vorstädtisch bis ländlich geprägte Gebiete führende nordöstliche Ast der U1 ist zwischen Buchenkamp und dem östlichen Linienendpunkt Großhansdorf auf der zweigleisig angelegten Trasse nur eingleisig ausgebaut, allerdings verfügen zwei der vier Zwischenstationen und die Endstation über zwei Gleise, sodass sich auf dem Abschnitt Züge begegnen können.
- London: Die Piccadilly Line verfügt an ihrem südwestlichen Ende westlich der Station Hatton Cross am Flughafen Heathrow über zwei Streckenäste; während der nördliche Ast zweigleisig über die Station Heathrow Terminals 2 & 3 die Endstation Heathrow Terminal 5 erreicht, befährt der südliche Ast ab Hatton Cross eine eingleisige Schleife mit der Station Heathrow Terminal 4, die anschließend auf das in Richtung Innenstadt führende Gleis des Nordastes einfädelt und dort auch die Station Heathrow Terminals 2 & 3 bedient.
- New York: Die ältesten Strecken der New Yorker U-Bahn verfügten über eingleisige Wendeschleifen an den Streckenenden, beispielsweise an der Station City Hall im Süden von Manhattan. Diese Schleife wird nach wie vor von Zügen der Linien 6 und <6> durchfahren, die an der Station Brooklyn Bridge–City Hall enden bzw. dort nach Durchfahren der Schleife erneut beginnen.
- Nürnberg: Der gut zwei Kilometer lange nördliche Abschnitt der U2 zwischen Ziegelstein und Flughafen wurde aus Kostengründen nur eingleisig gebaut, wodurch die Taktdichte hier auf maximal 10 Minuten beschränkt wird. Die Endstation am Flughafen ist jedoch zweigleisig und die Trasse ist für einen späteren zweigleisigen Ausbau ausgelegt.
- Paris:
- Die älteren Strecken der Pariser Métro wurden durchgehend mit Wendeschleifen an den Streckenenden angelegt, die zu großen Teilen bis heute genutzt werden. Die östlich der Station Botzaris gelegene Wendeschleife der Linie 7bis, die Boucle de Pré-Saint-Gervais, beispielsweise wird ausschließlich gegen den Uhrzeigersinn befahren und bedient dabei die drei Stationen Place de Fêtes, Pré-Saint-Gervais und Danube, bevor sie wieder zu Botzaris zurückgelangt.
- Die Linie 10 teilt sich zwischen Mirabeau und Boulogne – Jean Jaurès in zwei getrennte, teilweise eingleisige Strecken auf, deren drei nördliche Stationen nur stadtauswärts und deren drei südliche Stationen (einschließlich Mirabeau) nur stadteinwärts bedient werden.
- Peking: Der nordöstliche Streckenteil des Capital Airport Express erschließt den Hauptstadtflughafen in der Art eines Gleisdreiecks; die aus Richtung Innenstadt kommenden Züge erreichen zuerst die Station am Terminal 3, wenden dort durch Kopfmachen, fahren zur Station am Terminal 2, wenden dort erneut und fahren dann zurück in die Innenstadt.
Sicherheit in Tunnelstrecken
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-
Enge Tunnelprofile können ein Risiko für die Evakuierung darstellen; das hier gezeigte Fahrzeug der London Underground kann im Notfall durch den Führerstand verlassen werden
-
Streckentunnel der Metropolitana di Brescia mit außenliegenden Wartungs- und Rettungsstegen
Die Evakuierung von Zügen auf Tunnelstrecken kann aufgrund des beschränkten Lichtraumprofils ein besonderes Risikofeld darstellen, insbesondere bei gleichzeitiger Rauchentwicklung infolge eines Brandes von Betriebseinrichtungen. Dies trifft in besonderer Weise auf Tunnel älterer Netze mit ihren häufig sehr schmalen Profilen zu, beispielsweise auf die Röhrentunnel der deep-tube-Linien in London, in denen ein Verlassen eines Zuges über die regulären Fahrgasttüren nicht möglich ist. Die Evakuierung erfolgt in solchen Fällen häufig über (Not-)Übergangstüren zwischen den Wagen und Stirntüren an Front bzw. Heck der Züge.
Moderne Streckentunnel sind jedoch so dimensioniert, dass sie über ausreichenden Raum für einen sicher zugänglichen und nutzbaren Fluchtweg verfügen, und mit zusätzlichen Notausgängen ausgestattet.
Gleichzeitig stellt das Betreten von Tunnelanlagen durch betriebsfremde Personen eine Gefahr für deren Leben und die Betriebssicherheit dar. Vor diesem Hintergrund werden Tunnelzugänge, z. B. am Ende der Bahnsteige, häufig videoüberwacht und/oder sind mit Lichtschranken oder alarmgesicherten Türen ausgestattet. Auf Strecken mit Bahnsteigtüren entfällt dieses Problem, da diese auch den Tunnelzugang vom Bahnsteig trennen.
Für Deutschland sind bezüglich Rettungswegen in Tunneln die Regelungen des § 30 BOStrab einschlägig;
„Im Tunnel müssen ins Freie führende Notausstiege vorhanden und so angelegt sein, dass der Rettungsweg bis zum nächsten Bahnsteig, Notausstieg oder bis zur Tunnelmündung jeweils nicht mehr als 300 m lang ist. Notausstiege müssen auch an Tunnelenden vorhanden sein, wenn der nächste Notausstieg oder der nächste Bahnsteig mehr als 100 m entfernt ist.“
Stromversorgung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-
Von oben bestrichene Stromschiene mit Schutzabdeckung im Depot Nakano der Marunouchi Line, Tokio
-
U-Bahn unter Oberleitung auf der Linie M2 der Metropolitana di Milano
Die Energieversorgung erfolgt bei der Mehrheit der U-Bahn-Systeme durch eine neben oder zwischen den Schienen angeordnete Stromschiene. Einzelne Netze wie das der London Underground verwenden ein System mit einer mittigen und einer seitlichen Stromschiene, um Streustromkorrosion in den metallischen Installationen zu verhindern. Einige Netze, etwa in Spanien und Italien, beziehen ihren Fahrstrom über konventionelle Oberleitung.
Historisch lag ein wesentlicher Vorteil von Stromschienen in ihrer im Vergleich zu Oberleitung und Dachstromabnehmer kompakteren Bauweise und der hiermit eröffneten Möglichkeit zur Reduzierung des Tunnelprofils. Infolge der Entwicklung von Deckenstromschienen konnte jedoch auch bei Systemen mit Versorgung über Dachstromabnehmer eine bedeutende Reduzierung des Profils erreicht werden.
Bei Stromschienen am weitesten verbreitet ist die Bestreichung von unten, jedoch gibt es auch Systeme mit seitlich und von oben (u. a. Kleinprofillinien in Berlin, London, jüngere Linien in Budapest, zahlreiche japanische Netze) bestrichener Schiene. Gerade letztere stellen jedoch aufgrund der Möglichkeit zum Auftreten auf die stromführende Schiene ein größeres Sicherheitsrisiko für Betriebspersonal sowie betriebsfremde Personen im Gleisbereich dar. Ein weiterer Nachteil ist die Möglichkeit des Vereisens der Stromschiene bei Schneefall oder gefrierendem Regen, sodass kein Kontakt mehr zwischen Schiene und Stromabnehmer besteht. U. a. in Budapest und Tokio verfügen die Stromschienen daher über entsprechende Schutzabdeckungen bzw. Einfassungen. In einzelnen Netzen (z. B. Nürnberg) verfügen Züge über zusätzliche Dachstromabnehmer, die etwa bei Werkstattfahrten eingesetzt werden, sodass auf Gleis- und Radhöhe keine Stromschiene erforderlich ist.
Bei der Betriebsspannung hat sich, unabhängig von der Zuführung über Stromschiene oder Oberleitung, ein Bereich von 600 bis 900 Volt Gleichspannung etabliert. So verwenden alle U-Bahnen im deutschsprachigen Raum eine Spannung von 750 Volt, während in den Städten der früheren Sowjetunion 825 Volt genutzt werden. Wechselspannung wird nur vereinzelt verwendet, beispielsweise bei verschiedenen indischen Systemen (z. B. Mumbai mit 25 kV 50 Hz über Oberleitung).[150][151][152]
Fahrbetriebsmittel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Allgemeine Merkmale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-
Drei-Wagen-Zug der Liverpool Overhead Railway
(Indienststellung etwa 1896) -
Elektrolokomotive der Metropolitan Railway
(Indienststellung 1921) -
Innenraum eines durchgängigen Zuges des Typs DT5 der U-Bahn Hamburg mit gemischter Sitzkonfiguration
-
Innenraum eines durchgängigen Zuges der Baureihe 2000 der U-Bahn Fukuoka mit Mehrzweckfläche für Rollstühle und Kinderwagen und priority seats
Während die Metropolitan Railway, die City and South London Railway und die frühen Hochbahnen in New York und Chicago anfangs konventionell gebildete Züge aus Lokomotiven und Reisezugwagen nutzten, entwickelte sich später ein eigener, an die spezifische Betriebsweise des Verkehrssystems U-Bahn angepasster Fahrzeug-Typus. Charakteristisch für moderne U-Bahn-Fahrzeuge sind insbesondere folgende Merkmale:[46]
- Triebwagen/Triebzüge: U-Bahn-Systeme verwenden Triebwagen und Triebzüge. Zentrale Vorteile gegenüber lokbespannten Zügen sind die Verteilung der Antriebsausrüstung auf den gesamten Zug, wodurch eine höhere Beschleunigung und Bremsverzögerung (s. u.) und eine gleichmäßigere Verteilung der Achslast erreicht werden. Zudem können Tunnelstationen durch den Verzicht auf eine separate Lokomotive bei gleichem Platzangebot kompakter und somit kostengünstiger gebaut werden. Als erste elektrisch betriebene U-Bahn setzte die 1893 eröffnete Liverpool Overhead Railway Triebwagen ein, deren Prinzip danach auch bei allen anderen U-Bahn-Systemen verwendet wurde.
Nachdem zur Erhöhung der Beförderungskapazität anfangs einzelne Triebwagen zu Mehrfachtraktionen gekoppelt wurden, wobei in der Mitte eines Zuges teilweise nicht angetriebene Beiwagen und geführte Triebwagen ohne eigene Führerstände eingesetzt wurden, entwickelten sich später der Typus des zwei- und mehrteiligen Doppeltriebwagens aus fest miteinander verbundenen Wagen und zuletzt die heute weit verbreiteten Triebzüge. Hiermit verbunden war vielfach auch der Übergang von separaten Einzelwagen zu vollständig durchgängigen Fahrzeugen, die u. a. eine gleichmäßigere Auslastung ermöglichen. Sowohl Doppeltriebwagen als auch Triebzüge verwenden teilweise Jakobs-Drehgestelle, bei denen sich benachbarte Wagen auf ein gemeinsames Drehgestell stützen. Vorteile dieser Bauweise sind die Reduzierung des Fahrzeuggewichts, da Drehgestelle zu den besonders schweren Bauteilen eines Zuges gehören, und die Erhöhung der Laufruhe. - Beschleunigung und Bremsen: Um eine hohe Reisegeschwindigkeit trotz der im Durchschnitt kürzeren Haltestellenabständen zu ermöglichen, verfügen U-Bahn-Züge über eine hohe Beschleunigung und Bremsverzögerung, sodass die vorgesehene Fahrtgeschwindigkeit schnell erreicht und das Fahrzeug schnell zum Stillstand gebracht werden kann.
- Türen und Türräume: Um einen schnellen Wechsel großer Mengen von Fahrgästen zu ermöglichen, verfügen U-Bahn-Wagen über eine größere Anzahl von Türen – meist Doppeltüren – entlang des gesamten Zuges sowie großzügig dimensionierte Aufstell- und Auffangfläche im Türbereich für aus- und einsteigende Fahrgäste.
- Innenraumgestaltung: Die Organisation des Innenraums soll die Beförderung einer möglichst großen Zahl von Fahrgästen bei gleichzeitig möglichst hohem Komfort ermöglichen bzw. muss zwischen diesen beiden Ansprüchen vermitteln, wobei häufig auch die spezifischen Bedürfnisse einzelner Fahrgastgruppen (z. B. ältere Menschen, Rollstuhlfahrer, Personen mit Kinderwagen, Schwangere) berücksichtigt werden. Die Innenraumgestaltung betrifft neben den oben genannten Aufstell- und Auffangflächen insbesondere die Anordnung der Sitze und das Verhältnis von Sitz- zu Stehplätzen. Senkrecht zur Mittelachse des Wagens angeordnete Quersitze sind aufgrund des höheren Fahrkomforts vorrangig für längere Fahrten gedacht, während parallel zur Mittelachse angeordnete Längssitze vorrangig für kürzere Strecken vorgesehen sind. Längssitze ermöglichen dabei aufgrund ihres geringeren Flächenbedarfs eine Erhöhung der Fläche für Stehplätze und somit der (theoretischen) Gesamtkapazität des Fahrzeugs. In älteren Netzen werden Längssitze zudem aufgrund der häufig geringeren Fahrzeugbreiten teilweise ebenfalls bevorzugt. Teilweise werden gemischte Sitzkonfigurationen für unterschiedliche Fahrgastgruppen und Reiselängen gewählt. Bei neueren Fahrzeugen werden zudem häufig Mehrzweckflächen für Rollstühle, Rollatoren, Kinderwagen, Gepäckstücke sowie die Fahrradmitnahme berücksichtigt. Hinzu kommen teilweise Sitzplätze, die vorrangig für Senioren, Schwangere und Fahrgäste mit Kindern vorgesehen sind und beispielsweise durch andersfarbige Bezüge gekennzeichnet sind. Mehrzweckflächen und Sitze für die genannten besonderen Fahrgastgruppen befinden sich üblicherweise in unmittelbarer Nähe zu den Türen, um einen schnellen Zu- und Abgang zu ermöglichen.
- Zweirichtungsbetrieb: Um das Wenden zu beschleunigen und auf aufwendige und flächenintensive Kehranlagen (Wendeschleifen, Gleisdreiecke) verzichten zu können, sind U-Bahnen in aller Regel für den Zweirichtungsbetrieb ausgelegt und verfügen daher über Türen auf beiden Fahrzeugseiten und entweder Führerstände an beiden Fahrzeugenden oder die Möglichkeit zur Kopplung von Einzelfahrzeugen mit einem Führerstand an jeweils nur einem Ende. In den allermeisten Netzen erfolgt das Wenden entsprechend am Bahnsteig oder in hinter der Station gelegenen Wendeanlagen, die häufig als Bauvorleistung für einen späteren Weiterbau der Strecke angelegt sind. Die Métro Paris gehört zu den wenigen Systemen, in denen ein Großteil der Strecken über Wendeschleifen verfügt und in denen diese bis heute genutzt werden, die New York City Subway verfügt teilweise ebenfalls über solche Schleifen.
- Steuerung/Zugbildung: Sofern die Bildung von Mehrfachtraktionen vorgesehen ist, um beispielsweise das Platzangebot an eine im Tagesverlauf schwankende Nachfrage anzupassen, müssen Fahrzeuge im Verband eingesetzt werden können und über entsprechende Steuerungstechnik verfügen.
Die genannten Merkmale beschränken sich gleichwohl nicht auf U-Bahn-Fahrzeuge, sondern finden sich vielfach auch bei Eisenbahnfahrzeugen (beispielsweise bei den teilweise U-Bahn-ähnlich betriebenen S-Bahnen) und bei Straßen- und Stadtbahnen.
- Niederflurfahrzeuge
-
Wagen der ersten Generation der Budapester Földalatti
Der absolut überwiegende Teil der U-Bahn-Netze setzte und setzt hochflurige Fahrzeuge ein, die entsprechend angepasste Hochbahnsteige bedienen und einen stufenlosen Zugang ermöglichen bzw. bei denen nur ein geringer Höhenunterschied zu überwinden ist. Die hochflurige Ausführung ist technisch damit begründet, dass die elektrischen Fahrmotoren direkt mit den angetriebenen Achsen verbunden sind und daher unterhalb des Fahrzeugs angeordnet werden müssen. Gleichzeitig ergibt sich hieraus der Vorteil, dass die technischen Einbauten vollständig im Unterbodenbereich angeordnet werden können und der Fahrgastraum davon freigehalten werden kann. Der resultierende niedrige Schwerpunkt ist ebenfalls größtenteils vorteilhaft. Zudem unterstützt der komfortable Einstieg die im U-Bahn-Betrieb erwünschten kurzen Fahrgastwechselzeiten.
Einzelne Netze verwenden Niederflurfahrzeuge, die auch bei der Straßenbahn eingesetzt werden bzw. ursprünglich für diese entworfen wurden. Ein jüngeres niederfluriges System findet sich in Sevilla (Eröffnung: 2009), wo Fahrzeuge des Typs Urbos 2 des spanischen Herstellers CAF eingesetzt wurden, die bis zur Einführung des neueren Typs Urbos 3 auch bei der Straßenbahn Sevilla eingesetzt wurden, ebenso wird die Confederation Line des O-Train-Systems der kanadischen Hauptstadt Ottawa (Eröffnung: 2019) mit Fahrzeugen des Typs Citadis der französischen Alstom-Gruppe betrieben. Die Linie U6 der Wiener U-Bahn wird seit ihrer Einrichtung mit straßenbahnartigen Fahrzeugen bedient, unter anderem weil diese die Hauptwerkstätte der Wiener Linien nur über das Straßenbahnnetz erreichen können. Ursprünglich handelte es sich hierbei um die hochflurigen E6-c6-Züge, die in den Jahren 1993 bis 2008 durch Niederflurzüge der Typen T und T1 abgelöst wurden. Auch die Budapester Földalatti, die zweite elektrische U-Bahn der Welt (siehe hier), setzte von Anfang an Wagen mit einer Fußbodenhöhe von 450 mm über Schienenoberkante ein,[46] die nach heutigem Begriffsverständnis als Niederflurfahrzeuge eingeordnet werden können. Grund hierfür war jedoch das sehr niedrige Tunnelprofil, das sich aus der Bauweise als Unterpflasterbahn in einfacher Tiefenlage zum einen und einer Tiefenbeschränkung durch eine die Strecke in einer gegebenen Höhe kreuzende Hauptabwasserleitung zum anderen ergab und das eine Gesamthöhe des Fahrzeugkastens von lediglich 2,6 Metern zuließ.[61]
- Profil des Wagenkastens
-
Innenraum eines 2,08 Meter breiten Fahrzeugs des Typs VAL 208 bei der Métro Toulouse mit 1+1-Querbestuhlung
-
Innenraum eines 3,05 Meter breiten Fahrzeugs der Baureihe R211A der New York City Subway mit Längssitzen
-
Fahrzeug der 2. Generation der Glasgow Subway mit abgeschrägten Seitenwänden zur Anpassung an das Tunnelprofil
-
Fahrzeug der 1. Generation der Metro Bukarest mit hexagonalem Profil
Während die Wagenkästen moderner U-Bahn-Fahrzeuge im Wesentlichen ein rechteckiges Profil haben, musste und muss die Geometrie von Wagen, die in älteren Netzen eingesetzt werden, teilweise an die dort verwendete Bauweise der Streckentunnel und den hierbei jeweils gewählten Querschnitt angepasst werden. Dies geschieht, ähnlich dem Oberdeck bei Doppelstockwagen, durch Abrundung oder Abschrägung des Fensterbands und teilweise auch der Dachpartie. Bei etwas größeren Tunnelprofilen wird, ähnlich wie bei zahlreichen Neigetechnikzügen, alternativ nur das Fensterband abgeschrägt, teilweise auch die Fläche unterhalb des Fensterbands.
Ein ausgeprägtes Beispiel für die Anpassung des Wagenkastens an das Tunnelprofil ist die Glasgow Subway, deren Züge Röhrentunnel mit einem Durchmesser von lediglich 3,4 Metern befahren. Hierdurch ergibt sich ein nach heutigen Maßstäben ungewöhnlich kompaktes Fahrzeug mit einer Breite von lediglich 2,34 Metern und einer lichten Höhe im Innenraum von weniger als 2 Metern sowie markant abgeschrägten Seitenwänden. Vor demselben Hintergrund erklären sich die gewölbten Seitenwände der Fahrzeuge der deep-tube-Linien der London Underground, deren Tunnel jedoch ein größeres Profil haben als diejenigen in Glasgow.[106]
Traktionssysteme
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-
Zug mit Gummireifen der Baureihe MP 89 der Métro Paris; außerhalb der Stahlschienen gut zu erkennen die Fahrprofile für die Reifen
-
Leitschienenbahn auf Gummireifen ohne ergänzende Stahlräder bei der U-Bahn Sapporo
-
Fahrzeug des Typs ITCS Mark I auf der Scarborough Line der Toronto Subway mit Linearantrieb; zwischen den Führungsschienen gut zu erkennen der Stator, an dem sich der Zug entlangzieht
-
Fahrzeug des Typs MCL 80 auf der Zahnradstrecke der Linie C in Lyon; zwischen den Führungsschienen gut zu erkennen die Zahnstange
-
Zug der Baureihe 1000 der Einschienenbahn Tama
Die Mehrzahl der U-Bahn-Systeme verwendet das von der Eisenbahn übernommene Rad-Schiene-System mit angetriebenen Stahlrädern auf Stahlschienen. Daneben wurden im Laufe des 20. Jahrhunderts auch andere Systeme entwickelt bzw. andere Technologien in den U-Bahn-Betrieb eingeführt.
Eine zentrale Innovation, die weitere Verbreitung gefunden hat, ist die in den 1950er Jahren in Frankreich entwickelte Métro sur pneumatiques (dt. U-Bahn auf Reifen), bei der zusätzlich zu konventionellen Stahlrädern gasbefüllte Gummireifen genutzt werden. Diese sind auf denselben Achsen wie die Stahlräder montiert und nutzen neben den regulären Stahlschienen angeordnete flache Profile als Fahrbahn. Ein wesentlicher Vorteil dieses Systems ist das deutlich bessere Beschleunigungs- und Bremsverhalten der Züge aufgrund der höheren Haftreibung der Gummireifen, weshalb diese Traktionsart insbesondere für Strecken mit steileren Steigungen geeignet ist. Zudem ist das ursprüngliche französische System redundant aufgebaut, das heißt die Züge können bei Schäden an den Reifen auch ausschließlich auf den Stahlrädern fahren. Die Technologie wurde erstmals ab 1954 auf einer Versuchsstrecke der Pariser Métro getestet, als erste reguläre Linie wurde 1959 die Linie 11 mit gummibereiften Fahrzeugen ausgestattet. Heute verwenden u. a. fünf Linien der Métro Paris, drei Linien der Métro Lyon, das Netz in Marseille sowie die Systeme in Mexiko-Stadt, Montreal und Santiago de Chile das ursprüngliche französische System. Daneben gibt es andere Systeme, die ebenfalls gummibereifte Fahrzeuge verwenden, jedoch auf Stahlräder verzichten, hierzu gehören z. B. die VAL-Systeme (siehe hier) in Lille und Turin, die Leitschienenbahn in Sapporo und das Astram-System in Hiroshima.
Als weiteres Traktionssystem wird in einzelnen Netzen der Linearantrieb eingesetzt, bei dem das Fahrzeug ebenfalls mit Stahlrädern auf Stahlschienen fährt, der Vortrieb jedoch durch ein Magnetfeld zwischen dem Fahrzeug und einem entlang der Gleisachse installierten Langstator bewirkt wird, das heißt das Fahrzeug zieht und/oder schiebt sich entlang des Stators voran. Vorteile dieser Bauweise sind die geringere Empfindlichkeit gegenüber der Witterung, da der Antrieb anders als bei Systemen mit angetriebenen Rädern nicht von der Haftreibung der Räder auf der Schiene abhängt und daher z. B. auch bei Schneefall, gefrierendem Regen oder bei Herbstlaub auf den Gleisen funktioniert,[153] und die Möglichkeit zur Reduzierung des Profils von Tunnelstrecken, da durch den Verzicht auf konventionelle Fahrmotoren Fahrzeuge mit geringerer Höhe konstruiert werden können. Die erste reguläre U-Bahn-Linie mit Linearantrieb war die Scarborough Line, die von 1985 bis 2023 als Teil der Toronto Subway betrieben wurde. Es folgten u. a. die Expo Line (1986) und die Millennium Line (2002) des Vancouver SkyTrain und weitere Systeme in Japan (z. B. Nagahori-Tsurumi-ryokuchi-Linie in Osaka, Ōedo Line in Tokio) und China.
Einzelne Systeme betreiben Strecken mit Magnetschwebetechnik, darunter die unter dem Markennamen Linimo betriebene Bahn in der Präfektur Aichi, die die erste kommerzielle Anwendung des in den 1970er Jahren von Japan Airlines entwickelten HSST-Systems darstellt, und die Linie S1 der U-Bahn Peking. Die Linimo-Fahrzeuge schweben dabei 8 mm über dem Fahrweg, der Antrieb erfolgt über einen Linearmotor.[68]
Weltweit einzigartig ist der Antrieb der Linie C der Métro Lyon, die aus einer bestehenden Zahnradbahn entwickelt wurde und auf dem südlichen Abschnitt zwischen Hôtel de Ville – Louis Pradel und Croix Rousse weiterhin mit Zahnradantrieb fährt.
Vor allem ist Ost- und Südostasien gibt es eine Reihe von Einschienenbahnen, die als Teil des städtischen Nahverkehrs betrieben werden. Die älteste hiervon ist die 1964 eröffnete Tōkyō Monorail, die den internationalen Flughafen Haneda mit dem Bahnhof Hamamatsuchō im Süden des Tokioter Zentrums im Bezirk Minato verbindet. Gemäß der Definition des UITP (siehe hier) sind lediglich Sattelbahnen, das heißt Einschienenbahnen, die auf einem Fahrbalken fahren, zu den U-Bahnen zu zählen, während Hängebahnen, die unterhalb des Fahrwegs hängen (z. B. Chiba, Kamakura, Wuppertal) nicht hierzu gezählt werden.
Historisch nutzten einzelne der frühen U-Bahnen einen Kabelantrieb, bei dem die Fahrzeuge von einem sich kontinuierlich bewegenden Zugseil zwischen den Fahrgleisen gezogen wurden. Hierzu gehörte beispielsweise die Glasgow Subway, die jedoch 1935 auf elektrischen Antrieb umgestellt wurde.[106]
Steuerung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Zugsteuerung kann entweder ausschließlich manuell durch einen Triebfahrzeugführer oder automatisch, das heißt teilweise oder vollständig durch einen Fahrtrechner, erfolgen. Der Internationale Verband für öffentliches Verkehrswesen (UITP) unterscheidet insgesamt fünf Automatisierungsgrade (engl. Grade of Automation – GoA), die von GoA 0/OS (on-sight train operation; dt. Sichtfahrbetrieb) mit Verzicht auf jegliche Automatisierung bis GoA 4/UTO (unattended train operation; dt. fahrerloser Betrieb) mit ausschließlicher Steuerung durch einen Rechner ohne Einfluss und Anwesenheit von Fahrpersonal an Bord reichen.[154] Gleichwohl verfügen auch im regulären Betrieb fahrerlos gesteuerte Züge über Not-/Hilfsfahrpulte, um das Fahrzeug z. B. bei einem Ausfall des automatischen Systems oder bei Werkstattfahrten manuell steuern zu können.
Die ersten fahrerlosen U-Bahn-Linien im Sinne der Definition des UITP (siehe hier) waren die Port Island Line in Kōbe (Eröffnung 5. Februar 1981), die Linie 1 der Métro Lille (25. April 1983) und die spätere Expo Line des Vancouver SkyTrain (3. Januar 1986). Ende 2020 gab es weltweit in 48 U-Bahn-Netzen Linien, die mit GoA 4/UTO betrieben wurden, dies entspricht rund einem Viertel der zu diesem Zeitpunkt vorhandenen 193 Netze. Die Zahl der fahrerlos betrieben Streckenkilometer zeigt seit Beginn der 2010er Jahre ein konstantes Wachstum und stieg zwischen 2012 und Ende 2020 von 627 auf 1358 Kilometer, was zehn Prozent der in diesem Zeitraum neu in Betrieb genommenen Strecken und acht Prozent der weltweit bestehenden Streckenkilometer (17.221 Kilometer) entspricht.[2] 2023 wurde bereits rund 1700 Kilometer Strecke mit GoA 4/UTO betrieben, die Hälfte davon im asiatisch-pazifischen Raum.[155]
In Europa betreiben u. a. Barcelona, Kopenhagen, Lyon, Mailand und Paris fahrerlose Linien. Als erste Linie in der DACH-Region wurde am 18. September 2007 die Linie M2 der Métro Lausanne in der französischsprachigen Schweiz den Betrieb genommen. Die erste Linie im deutschsprachigen Raum war die U3 in Nürnberg, die am 14. Juni 2008 eröffnet wurde. Die Nürnberger U2 war zudem die erste Linie im deutschsprachigen Raum, die von manuellen auf fahrerlosen Betrieb umgestellt wurde, die Inbetriebnahme erfolgte hier am 2. Januar 2010 (siehe hier). Weltweit erstmalig erfolgte hierbei die Umstellung im laufenden Betrieb, das heißt ohne Unterbrechung während der Umbauphase.
- Ausblick
Der UITP ging 2019 in einem Kurzbericht zum Stand der Automatisierung im U-Bahn-Wesen davon aus, dass der fahrerlose Betrieb bis 2023 neben konventionell betriebenen Linien zum Standard für neu geplante Linien wird. Er hebt in diesem Zusammenhang die erhebliche Beschleunigung des Wachstums fahrerlos betriebener Strecken hervor; während in den 37 Jahren zwischen der Eröffnung der Port Island Line Anfang 1981 und dem Berichtsjahr 2018/2019 weltweit 1026 Streckenkilometer realisiert wurden, wird für den Zehnjahreszeitraum von 2018 bis 2028 eine knappe Vervierfachung auf mehr als 3800 Streckenkilometer erwartet.[156] Guénard, Cabanis und Riou gingen demgegenüber Anfang 2024 davon aus, dass die Zahl von rund 1700 Kilometern im Jahr 2023 bis 2030 auf rund 2930 Kilometer anwachsen wird.[155]
Der UITP geht für die ihm vorgelegten Zahlen davon aus, dass die Hauptquellen des Wachstums Neubauten und Erweiterungen bestehender fahrerloser Strecken sein werden, während auf die Umrüstung bislang nicht fahrerlos betriebener Strecken (u. a. geplant für Linien 1 und 5 in Brüssel, das Gesamtnetz in Marseille, Linie U2 in Wien) nur sieben Prozent entfallen sollen. Weiterhin erwartet der UITP, dass die Automatisierung eine wesentliche Rolle bei den anstehenden Modernisierungen der in den 1970er und 1980er Jahren eröffneten Netze spielen wird. Entsprechend der insgesamt auf Asien konzentrierten Neubauaktivität wird hier der größte Anteil des Wachstums mit der Hälfte aller neu hergestellten Streckenkilometer liegen. In Asien soll 2028 auch die Hälfte aller weltweit fahrerlos betriebenen Linien liegen, gefolgt von Europa (21 Prozent) und dem Mittleren Osten (15 Prozent).[156]
Das umfangreichste Ausbauvorhaben dieser Art in Europa ist der Grand Paris Express in der französischen Hauptstadtregion. Es umfasst den Neubau von rund 200 Kilometern Strecke und 68 Stationen, die sich auf vier neue Linien (15 bis 18) und Verlängerungen der zwei bestehenden Linien 11 und 14 aufteilen. Das Netz der Métro wird sich hiermit bis voraussichtlich 2030 von heute 219,9 auf rund 420 Kilometer Streckenlänge knapp verdoppeln und die London Underground als größtes Netz Westeuropas ablösen.[107] In Österreich befindet sich mit der U5 der Wiener U-Bahn eine fahrerlose Linie in Umsetzung, die Eröffnung ist hier für 2026 vorgesehen.[157] In Deutschland soll die künftige Linie U5 der Hamburger U-Bahn fahrerlos betrieben werden, die Inbetriebnahme soll sukzessive ab 2029 erfolgen.[22]
Sicherheit
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Für den abwehrenden Brandschutz sind U-Bahn-Fahrzeuge meist mit Feuerlöschern ausgestattet, einige Fahrzeuge wie die Baureihen DT4 und DT5 der Hamburger U-Bahn verfügen über eigene Feuerlöschanlagen im Fahrgastraum in Form von Sprinkleranlagen.
Wagenklassen und weitere Unterteilungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-
Paris: Farblich differenzierter
Erste-Klasse-Wagen, 1964 -
Paris: Historische Beschilderung der Halteposition der Wagen der 1. Klasse auf dem Bahnsteig
-
Paris: Klassenkennzeichnung im Innenraum durch römische Zahlen
-
Osaka: Wagen, der während der Hauptverkehrszeiten nur von Frauen benutzt werden darf
-
Berlin: Raucherwagen in abweichender roter Lackierung
U-Bahnen verfügen stark mehrheitlich über eine einheitliche, nicht näher bezeichnete Wagenklasse mit identischer Ausstattung in allen Wagen. Lediglich einzelne Systeme bieten analog zur Eisenbahn zuschlagpflichtige höherwertige Klassen an, die sich durch ein größeres Raumangebot und höheren Sitzkomfort auszeichnen (z. B. Gold Class in Dubai und Gold Club in Doha) beziehungsweise aufgrund der Preisbarriere weniger dicht besetzt sind. In der Vergangenheit wurden auch in Europa teilweise verschiedene Klassen angeboten, so in Hamburg bis 1920, in Berlin bis 1927[46] und in Paris bis 1991. Typisch war hierbei die farbliche Kennzeichnung der Wagenklassen durch die Außenlackierung, um die Auffindbarkeit am Bahnsteig zu erleichtern. Ergänzend hierzu markierten Schilder auf den Bahnsteigen die Halteposition der komfortableren Klasse, beispielsweise in Paris. Während sich die Benennung der Klassen in den beiden genannten deutschen Städten an den damaligen Kategorien bei den deutschen Eisenbahnen orientierten und die komfortablere als 2. Klasse und die einfachere als 3. Klasse bezeichnet wurden – die den heute vornehmlich metaphorisch oder humoristisch verwendeten Polster- und Holzklassen entsprachen –, verwendete Paris bei analogem Komfortniveau eine 1. Klasse und eine 2. Klasse.
Hiervon zu unterscheiden sind die vor allem in Indien, im Nahen Osten und in Ostasien verbreiteten Frauenwagen, deren Benutzung zuschlagsfrei, jedoch Frauen und in der Regel Kindern unabhängig vom Geschlecht vorbehalten ist (siehe hier).
In der Vergangenheit gab es zudem spezielle Raucherwagen oder -abteile, in denen das Rauchen erlaubt war und die zur Unterscheidung von Nichtraucherwagen teilweise andersfarbig lackiert wurden. In Hamburg wurden Raucherwagen 1964 abgeschafft,[158] in West-Berlin 1978, in Ost-Berlin allerdings bereits 1962.[159] Bereits vor Hamburg hatten u. a. die Systeme in Boston, Madrid, Moskau, New York, Paris, Stockholm und Toronto entsprechende Angebote eingestellt. In Hamburg erfolgte die Abschaffung u. a. vor dem Hintergrund der deutlich höheren Reinigungskosten von Raucherwagen, wegen der Unbeliebtheit beim Fahrpersonal aufgrund der schlechten Luftqualität und mit dem Ziel der Steigerung der Beförderungskapazität, da Raucherwagen in der Regel weniger genutzt wurden als Nichtraucherwagen.[158]
Hersteller
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Markt für U-Bahn-Fahrzeuge wird durch ostasiatische und europäische Unternehmen dominiert. Der im Jahr 2022 nach produzierten Einheiten mit weitem Abstand größte Hersteller war CRRC, Ltd. (Volksrepublik China) mit rund 73 Prozent aller in diesem Jahr weltweit produzierten Fahrzeuge, die im Schwerpunkt in die Ausstattung der rapide wachsenden chinesischen Netze flossen. Es folgten Alstom (Frankreich; sechs Prozent), Hyundai Rotem (Südkorea; vier Prozent), Transmashholding (Russland; zwei Prozent) sowie CAF (Spanien), Siemens Mobility (Deutschland) und Stadler Rail (Schweiz) mit jeweils rund einem Prozent der 2022 produzierten Fahrzeuge.[160] Weitere Hersteller sind u. a. Hitachi Transportation Systems, die Kawasaki Railcar Manufacturing Company, Kinki Sharyo und Mitsubishi Heavy Industries (jeweils Japan).[161] Bedeutende frühere Fahrzeugbauer sind u. a. AnsaldoBreda (zuletzt Teil der italienischen Finmeccanica-Gruppe; 2015 durch Hitachi übernommen und liquidiert, Nachfolgeunternehmen ist Hitachi Rail Italia) und Bombardier Transportation (Schienenverkehrssparte von Bombardier, Kanada; 2021 von Alstom übernommen).
Ende 2023 bot der Großteil der genannten Hersteller modular aufgebaute Plattformen für U-Bahn-Fahrzeuge an, die entlang verschiedener Parameter wie Spurweite, Stromsystem, Fahrzeugbreite und -länge, Türanzahl und -aufteilung sowie Design konfiguriert werden können. Hierzu gehören u. a. Innovia, Metropolis und Movia von Alstom (Innovia und Movia ursprünglich als Produkte von Bombardier Transportation), Inneo von CAF (u. a. Baureihe M300 für Helsinki, Baureihe MB 400 für Rom, Fahrzeuge für die Linie M5 in Istanbul),[162] Inspiro von Siemens (u. a. New Tube for London, Baureihe C2 in München, Baureihe MX3000 für Oslo)[163] und METRO von Stadler (u. a. Baureihe IK für Berlin, Baureihe 4300 für Valencia, 3. Fahrzeuggeneration für Glasgow).[164] Daneben wird auch der Entwurf von Fahrzeugen vollständig nach Kundenwunsch angeboten.
Fahrzeuge in Deutschland, Österreich und der Schweiz
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-
Sechsteiliger Triebzug Typ X für den Einsatz auf den Linien U1 bis U4 der U-Bahn Wien
-
Doppeltriebwagen der Baureihe Be 8/8 der Linie M2 der Métro Lausanne
In den vier deutschen Netzen werden mehrteilige, bei den jüngeren Generationen durchgängige Hochflurfahrzeuge eingesetzt. Der Antrieb erfolgt durchgehend über angetriebene Stahlräder auf Stahlschienen, die Stromversorgung über seitliche Stromschiene. Die vielfältigste Flotte wird von der U-Bahn Berlin betrieben, die aktuell über sechs verschiedene Baureihen verfügt. Zwei weitere Baureihen (J und JK) sind bestellt bzw. befinden sich in Auslieferung.[165]
Die Fahrzeuge der U-Bahn Wien entsprechen in den oben genannten technischen Parametern denen der deutschen Systeme mit Ausnahme der Linie U6, auf der straßenbahnartige Niederflurfahrzeuge (aktuell Typen T und T1) eingesetzt werden, die über konventionelle Oberleitung versorgt werden.
Die Fahrzeuge der Linie M2 der Métro Lausanne entsprechen ebenfalls weitgehend jenen der deutschen Netze, verwenden jedoch das ursprünglich bei der Métro Paris entwickelte kombinierte System aus Stahlrad und Gummireifen. Zudem sind die Stationen ausschließlich für den Betrieb mit rund 30 Meter langen Doppeltriebwagen ausgelegt, während in den Netzen in Deutschland und Österreich deutlich längere Fahrzeuge bzw. Fahrzeugverbände eingesetzt werden können.
Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) hat eine sogenannte Typenempfehlung für U-Bahn-Fahrzeuge entwickelt, die eine Breite von 2,9 Metern und eine Höhe von 3,5 Metern vorsieht.[166] Dies entspricht den Abmessungen der Fahrzeuge der in den 1960er Jahren geplanten und realisierten Münchner und der Nürnberger Netze sowie etwa den Abmessungen der Hochflur-Fahrzeuge der zur selben Zeit realisierten Wiener U-Bahn.
Die Nomenklatur der verschiedenen Fahrzeugtypen wird üblicherweise von den Verkehrsbetrieben bzw. den Herstellern vergeben. Anders als bei Vollbahnfahrzeugen, bei der die Baureihenbezeichnungen der DB teilweise auch von nichtbundeseigenen Bahnen verwendet werden, haben die Betriebe der deutschsprachigen Länder jeweils eigene Namensschemata. So werden die auf der Inspiro-Plattform von Siemens Mobility basierenden Fahrzeuge in München als Baureihe C, in Nürnberg als Baureihe G1 und in Wien als Typ X bezeichnet. Umgekehrt wird derselbe Name bei verschiedenen Betreibern für völlig unterschiedliche Fahrzeuge verwendet, beispielsweise die jeweils DT3 genannten Baureihen der Hamburger Hochbahn und der Nürnberger VAG (jeweils mit der Bedeutung Doppeltriebwagen der dritten Generation).
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die aktuell in den einzelnen Netzen eingesetzten Baureihen.
| System | Baureihe | Hersteller | Aufbau* | Länge | Breite | Traktionssystem | Spurweite | Stromversorgung | Spannung | Automatisierungsstufe | Max. Länge der Zugverbände | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-Bahn Berlin[128] | Kleinprofil | A3 | DT | 25,66 m | 2,3 m | Stahlrad auf Stahlschiene | 1435 mm (Normalspur) | seitliche, von oben bestrichene Stromschiene | 750 V Gleichspannung | ca. 100 m | ||
| G | LEW Hennigsdorf | 25,6 m | ||||||||||
| HK | Bombardier | TZ (4) d | 51,59 m | |||||||||
| IK | Stadler | 51,6 m | 2,4 m | |||||||||
| JK (vsl. ab Ende 2024)[168] | DT d | 25,8 m | ||||||||||
| TZ (4) d | 51,6 m | |||||||||||
| Großprofil | F |
|
DT | 32,1 m | 2,65 m | seitliche, von unten bestrichene Stromschiene | ||||||
| H | ABB Henschel/ADtranz/Bombardier | TZ (6) d | 98,74 m | |||||||||
| J (bestellt) | Stadler | DT d | 32,1 m | |||||||||
| TZ (4) d | 64,2 m | |||||||||||
| U-Bahn Hamburg[169] | DT4 | ABB/LHB | TZ (4) | 60,1 m | 2,58 m | |||||||
| DT5 | Alstom LHB/Bombardier | TZ (3) d | 39,6 m | |||||||||
| DT6 (vsl. ab 2028)[171] | Alstom | TZ (4) d | ca. 40 m | 2,73 m | ||||||||
| U-Bahn München[172] | A | DT | 37,2 m | 2,9 m | GoA 2/STO | ca. 115 m | ||||||
| B |
|
37,5 m | ||||||||||
| C |
|
TZ (6) d | 114 m | |||||||||
| U-Bahn Nürnberg[62] | DT3 | Siemens | DT | 38,4 m |
|
ca. 75 m | ||||||
| G1 | TZ (4) d | 75,4 m | ||||||||||
| U-Bahn Wien[29] | U1 bis U4 | V | Bombardier/ELIN/Siemens | TZ (6) d | 111,2 m | 2,85 m | ca. 110 m | |||||
| X | Siemens | |||||||||||
| U6 | T, T1 | Bombardier | TZ (3) d | 27,3 m | 2,65 m | Oberleitung | GoA 1/NTO | |||||
| Métro Lausanne | Be 8/8 TL | Alstom | DT d | 30,68 m | 2,46 m | Stahlrad auf Stahlschiene in Kombination mit Gummireifen | seitliche, seitlich bestrichene Stromschiene | GoA 4/UTO | 30,68 m nur Einzeltraktionen | |||
| * Legende: DT = Doppeltriebwagen mit zwei fest miteinander verbundenen Wagen; TZ (3/4/6) = Triebzug mit drei/vier/sechs fest miteinander verbundenen Wagen; d = durchgängig begehbares Fahrzeug | ||||||||||||
Stationen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Allgemeine Merkmale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-
Kellinghusenstraße, Hamburg;
bahnsteiggleicher Umstieg zwischen
U1 und U3 an benachbarten Richtungsbahnsteigen -
Lionel-Groulx, Montreal:
bahnsteiggleicher Umstieg zwischen Ligne verte und Ligne orange mit Halt der Züge derselben Linie übereinander
Grundsätzlich entspricht der Aufbau von U-Bahn-Stationen dem von Bahnhöfen der Eisenbahn. Entsprechend dem überwiegend mindestens zweigleisigen Ausbau von Strecken (siehe hier) verfügen U-Bahn-Stationen in der Regel über separate Bahnsteiggleise für beide Fahrtrichtungen einer Linie. Darüber hinaus verfügen Trennungsbahnhöfe, an denen sich eine Strecke in mehrere Äste aufteilt, teilweise über drei oder vier Gleise, ebenso wie Zwischenendpunkte von Linien, um ein- und aussetzende von weiterverkehrenden Zügen trennen zu können.

Bergmännisch gegrabene Station in Form einer maulförmigen Kaverne


Unterirdische U-Bahn-Stationen weisen vier verschiedene Grund-Bauweisen auf:
- in offener Bauweise gegrabener Stationsbereich, meist erkennbar an horizontalen Wänden und vertikaler Decke, mit in offener Bauweise erstellten Anschlussstrecken
- in offener Bauweise gegrabener Stationsbereich mit in bergmännischer Bauweise erstellten Anschlussstrecken, hierbei diente die Station während der Bauphase als Zwischenangriff
- in bergmännischer Bauweise erstellte Station in Form eines aufgeweiteten, maulförmigen Tunnelprofils, das heißt einer sogenannte Kaverne
- in bergmännischer Bauweise erstellte Station in Form einer dritten Röhre zwischen den beiden Streckentunneln, die beiden Streckenröhren sind mit der Stationsröhre durch zahlreiche Querschläge miteinander verbunden
Wesentliche Merkmale von U-Bahn-Stationen sind insbesondere:
- Abstimmung von Station und Fahrzeug: Während Bahnhöfe der Eisenbahn häufig für die Bedienung von Zügen mit sehr unterschiedlichen Längen und Bodenhöhen ausgelegt sein müssen, ermöglichen der homogenere Fahrzeugpark und die beschränkte Zahl möglicher Zuglängen bei der U-Bahn eine wesentlich engere Abstimmung von Station und Fahrzeug aufeinander, sodass die Bahnsteiglänge der maximalen Länge der einsetzbaren Fahrzeuge bzw. Fahrzeugverbände und die Bahnsteighöhe – im Wesentlichen – der Fußbodenhöhe des Zuges entspricht und so einen stufenlosen Zugang ermöglicht, der für die Barrierefreiheit (siehe hier) sowie den allgemeinen Nutzungskomfort relevant ist.
Teilweise werden Stationen in Hinblick auf mögliche spätere Kapazitätssteigerungen bereits für längere Fahrzeuge entworfen, z. B. in Lille, wo die Bahnsteige von Anfang an für eine Bedienung mit Doppeltraktionen hergestellt wurden, bislang jedoch nur mit Einfachtraktionen bedient werden,[63] oder auf der Linie 14 in Paris, deren Bahnsteige für Acht-Wagen-Züge ausgelegt sind, aber nur mit Sechs-Wagen-Einheiten bedient werden.[107] Die nachträgliche Verlängerung von Bahnsteigen bzw. Stationen wird ebenfalls praktiziert, beispielsweise auf den Pariser Linien 1 und 4, die in den 1960er Jahren im Zuge der Vorbereitung der Umstellung auf Gummireifenbetrieb von 75 auf 90 Meter verlängert wurde,[107] oder bei den innerstädtischen Tunnelstationen der ursprünglichen Ringstrecke der Hamburger U-Bahn, die Ende der 1920er Jahre für den Sechs-Wagen-Betrieb auf ebenfalls 90 Meter verlängert wurden.[149] Derartige Anpassungen sind jedoch insbesondere bei Tunnelstationen mit einem erheblichen Aufwand verbunden. - Separate Bahnsteiggleise für jede Linie: Anders als bei Bahnhöfen der Eisenbahn und Haltestellen der Straßenbahn, bei denen dieselben Bahnsteiggleise von Zügen unterschiedlicher Linien genutzt werden, verfügen U-Bahn-Stationen in der Regel über separate Bahnsteiggleise für jede Linie bzw. jedes Linienbündel. Stationen, die von mehreren Linien/-bündeln bedient werden, sind entsprechend mehrgleisig ausgeführt.
Die Anordnung der Bahnsteige der einzelnen Linien/-bündel zueinander ist abhängig von den räumlichen, baulichen und planerischen Bedingungen unterschiedlich komfortabel ausgestaltet; aus Fahrgastperspektive besonders attraktiv ist die Anordnung der Gleise unterschiedlicher Linien am selben Mittelbahnsteig, um hierdurch einen bahnsteiggleichen Übergang zwischen den Linien zu schaffen. Teilweise wird der Fahrplan der einzelnen Linien in solchen Fällen so abgestimmt, dass Züge beider Linien einander abpassen, um Wartezeiten für umsteigende Fahrgäste zu vermeiden. Gleichzeitig bestehen jedoch auch vielfach Stationen mit erheblichen Wegelängen zwischen den Bahnsteigen der einzelnen Linien, wenn beispielsweise bestehende Stationen erweitert werden und eine engere Zusammenführung zwischen alten und neuen Bahnsteigen mit zu großen baulichen Eingriffen und/oder einem zu hohen finanziellen Aufwand verbunden sind. - Zwillingsbahnsteige: In einzelnen Netzen sind Stationen nach der sogenannten „Spanischen Lösung“ mit Bahnsteigen auf beiden Seiten des Gleises angelegt. Bei zweigleisigen Stationen sind die Gleise häufig zwischen zwei separaten außenliegenden Seitenbahnsteigen und einem gemeinsamen zentralen Mittelbahnsteig angeordnet (siehe Beispiel Clot oben). Die so gewonnene zusätzliche Verkehrsfläche dient der Beschleunigung des Fahrgastwechsels, in einigen Netzen erfolgt zusätzlich eine Trennung von Ein- und Ausstieg nach Bahnsteigen, sodass ein- und aussteigende Fahrgäste einander nicht behindern.[65]
Ausstattung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-
14th Street/Sixth Avenue, New York:
Typische Tunnelstation der Subway -
Iidabashi (Yūrakuchō Line), Tokio;
Für zahlreiche japanische Stationen typischer gestalterisch schlichter Entwurf -
Zugfolgeuhr in Moskau; letzte Abfahrt vor 3 Minuten und 23 Sekunden
Die Ausstattung von U-Bahn-Stationen ist grundsätzlich vergleichbar mit derjenigen moderner Eisenbahn-Stationen und bietet in der Regel Fahrgastinformationseinrichtungen wie Zugzielanzeiger, Fahrplan- und Liniennetzplanaushänge, Fahrkartenautomaten, Notruf- und/oder Informationstelefone, Sitzgelegenheiten und bei oberirdischen Stationen häufig einen Witterungsschutz für mindestens einen Teil des Bahnsteigs. Insbesondere an innerstädtischen Standorten und bedeutenden Netzknoten verfügen Stationen zudem häufig über weitere Einrichtungen wie Kundenbüros der jeweiligen Verkehrsbetriebe und/oder Verkehrsverbünde, Kioske, gastronomische Angebote und Toiletten. Teilweise sind Stationen auch mit größeren unterirdischen Ladenpassagen oder Einkaufszentren verknüpft bzw. in diese integriert. Beispiele für besonders ausgedehnte und komplexe unterirdische Netzwerke, die mit zahlreichen U-Bahn-Stationen verknüpft sind, sind das RÉSO in Montreal und das PATH-Netz in Toronto.
Ein vor allem in Netzen der ehemaligen Sowjetunion und anderer (ehemals) sozialistischer Staaten verbreitetes Ausstattungselement sind digitale Zugfolgeuhren am jeweils vorderen Ende des Bahnsteigs. Diese geben in der Art einer Stoppuhr die Minuten und Sekunden an, die seit Abfahrt des letzten Zuges vergangen sind und werden bei Abfahrt des Folgezuges auf Null zurückgesetzt. Bei Kenntnis der zur jeweiligen Tageszeit gültigen Taktfolge und unter Voraussetzung eines pünktlichen Betriebs kann so die Zeit bis zur nächsten Abfahrt ermittelt werden. Zugfolgeuhren stellen damit eine Umkehrung des ansonsten üblichen Darstellung auf Zugzielanzeigern am Bahnsteig dar, die die verbleibende Zeit bis zur nächsten Abfahrt herunterzählen.
Sicherheit
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-
Überfüllter Bahnsteig der Station Tacuba, Mexiko-Stadt
-
Bahnsteigtüren in der Station Castle Hill der Sydney Metro
-
Krauchnische unterhalb der Bahnsteigkante in der Station Schönbrunn in Wien
-
Warnung „MIND THE GAP“ auf der Bahnsteigkante einer Station der London Underground
-
Ausgefahrener Schiebetritt an einem Bahnsteig in Hongkong
- Gleisstürze
Bei der U-Bahn besteht wie bei der Eisenbahn ein grundsätzliches Risiko in der Möglichkeit des unbeabsichtigten Stürzens sowie des Gestoßenwerdens von Personen auf das Gleis. Neben der Verletzungsgefahr durch den Sturz selbst kann sich hierdurch eine unmittelbare Lebensgefahr ergeben, mindestens durch die Möglichkeit der Kollision mit einem einfahrenden Zug, in Systemen mit Stromschiene zusätzlich durch die Gefahr eines Stromschlags durch Berühren der Schiene. Weiterhin ist die Möglichkeit des absichtlichen Springens vor einen Zug mit dem Ziel der Selbsttötung (Schienensuizid) oder im Rahmen von Mutproben o. ä. zu berücksichtigen. Durch die hochflurige Ausführung der Mehrzahl der Systeme ergibt sich ein im Vergleich zur Eisenbahn tieferer Gleistrog (auch Schienentrog[173] oder Gleiskanal) zwischen Bahnsteig und Bahnsteighinterwand/Gleishinterwand,[174] sodass im Falle eines Sturzes aufgrund der größeren Fallhöhe eine tendenziell größere Verletzungsgefahr besteht und das Hinaussteigen aus dem Trog mit größeren Schwierigkeiten verbunden sein kann.
Eine effektive Maßnahme gegen Personen und Gegenstände auf dem Gleis ist die Installation von Bahnsteigtüren, die Bahnsteig und Gleistrog voneinander abgrenzen und sich synchron mit den Fahrzeugtüren öffnen und schließen. Sie können insbesondere auf fahrerlos betriebenen Linien von Bedeutung sein, da hier kein Triebfahrzeugführer vorhanden ist, der manuell eine Schnellbremsung einleiten kann. Ende 2018 waren 77 Prozent der Stationen auf fahrerlos betriebenen Linien mit Bahnsteigtüren ausgestattet, während die restlichen 23 Prozent andere Sicherungssysteme verwendeten.[156] Bahnsteigtüren wurden zunächst bei verschiedenen U-Bahnen Asiens eingeführt und verbreiteten sich von dort aus in andere Erdteile. In Deutschland, Österreich und der Schweiz finden Bahnsteigtüren bislang bei automatisch betriebenen Linien Anwendung bzw. ist dort ein Einsatz geplant; in der Schweiz verfügt die Linie M2 der Métro Lausanne seit ihrer Eröffnung 2008 über Bahnsteigtüren. In Österreich wird die in Bau befindliche U5 der Wiener U-Bahn die erste Linie sein, deren Stationen entsprechend ausgestattet sind.[175] In Deutschland wird die U5 der Hamburger U-Bahn voraussichtlich die erste Linie sein, deren Stationen über Bahnsteigtüren verfügen.[176]
In einigen Systemen (z. B. München, Nürnberg, Wien, teilweise Hamburg) verfügen die Bahnsteige über sogenannte Krauch- oder Rettungsnischen unterhalb der Bahnsteigkante, in die sich gestürzte Personen zum Schutz vor einfahrenden Zügen zurückziehen können. Eine technische Lösung, die das Risiko einer Kollision mit einem Zug nach einem erfolgten Sturz reduzieren soll, sind elektronische Sensorsysteme (z. B. Lichtschranken) im Bereich des Gleistrogs und an den Zügen, die Personen und größere Gegenstände erkennen sollen und selbstständig eine Zwangsbremsung einleiten können. Entsprechende Systeme finden sich beispielsweise auf den Stationen der fahrerlos betriebenen Linien U2 und U3 in Nürnberg[177] und D in Lyon, früher auch auf den Stationen des Hochbahnabschnitts der Metro Kopenhagen,[116] die jedoch später mit Bahnsteigtüren nachgerüstet wurden. Zusätzlich stehen Fahrgästen in Zügen und teilweise auch auf Bahnsteigen Notbremsen zur Verfügung, die häufig zusätzlich an einen Notruf und eine direkte Sprechverbindung zum Fahrzeugführer bzw. zur Leitstelle gekoppelt sind. In U-Bahn-Zügen aktueller Generationen bewirkt die Betätigung der Notbremse in der Regel nur in den ersten zehn Sekunden nach Anfahrt eine Bremsung, danach wird lediglich eine Sprechverbindung zum Fahrzeugführer hergestellt.
- Lücke zwischen Bahnsteig und Fahrzeug
Ein weiteres Sicherheitsrisiko sowie Hindernis für die Barrierefreiheit ist der in einigen Netzen teilweise vorhandene horizontale Spalt zwischen Bahnsteigkante und Wagenfußboden, der vor allem bei Bahnsteigen in engen Kurvenlagen auftritt, bei denen die Enden der rechteckigen Wagenkästen eines Zuges geometrisch bedingt einen anderen Abstand von der Bahnsteigkante haben als deren Mitte. Ein großer horizontaler und auch vertikaler Abstand stellt insbesondere für Menschen mit verminderter körperlicher Beweglichkeit, mit Rollstühlen und Rollatoren sowie für Kinder und Personen mit Kleinwuchs ein Hindernis dar.
Zum Umgang hiermit sind zum einen Warnungen vor der Sturzgefahr verbreitet, beispielsweise das u. a. aus London bekannte Mind the Gap (dt. Achten Sie auf die Lücke), in Form von Durchsagen und Schriftzügen etwa an der Bahnsteigkante. Sowohl stations- als auch fahrzeugseitig kann dem Problem teilweise durch ausfahrbare Schiebetritte begegnet werden, die den Spalt schließen bzw. seine Breite reduzieren. Ein weiterer stationsseitiger Ansatz ist die Verbreiterung des Bahnsteigs durch statische sogenannte gap filler (dt. Lückenfüller) in Form von Kunststofflamellen an der Bahnsteigkante, die stabil betreten werden können, in Horizontalrichtung jedoch so flexibel sind, dass sie dem an ihnen vorbeistreichenden Wagenkasten nachgeben.[178]
Zur sicheren und barrierefreien Gestaltung von Bahnsteigen sind in Deutschland die Regelungen des § 31 BOStrab einschlägig, weitere konkretisierende Empfehlungen zu Planung und Ausführung sind in der DIN 18040-3 enthalten. Die Regelungen der BOStrab schreiben einen möglichst geringen, maximal jedoch 25 cm großen horizontalen Abstand zwischen Bahnsteigkante und Fahrzeugfußboden, aufeinander abgestimmte Höhen von Bahnsteigoberkante und Fahrzeugfußboden, die einen bequemen Zu- und Ausstieg erlauben, die rutschhemmende Ausführung der Bahnsteigoberfläche und Maßnahmen zur Vorbeugung des Abstürzens von Personen an der Bahnsteigkante vor.
Stationsgebäude/Zugangsbauwerke
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-
Querschnitt durch die Station Vörösmarty utca, Budapest;
Unterpflasterbahn mit in Fahrtrichtung ausgerichteten Zugängen -
Castro Valley, San Francisco Bay Area:
Station in Mittellage zwischen den Richtungsfahrbahnen einer Autobahn -
Liziba, Chongqing:
Sonderfall einer in ein Wohngebäude integrierten Station
Entsprechend der unterschiedlichen Trassenführungen gibt es Stationen im Tunnel, im Einschnitt, zu ebener Erde, auf Bahndämmen und auf Viadukten. Bei Tunnelstationen, die in einfacher oder einer anderen geringen Tiefenlage unter dem Geländeniveau errichtet wurden, besteht ein direkter Zugang von der Straßen- zur Bahnsteigebene, während tiefer gelegene Stationen häufig über eine oder auch mehrere Verteilerebenen zwischen Oberfläche und Bahnsteig verfügen, ebenso verfügen als Turmbahnhof angelegte Stationen über mehrere Bahnsteigebenen.
Bei einer Reihe von Systemen werden Zugänge zu Tunnelstationen grundsätzlich eingehaust oder in andere Gebäude integriert, z. B. in Städten mit kühlerem Klima und regelmäßigem Schneefall (z. B. Montreal, Toronto, Oslo, Stockholm).
Bei Tunnelstrecken, die dem Verlauf oberirdischer Straßen folgen, lassen sich bei den Zugängen zu Stationen folgende vier Grundtypologien unterscheiden:
- direkter Zugang vom seitlichen Gehweg zum Außenbahnsteig, in diesem Fall müssen die Fahrgäste teilweise oberirdisch die Straßenseite wechseln, um den gewünschten Richtungsbahnsteig zu erreichen
- direkter Zugang von der Straßenebene zum Mittelbahnsteig, in diesem Fall sind die Zugänge teilweise als Verkehrsinsel zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen der Straße angelegt
- Zugänge von beiden Straßenseiten zu einer Verteilerebene, die zugleich als Fußgängerunterführung dient, dort Abgang zum Mittelbahnsteig
- Zugänge von beiden Straßenseiten zu einer Verteilerebene, die zugleich als Fußgängerunterführung dient, dort getrennte Abgänge zu den beiden Richtungsbahnsteigen
Benennung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Wie bei anderen öffentlichen Verkehrsmitteln werden auch für die Stationen von U-Bahnen mehrheitlich Namen verwendet, die vom jeweiligen Stationsstandort abgeleitet sind (Straßen- und Platznamen, besondere Bauwerke und Einrichtungen, Quartiers- und Stadtteilnamen etc.). Dabei wird im Interesse der einfachen und eindeutigen Zuordnung und Orientierung in fast allen Systemen der Welt jeder Name nur einmal pro Netz vergeben. Stationen, an denen sich mehrere Linien kreuzen, tragen üblicherweise auf allen Linien denselben Namen.[117]
In germanischsprachigen Regionen werden Stationsnamen, die sich auf Straßen, Gassen, Plätze und dergleichen beziehen, in der Regel vollständig übernommen. In romanisch- und slawischsprachigen Regionen werden Namen dieses Typs hingegen mehrheitlich auf den jeweils namensgebenden Bestandteil verkürzt, beispielsweise Concorde für die Place de la Concorde in Paris, Diagonal für die Avinguda Diagonal in Barcelona, Duomo für die Piazza del Duomo in Mailand und Teatralnaja (Театральная) für den Teatralnaja Ploschtschad (Театральная площадь, dt. Theaterplatz) in Moskau.[117]
Zahlreiche Netze in Regionen, die nicht bzw. nicht hauptsächlich das lateinische Schriftsystem verwenden, benutzen parallel zum im lokalen Schriftsystem geschriebenen Namen lateinische Transkriptionen und teilweise Transkriptionen in Schriftsysteme anderer regional bedeutender Sprachen. Weiterhin werden in Netzen nicht englischsprachiger Regionen die Namen von Stationen, die sich verstärkt an ein internationales Publikum richten (Flughäfen, Messe- und Kongresszentren, Hauptbahnhöfe u. a.), häufig aus der lokalen Sprache ins Englische übersetzt.
- Benennung in mehrsprachigen Städten

In offiziell mehrsprachigen Städten und Regionen wird die Benennung von Stationen unterschiedlich gehandhabt. Die jeweiligen Regelungen bewegen sich häufig in einem Spannungsfeld zwischen Berücksichtigung der faktischen sprachlichen Mehrheitsverhältnisse auf der einen und sprachpolitischen (Ziel-)Setzungen auf der anderen Seite.
- Algier (Arabisch/Tamazight): Das System der algerischen Hauptstadt verwendet lediglich die arabische Sprache und verzichtet auf die Berücksichtigung der seit 2016 ebenfalls als Amtssprachen anerkannten Berbersprachen. Es wird jedoch zusätzlich Französisch verwendet, das aufgrund der kolonialen Geschichte Algeriens und der weiterhin engen Beziehungen zu Frankreich große Bedeutung als Lingua franca hat.
- Bilbao (Baskisch/Spanisch): Wie die gesamte Autonome Gemeinschaft des Baskenlandes sind Bilbao und die Provinz Bizkaia offiziell zweisprachig, während die deutliche Mehrheit der Bevölkerung in diesem Gebiet allerdings spanischsprachig ist und im Alltag entsprechend das Spanische vorherrscht. Mit wenigen Ausnahmen sind die Stationen jeweils einfach benannt, wobei überwiegend die baskischen Namen bzw. die baskischen Varianten der jeweiligen Ortsnamen (z. B. eu. Etxebarri statt es. Echévarri) verwendet werden.
- Barcelona (Katalanisch/Spanisch): Während Katalonien insgesamt zweisprachig ist, haben in Barcelona nur katalanischen Varianten von Ortsnamen offiziellen Charakter, was auch für die Namen der Metro-Stationen gilt.[65]
- Brüssel (Französisch/Niederländisch): Die Stationsbenennung in Brüssel spiegelt das komplexe Verhältnis zwischen französischer und niederländischer Sprache in der belgischen Hauptstadt und ihrem Umland wider. Grundsätzlich sind in Brüssel beide Sprachen Amtssprachen, die Mehrheit der Bevölkerung ist jedoch französischsprachig (siehe auch hier), gleichzeitig liegt Brüssel innerhalb der niederländischsprachigen Region Flandern.
Die Brüsseler Verkehrsbetriebe verwenden ein gemischtes System, das sich im Wesentlichen am jeweiligen lokalen Sprachgebrauch orientiert und u. a. einsprachig französische und niederländische Ortsnamen, Doppelbenennungen mit an die jeweilige Rechtschreibung angepassten Varianten desselben Namens (z. B. Osseghem/Ossegem, Trône/Troon, Yser/IJzer) und zweisprachige Benennungen bei entsprechend zweisprachig benannten Straßen, Orten, Bauwerken und Einrichtungen (z. B. Botanique/Kruidtuin, Comte de Flandre/Graaf van Vlaanderen, Étangs Noirs/Zwarte Vijvers) umfasst.
- Dublin (Englisch/Irisch): Für das in Planung befindliche System in Dublin ist wie bei den Stationen der Irish Rail und der Straßenbahn Dublin eine Benennung in beiden Sprachen vorgesehen, wobei wie bei Eisenbahn und Straßenbahn der irische Name jeweils zuerst genannt werden soll.[179][180]
Das genannte Muster spiegelt die (symbolische) Bedeutung des Irischen für die nationale und kulturelle Identität der Republik Irland wider; während Art. 8 der irischen Verfassung bestimmt, dass die irische Sprache als nationale Sprache die erste offizielle Sprache Irlands sei, wird Englisch gem. Art. 9 der Verfassung lediglich als eine zweite offizielle Sprache anerkannt. Dem steht gegenüber, dass nach eigenem Bekunden zwar rund 40 Prozent der Bevölkerung über Kenntnisse des Irischen verfügen, jedoch weniger als 1,5 Prozent die Sprache täglich im Alltag verwenden (Werte für 2022),[181] während Erst- und Alltagssprache der weit überwiegenden Mehrheit und insbesondere der stärker urbanisierten Bevölkerungsteile Englisch ist.
- Helsinki (Finnisch/Schwedisch): In Helsinki, das wie ganz Finnland offiziell zweisprachig ist, tragen wie bei den Bahnhöfen der Finnischen Bahn alle Stationen Namen in beiden Sprachen, wobei der finnische stets zuerst genannt und in einer fetteren Schriftstärke dargestellt wird.
Dieser Vorrang des Finnischen spiegelt die deutliche Mehrheit der finnischsprachigen Bevölkerung wider, deren Anteil im gesamten Land bei 84,9 und in Helsinki bei 75 Prozent liegt, während der Anteil der schwedischsprachigen Bevölkerung bei 5,1 bzw. 5,5 Prozent liegt (Werte für 2023).[182]
- Hongkong (Chinesisch bzw. vorrangig Kantonesisch/Englisch): Es werden überwiegend kantonesische Namen und eine einfache lateinischen Transkription verwendet. Ausgenommen sind Ortslagen, die über einen etablierten englischsprachigen Namen (z. B. Admirality für 金鐘 (dt. Goldene Glocke), Causeway Bay für 銅鑼灣 (dt. Kupfer-Gong-Bucht)) oder eine etablierte englische Übersetzung (z. B. Central für 中環, Fortress Hill für 炮台山, North Point für 北角) verfügen, wo stattdessen diese neben dem kantonesischen Namen verwendet werden.
- Ottawa (Englisch/Französisch): Die Confederation Line/Ligne de la Confédération erschließt sowohl die offiziell zweisprachige kanadische Hauptstadt Ottawa in der Provinz Ontario als auch deren im angrenzenden Québec gelegene, offiziell einsprachig französische Zwillingsstadt Gatineau. Während im Alltag in Ottawa das Englische und in Gatineau das Französische dominiert, beherrscht ein großer Teil der Bevölkerung, insbesondere in Gatineau, beide Sprachen fließend.[183]
Bei einer ähnlich komplexen sprachlichen Situation wie in Brüssel (s. o.) tragen die Stationen hier mit Ausnahme von Parliament/Parlement lediglich einen Namen, der jeweils so gewählt wurde, dass er für Sprecher beider Sprachen leicht verständlich, auszusprechen und zu schreiben ist.[184]
- Rennes (Französisch/Bretonisch/Gallo): Die Stationen sind einsprachig französisch benannt, jedoch ist die Beschilderung aller Stationen der jüngeren Linie b dreisprachig in französisch, bretonisch und englisch aufgeführt, zusätzlich ist die Beschilderung an einzelnen Stationen der älteren Linie Linie a neben französisch zusätzlich bretonisch oder auf Gallo ausgeführt.[185]
- Valencia (Valencianisch/Spanisch): In Valencia, dass wie die gesamte Valencianische Gemeinschaft zweisprachig ist, haben sowohl die valencianische als auch spanische Variante von Ortsnamen offiziellen Status und die Mehrheit der Bevölkerung ist spanischsprachig, jedoch werden für die Metro-Stationen ausschließlich valencianische Namen verwendet.[65]
- Stationsnummerierung und Stationslogos
-
Ōtemachi, Tokio:
Linienband der Tōzai Line mit Stationsnummer (T09), Vollname in Kanji (大手町) und Transkriptionen in Hiragana (おおてまち), Rōmaji, Chinesisch (大手町) und Hangeul (오테마치) -
Jonggak, Seoul:
Stationsnummer (131), Vollname in Hangeul (종각) und Transkriptionen in revidierter Romanisierung, vereinfachtem Chinesisch (钟阁; als Langzeichen sowie Hanja: 鐘閣) und Katakana (チョンガク) -
Ōhorikōen, Fukuoka:
Stationslogo (japanische Kirschblüte), Vollname in Kanji (大濠公園) und Transkriptionen in Hiragana (おおほりこうえん) und Rōmaji, englische Übersetzung und Stationsnummer (K06)
Eine vorwiegend in asiatischen Netzen verbreitete Praxis ist die Nummerierung von Stationen, bei der jede Haltestelle zusätzlich zu ihrem im jeweils lokal verwendeten, nicht lateinischen Schriftsystem geschriebenen Namen ein Kurzzeichen, beispielsweise in Form eines lateinischen Buchstabens und einer fortlaufenden, mit arabischen Ziffern geschriebenen Nummer, trägt. Auf diese Weise wird die Orientierung für Personen vereinfacht, die nicht in der Lage zum Lesen des lokalen Schriftsystems sind. Die Stationen sind dabei von einem Linienende zum anderen durchnummeriert, Umsteigestationen tragen entsprechend der Anzahl der sich dort berührenden Linien und der Position im Verlauf der einzelnen Linie mehrere Kurzzeichen. So verwendet der von fünf Linien bediente Netzknoten Ōtemachi der Tokioter U-Bahn die Kurzzeichen C11 (Chiyoda Line), I09 (Mita Line), M18 (Marunouchi Line), T09 (Tōzai Line) und Z09 (Hanzōmon Line). In zahlreichen japanischen Systemen werden zudem Transkriptionen der in Kanji geschriebenen Stationsnamen in Kana verwendet, sodass Namen beispielsweise auch von Kindern und Sprachlernenden, die die verwendeten Kanji noch nicht beherrschen, phonetisch gelesen werden können.
Einen ähnlichen Ansatz wie die Stationsnummerierung verfolgt das in Mexiko-Stadt entwickelte System, bei dem jede Station zusätzlich zu ihrem Namen ein individuelles graphisches Zeichen trägt, das sich auf den Namen, die Geschichte des Standorts oder ein dort gelegenes markantes Bauwerk oder Objekt bezieht. Das Logo der Station Zócalo/Tenochtitlan am zentralen Platz der mexikanischen Hauptstadt beispielsweise zeigt einen Adler, eine Schlange und einen Kaktus und spielt hiermit sowohl auf den Gründungsmythos von Tenochtitlan, der historisch hier gelegenen Hauptstadt des Aztekenreichs, als auch auf das an diesen Mythos angelehnte moderne Wappen Mexikos und hiermit auf die Bedeutung des Platzes als politisches (Sitz von Präsident und Regierung), geistliches (Sitz des Erzbischofs von Mexiko) und ideelles Zentrum Mexikos an. Das System wurde u. a. eingeführt, um der zum Zeitpunkt des Baus der U-Bahn hohen Zahl von Analphabeten in der mexikanischen Gesellschaft die Nutzung des Verkehrsmittels zu erleichtern, wurde als charakteristisches Element der graphischen Gestaltung des Systems jedoch auch bei späteren Erweiterungen fortgeführt.[186][187][188] Die U-Bahnen von Fukuoka, Monterrey und Toulouse sowie das Linimo-System in Aichi verwenden ähnliche Systeme.
- Namenssponsoring
Ein seit Beginn des 21. Jahrhunderts auftretendes Phänomen ist der Verkauf von Namensrechten von U-Bahn- sowie anderen ÖPNV-Stationen zu Werbezwecken, wie er zuvor beispielsweise von Sportstadien bekannt war. Der bestehende Stationsname kann hierbei um den Namen des Sponsors ergänzt, durch ihn ersetzt oder abgewandelt werden (siehe Beispiele unten). Verbunden mit der Verkauf eines Namens sind teilweise auch exklusive Rechte zur Nutzung der regulären Werbeanlagen der Station durch den Sponsor oder zur Durchführung von Werbeaktionen. U. a. die Verkehrsbetriebe von New York, Chicago, Philadelphia, Seoul, Kuala Lumpur und Manila bieten entsprechende Vereinbarungen an, u. a. in Toronto wird die Möglichkeit hierzu geprüft.[189][190][191][192][193][194][195][196]
Die Verkehrsbetriebe bzw. -behörden begründen den Verkauf mit den erzielbaren zusätzlichen Einnahmen vor dem Hintergrund der latenten bis chronischen Unterfinanzierung des ÖPNV bzw. mit der Entlastung des öffentlichen Haushalts, der Defizite aus dem ÖPNV-Betrieb auffangen muss. Kritiker verweisen demgegenüber auf die mögliche Verschlechterung der Orientierung für Fahrgäste, wenn eine Station keinen ortsbezogenen Namen trägt, und die aus ihrer Sicht grundsätzliche Entbehrlichkeit zusätzlicher Werbung im öffentlichen Raum. Mithin leiste der Verkauf von Namen öffentlicher Einrichtungen dem Eindruck einer Privatisierung selbiger Vorschub.[191][192][195][196][197][198][199][200][201][202]
Von gesponserten Namen abzugrenzen sind Stationen, die den tatsächlichen physischen Standort eines Unternehmens, einer Einrichtung oder einer Organisation erschließen und aus diesem Grund nach ihnen benannt sind und für die keine Sponsorenvereinbarungen bestehen (z. B. Bijlmer ArenA in Amsterdam, Hagenbecks Tierpark in Hamburg und Olympia-Einkaufszentrum in München).
- Beispiele
-
NRG Station, Philadelphia
(seit 2018) -
Yamaha Monumento, Manila
(2018–2021) -
Apgujeong (Hyundai Department Store), Seoul
-
Vodafone Sol, Madrid
(2013–2016)
Beispiele für derartige Vereinbarungen sind die ursprünglich Pattison Avenue genannte südliche Endstation der Broad Street Line in Philadelphia, die von 2010 bis 2018 nach dem Telekommunikationsunternehmen AT&T benannt war und seit 2018 den Namen des Energieversorgungsunternehmens NRG Energy trägt, die Station Monumento in Manila, die infolge einer Vereinbarung mit der Yamaha Motor Company zwischen 2018 und 2021 Yamaha Monumento hieß[203] und die einwöchige Umbenennung des Londoner Bahnhofs Bond Street in Burberry Street nach dem gleichnamigen Modeunternehmen anlässlich der London Fashion Week im September 2023.
Die für Philadelphia zuständigen regionalen Verkehrsbetriebe SEPTA erzielten mit dem Verkauf an AT&T 3,4 Millionen Dollar für zunächst fünf Jahre und mit der Vereinbarung mit NRG Energy rund 4,5 Millionen Dollar für eine Laufzeit von ebenfalls fünf Jahren. In Manila erfolgte die Kompensation in Form der Übernahme von Sanierungs- und Modernisierungs- sowie Betriebs- und Unterhaltungskosten für die Station. Transport for London erhielt für die Umbenennung der Station 200.000 GBP, zudem wurden sämtliche Kosten für die Neubeschilderung und sonstigen Anpassungen der Station sowie den anschließenden Rückbau durch den Sponsoren getragen.[204]
Ein Beispiel, das aufgrund der negativen Reaktion der lokalen Öffentlichkeit internationalen Widerhall fand, war die Station Sol der Metro Madrid, deren Name für 3 Millionen Euro an den Mobilfunkanbieter Vodafone verkauft wurde und von Mitte 2013 bis Mitte 2016 Vodafone Sol hieß. Die Station liegt an der Puerta del Sol, einem zentralen, historischen Stadtplatz in der Madrider Innenstadt, und die Umbenennung zu werblichen Zwecken wurde angesichts der Bedeutung des Ortes vielfach als unangemessen kritisiert. Die für den Verkauf verantwortliche Regierung der Autonomen Gemeinschaft Madrid erhielt mehrere Zehntausend Protestschreiben und zahlreiche der neuen Stationsschilder wurden zerstört, übergesprüht und entwendet. Die Regierung nahm vor diesem Hintergrund Abstand von einer Verlängerung der Vereinbarung mit Vodafone und räumte rückblickend eine Fehleinschätzung der Tragweite der Umbenennung ein und bezeichnete die öffentliche Reaktion als „gesellschaftlichen Aufruhr“.[202][205]
- Weitere Besonderheiten
- Von der üblichen Praxis der einmaligen Vergabe eines Namens innerhalb desselben Netzes weichen weltweit einzig die Netze der Chicago Elevated und der New York City Subway ab, in denen eine Vielzahl von Stationen den gleichen Namen trägt.[117] Dies erklärt sich grundsätzlich aus der rasterförmigen Anlage der beiden Städte mit sehr langen Straßenverläufen, die über ihre gesamte Länge denselben Namen tragen. Einzelne Linien, die dieselbe Straße an unterschiedlichen Punkten kreuzen und dort Haltepunkte haben, werden einheitlich nach dieser Straße benannt. So gibt es in Chicago u. a. jeweils vier Stationen mit den Namen Western (davon zwei auf der Blue Line) und Pulaski und jeweils dreimal die Station Cicero, Damen und Kedzie, jeweils benannt nach den kreuzenden Avenues. In New York trägt u. a. ein Großteil der Stationen der vier bis fünf parallel in Nord-Süd-Richtung durch Manhattan verlaufenden Strecken den Namen der jeweils in Ost-West-Richtung kreuzenden Streets, entsprechende Doppelungen gibt es auch auf Strecken in den anderen Bezirken. Die eindeutige Identifikation einer Station erfordert in diesen Netzen entsprechend die Kenntnis sowohl des Stationsnamens als auch der Linie.
- Von der üblichen Praxis der einheitlichen Benennung von Kreuzungspunkten weichen die Netze der früheren Sowjetunion (Charkiw, Kiew, Minsk, Moskau, Nowosibirsk, Sankt Petersburg, Taschkent) ab, in denen Stationen an Kreuzungspunkten mehrheitlich unterschiedliche Namen tragen bzw. als unterschiedliche, jedoch miteinander verbundene Stationen behandelt werden.[117]
- Von der üblichen Praxis der Benennung von Stationen nach ihrem Standort weicht das System in Pjöngjang in außergewöhnlicher Weise ab; die Namen beziehen sich – ebenso wie die der Linien (siehe hier) – auf die sozialistische Revolution, den Koreakrieg einschließlich seines aus nordkoreanischer Sichtweise als eigener Sieg verstandenen Endes[206] und den Wiederaufbau des Landes nach Ende des Kriegs,[207] erlauben jedoch keinen Rückschluss auf die tatsächliche Ortslage. Zu den Stationen zählen u. a.: Kaesŏn (개선, dt. Triumphale Wiederkunft), Kŏnsŏl (건설, dt. Aufbau), Ponghwa (봉화, dt. Signalfeuer), Pulgŭnbyŏl (붉은별, dt. Roter Stern) und Rakwŏn (락원, dt. Paradies).
Sekundärnutzung im Kriegsfall
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-
Walter Bayes: The Underworld: Taking cover in a Tube Station during a London air raid (1918); künstlerische Verarbeitung der Flucht in die Tube-Station Elephant & Castle während des Ersten Weltkriegs
-
Schutzsuchende in der Station Ventas der Metro Madrid während des Spanischen Bürgerkriegs, 1937
-
Hinweis auf den Schutzraum in der 1977 eröffneten Station Pankstraße, West-Berlin
-
Nutzung als Zufluchtsort in Kiew während russischer Angriffe, 2022
-
In der Metro eingerichtetes Klassenzimmer in Charkiw, 2023
Tunnelstationen und -strecken werden aufgrund ihrer vergleichsweise sicheren Lage im Untergrund seit dem Ersten Weltkrieg auch als Schutzräume gegen Bombardements genutzt.[208] Während diese Nutzung bei der Planung der ersten Tunnelstrecken der London nicht eingeplant worden war und sich spontan als Reaktion auf die deutschen Luftangriffe ergab, wurde die Moskauer Metro bereits gezielt in Hinblick auf eine mögliche Nutzung als Schutzanlage entworfen und daher in besonders großer Tiefenlage gebaut, um im Falle eines Waffengangs Schutzsuchende aufnehmen zu können. Zu einem entsprechenden Einsatz kam es bereits wenige Jahre nach Eröffnung der Metro während der deutschen Luftangriffe auf Moskau im Zweiten Weltkrieg.
Unter dem Eindruck dieser Erfahrungen und vor dem Hintergrund des Kalten Kriegs und des mit ihm verbundenen atomaren Wettrüstens wurden in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zahlreiche neu gebaute Stationen und ganze Systeme auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs als Schutzanlagen konzipiert. Insbesondere in der Sowjetunion und den mit ihr alliierten Staaten wurden Streckentunnel und Stationen nach Moskauer Vorbild vielfach in erheblicher Tiefe angelegt. Im Sinne dieser Planung verwendet wurden die Anlagen außerhalb Moskaus jedoch erst im Zusammenhang mit dem russischen Überfall auf die Ukraine seit 2022, als Metrostationen in Kiew und Charkiw als Schutzräume geöffnet wurden. In Stationen in Charkiw wurden darüber hinaus im Jahr 2023 insgesamt 60 Klassenräume für insgesamt mehr als 1000 Schüler eingerichtet, um diese vor möglichen Luftangriffen zu schützen.[209]
In westlichen Staaten verfügen u. a. Berlin, Hamburg und Helsinki über entsprechende Schutzanlagen. In letzterem betrifft dies die sechs innerstädtischen Stationen von Sörnäinen/Sörnäs bis Ruoholahti/Gräsviken,[210] wobei der Bevölkerungsschutz in Finnland aufgrund der direkten Nachbarschaft zur Sowjetunion und später zu Russland seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts politisch priorisiert wird[211] und das Land nach Angaben der finnischen Regierung im Jahr 2023 über mehr als 50.000 öffentliche Luftschutzkeller verfügte.[212][213][214]
Betriebswerkstätten, Depots und Abstellanlagen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-
239th Street Yard der New York City Subway in vorstädtischer Lage in der nördlichen Bronx
-
Hauptwerkstatt Seestraße der BVG mit begleitender Blockrandbebauung im innenstadtnahen Ortsteil Wedding
-
Zwölfgleisige oberirdische Abstellanlage zwischen Legienstraße und Billstedt in Hamburg mit außenliegenden Streckengleisen
-
Zweigleisige unterirdische Abstellanlage der Berliner U8 mit außenliegenden Streckengleise
-
Kim Chuan Depot der Singapurer Circle Line, größte unterirdische Abstellanlage der Welt mit einer Hallenlänge von 800 Metern
-
Einheben eines Wagens der Berliner U55 in den Streckentunnel durch die speziell hierfür vorgesehene sogenannte Materialeinlassöffnung, 2014
Betriebswerkstätten für Wartung, Reinigung, Instandhaltung und Reparatur sowie Depots und Abstellanlagen für Fahrzeuge werden aus Kosten- und Platzgründen in der Regel oberirdisch und überwiegend außerhalb des inneren Stadtbereichs angelegt, sowohl am Streckenende als auch entlang der Streckengleise, beispielsweise an Endpunkt einer Linie oder für kurzlaufende Kurse, wodurch jeweils längere Ein- und Ausrückfahrten vermieden werden. Anlagen am Ende einer Strecke sind zudem häufig so geplant, dass sie als Vorleistung für mögliche Streckenverlängerungen genutzt werden können, etwa durch Umwandlung von Abstell- zu Streckengleisen, wodurch die Bauarbeiten erleichtert und Eingriffe in Betrieb und bestehende Infrastruktur während der Bauphase reduziert werden können. Ein wichtiges Kriterium für den Standort von Hauptdepots und Hauptwerkstätten ist weiterhin eine gute Anbindung an Schiene und Straße für die Belieferung mit Fahrzeugen, Ersatzteilen usw.
Teilweise werden auch größere Werkstätten und Depots unterirdisch angelegt, beispielsweise das Norsborgsdepå der Stockholmer U-Bahn westlich der Endstation Norsborg und das Kim Chuan Depot der Singapurer Circle Line, das mit einer Fläche von 12 ha zum Zeitpunkt seiner Eröffnung im Jahr 2009 die weltweit größte unterirdische Anlage dieser Art war und bis voraussichtlich 2026 um weitere 16 ha erweitert wird.[215][216]
Sind nicht alle Strecken eines Systems miteinander verbunden, ist für jedes Teilnetz ein eigener Betriebshof vorhanden. Einen Sonderfall stellen Linien dar, die im Inselbetrieb auf Strecken verkehren, die nicht mit dem Restnetz verbunden sind, weil sie z. B. als Teil einer größeren Streckenerweiterung vorab eröffnet wurden. Beispielsweise verkehrte die von 2009 bis 2020 bestehende U55 in Berlin isoliert zwischen Hauptbahnhof und Brandenburger Tor, bis sie 2020 am Alexanderplatz mit der U5 verknüpft und in diese integriert wurde. Entsprechendes galt für die U1 in Wien von 1978 bis 1979. In beiden Fällen mussten die Wagen provisorisch mit Kränen in den Tunnelschacht ein- und zu Wartungszwecken ausgehoben werden. In Glasgow wiederum stellte das Ein- und Ausheben von Wagen für 80 Jahre den Regelfall dar, da es keine Gleisverbindung zwischen den unterirdischen Streckentunneln und dem oberirdischen Depot an der Broomloan Road gab. Diese wurde erst Ende der 1970er Jahre im Rahmen eines umfassenden Sanierungs- und Modernisierungsprogramms des Gesamtsystems mit zwei Tunnelrampen südlich der Station Govan geschaffen.[106]
Barrierefreiheit
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-
Wendeltreppe in der Station Gloucester Road, London;
der barrierefreie Ausbau ist teilweise mit Herausforderungen verbunden -
Kontrastreicher Leitstreifen eines Bodenleitsystems auf dem Bahnsteig und kontrastreich markierte Bahnsteigkante
(Rotes Rathaus, Berlin) -
Visuelle Signalisierung der Zustiegsfreigabe durch Lichtbänder bei einem Zug der Baureihe C2 in München; beim Schließen wechselt die Farbe zu rot
-
Visuelle Signalisierung der Einfahrt eines Zugs durch Warnleuchten an der Bahnsteigkante
(Gallery Place, Washington, D.C.)
Barrierefreiheit bildet mittlerweile in zahlreichen Regionen einen zentralen Aspekt bei Planung und Betrieb von U-Bahn-Systemen und ihren einzelnen Komponenten (Stationen, Informationssysteme, Fahrzeuge u. a.). Eine wesentliche Bedeutung hat hierbei die Perspektive von Menschen, die auf Mobilitätshilfen wie Rollstühle oder Rollatoren angewiesen sind und die daher nicht bzw. nur eingeschränkt zum Treppensteigen in der Lage sind. Diese Gruppe ist von besonderer Bedeutung, da sie eine große und mit Blick auf die zunehmende Alterung der Gesellschaft tendenziell wachsende Zahl von Personen umfasst, da die Beeinträchtigung des Gehens stärker als viele andere körperliche Einschränkungen den Zugang zur U-Bahn limitiert und weil auch andere Gruppen wie Personen mit Kinderwagen und großen Gepäckstücken von einer stufenlosen Zugänglichkeit profitieren. Der Begriff wird jedoch vielfach weiter betrachtet und umfasst auch Belange von Menschen mit anderen körperlichen oder kognitiven Einschränkungen, die im Zusammenhang mit der Benutzung von U-Bahnen relevant sein können.
- Stationen
Aufgrund der vollständig unabhängigen Trassierung von U-Bahnen einschließlich des Ausschlusses von Bahnübergängen besteht zwangsläufig die Notwendigkeit zur Überwindung einer Höhendifferenz zwischen dem Zugangspunkt zu einer Station und dem Bahnsteig. Die Nutzung der U-Bahn kann hierdurch für Menschen mit verminderter körperlicher Bewegungsfähigkeit wie Rollstuhlfahrer und Personen mit Rollatoren unmöglich gemacht oder erheblich erschwert werden.
In der Europäischen Union sind neue U-Bahn-Stationen barrierefrei herzustellen, bestehende nicht barrierefreie Stationen sind entsprechend um- und auszubauen. Rechtliche Grundlage hierfür sind in Deutschland insbesondere § 8 PBefG und die entsprechenden Gleichstellungsgesetze der Länder (z. B. § 11 Abs. 2 des Berliner Landesgleichberechtigungsgesetzes).
Die U-Bahnen in München und Nürnberg sind vollständig barrierefrei bzw. rollstuhlgerecht ausgebaut, die Netze in Berlin und Hamburg weitgehend.
- Informations- und Leitsysteme
Entsprechend dem Zwei-Sinne-Prinzip werden an Fahrgäste gerichtete Informationen häufig sowohl akustisch als auch visuell vermittelt, sodass sie sowohl für Menschen mit eingeschränktem Seh- als auch Hörvermögen verständlich sind. Hierzu zählt beispielsweise die Ankündigung von einfahrenden Zügen und ihrem Fahrtziel über Durchsagen und Zugzielanzeiger und die Begleitung des Türschließens durch Signaltöne und -leuchten.
Für sehbehinderte Menschen finden sich vielfach taktile Bodenleitsysteme, die mithilfe eines Langstocks eine selbstständige Orientierung ermöglichen. In den vier deutschen U-Bahn-Städten verfügen alle rollstuhlgerecht ausgebauten Stationen auch über solche Leitsysteme. Weiterhin finden sich teilweise Beschriftungen in Brailleschrift, beispielsweise in Aufzügen und an Handläufen und Türtastern, oder taktile Orientierungskarten.
Schlüsselfertige Systeme
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Verschiedene Hersteller bieten integrierte Produkte bzw. sogenannte schlüsselfertige Systeme (en. turnkey) für den U-Bahn-Bau an, die neben der Bereitstellung sämtlicher technischer Infrastruktur einschließlich Fahrzeugen, Stromversorgung und elektrischer Ausrüstung, Signal-, Kommunikations- und Steuerungstechnik und Stations- und Werkstattausstattung aus dem Produktportfolio des jeweiligen Unternehmens auch sämtliche erforderlichen Dienstleistungen von Planung und Finanzierung über Projektsteuerung, Bau und Systemintegration bis zu Wartung und Instandhaltung aller Komponenten umfassen. Zu den Anbietern gehören u. a. Alstom (u. a. Neubau der Circle Line der MRT Singapur und der Linie 1 der U-Bahn Cluj-Napoca),[133][217][218] Hyundai Rotem (u. a. Neubau der Linie 9 der U-Bahn Seoul, der Linie 7 der MRT Manila und der Green Line der Taoyuan Metro in der Metropolregion Taipeh)[219] und Siemens Mobility (u. a. Erweiterung der Blue Line der Bangkok Metro, Neubau der Strecke der Sydney Metro zum Western Sydney Airport und der Linie 3 der Metro Pune).[220][221]
- VAL-Systeme

Bereits in den 1970 Jahren entwickelte das französische Unternehmen Matra mit dem VAL (Véhicule automatique léger; dt. leichtes automatisches Fahrzeug) eine fahrerlose Kleinprofil-U-Bahn als standardisiertes Produkt, das als kostengünstige Alternative zu konventionellen U-Bahn-Systemen für kleinere Ballungsräume und Strecken mit mittelhoher Frequentierung konzipiert ist. Die Kostenreduktion sollte insbesondere durch einen hohen Grad an Standardisierung der einzelnen Systemkomponenten und einen reduzierten Aufwand für den Bau der Streckeninfrastruktur erreicht werden, wozu kürzere und schmalere Fahrzeuge (ursprünglich 2,06 Meter, später auch 2,08 und 2,56 Meter) genutzt werden, die engere Kurvenradien und ein geringeres Lichtraumprofil ermöglichen. Im laufenden Betrieb soll die fahrerlose Steuerung weitere Einsparungen ermöglichen.[63]
Die erste U-Bahn auf Grundlage des VAL-Systems wurde 1983 mit der neu geschaffenen Métro Lille eröffnet, weitere Einsätze im städtischen Nahverkehr folgten in Toulouse (1993), Taipeh (1996), Rennes (2002), Turin (2006) und Uijeongbu, Südkorea (2012). Das System wird bzw. wurde darüber hinaus an den Flughäfen Paris-Orly (Orlyval, 1991), Chicago-O’Hare (Airport Transit System, 1993), Paris-Charles de Gaulle (CDGVAL, 2007), Bangkok-Suvarnabhumi (2020)[222] und Frankfurt (2023)[223] sowie ehemals Jacksonville (1989 bis 1996, ersetzt durch die Einschienenbahn Jacksonville Skyway) auch als Peoplemover bzw. Zubringer eingesetzt.
Seit vollständiger Übernahme der Matra Transport International S.A.S im Jahr 2001 ist Siemens alleiniger Eigentümer der VAL-Technologie. Sie wurde in der Folgezeit in Kooperation mit Lohr Industrie zum sogenannten Neoval[63] mit den Varianten Airval speziell für den Flughafen- und Cityval für den Stadtverkehr weiterentwickelt, das sich u. a. durch deutlich breitere Fahrzeuge (2,65 und 2,8 Meter) auszeichnet, die dem Profil moderner Voll-U-Bahnen nahekommen.[224]
Stilllegung von Strecken und Stationen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-
Boston, 1942: Stahlpfeiler auf der Fahrbahn der Commercial Street als Fragment der früheren Hochbahnstrecke der Atlantic Avenue Elevated; der Rückbau wurde 1955 abgeschlossen
Aufgrund der erheblichen Herstellungskosten und der zentralen Bedeutung für das öffentliche Verkehrsnetz sind Strecken und Stationen der U-Bahn grundsätzlich von großer Dauerhaftigkeit und werden im Vergleich zu Anlagen von Straßenbahn und Eisenbahn nur in wenigen Fällen dauerhaft stillgelegt.
Entscheidungen für Stilllegungen werden insbesondere aus betrieblichen und wirtschaftlichen Erwägungen getroffen, beispielsweise mit dem Ziel der Reduzierung der Reisezeit durch Aufgabe von Zwischenstationen oder Zusammenlegung benachbarter Stationen oder durch die Anpassung des Streckenverlaufs, mit dem Ziel der Verbesserung der Erschließungswirkung durch die Verlegung von Stationen oder die Verschwenkung von Strecken, aufgrund des Verlustes der verkehrlichen Bedeutung einer Station oder Strecke und einer entsprechend reduzierte Auslastung oder mit dem Ziel der Reduzierung redundanter Strecken bzw. als entbehrlich betrachteter Mehrfacherschließungen. Zwangsweise Stilllegungen können sich aus schwerwiegenden Beschädigungen infolge von Unfällen oder Kriegseinwirkungen ergeben, wobei historisch von Betreiberseite teilweise auf die Reparatur bzw. den Wiederaufbau zuvor ohnehin schwach ausgelasteter Strecken verzichtet wurde.
Beispiele für dauerhaft oder zumindest auf unbestimmte Zeit stillgelegte Anlagen sind:
- Atlantic Avenue Elevated, Boston (1938): Die 1901 eröffnete östliche Innenstadtstrecke der ersten U-Bahnlinie Bostons führte als Hochbahn am Bostoner Hafen entlang und erschloss die dortigen Industriebetriebe und Anleger für den Fährverkehr durch den Boston Harbor. Infolge von Betriebsschließungen und der Einstellung des Fährverkehrs nach Eröffnung des Sumner-Tunnels 1934 verschlechterte sich die Auslastung der Strecke so erheblich, dass der Betrieb 1938 eingestellt wurde. Die Betriebsanlagen wurden zwischen 1942 und 1955 vollständig zurückgebaut.[9]
- Bahnhöfe Arsenal, Champ de Mars, Croix-Rouge und Saint-Martin, Paris (1939): Die CMP schloss bereits am 2. September 1939, das heißt einen Tag nach dem deutschen Überfall auf Polen und einen Tag vor den Kriegserklärungen Frankreichs und des Vereinigten Königreichs an das Deutsche Reich, weite Teile der Métro; von 159 Kilometern Netzlänge wurden nur noch 93 betrieben und 150 der 235 Stationen des Netzes wurden geschlossen. Wesentliche Gründe hierfür waren die Reduzierung des Betriebspersonals infolge der Einberufung und die Sorge um mögliche Angriffe auf die Viaduktstrecken wie jene der Ringlinien 2 und 6.[225]
Der überwiegende Großteil der Anlagen wurde spätestens mit der Befreiung Frankreichs wieder in Betrieb genommen, lediglich die drei Stationen Arsenal (Linie 5), Champ de Mars (Linie 8) und Croix-Rouge (Linie 10) blieben bis in die Gegenwart geschlossen. Die Station Saint-Martin (Linien 8 und 9) ging nach der Befreiung kurzzeitig wieder in Betrieb, wurde jedoch aufgrund der sehr geringen Entfernung von nur rund 100 Metern zur Nachbarstation Strasbourg – Saint-Denis bereits kurze Zeit später wieder geschlossen. - Verschiedene Hochbahnstrecken, New York (u. a. 1940 bis 1955): Große Teile des ehemals sehr weitläufigen New Yorker Hochbahnnetzes wurden stillgelegt und durch parallele Tunnelstrecken ersetzt bzw. wurden parallel zu neueren Tunnelstrecken verlaufende ältere Hochbahnstrecken stillgelegt, darunter auch die vier Strecken auf Manhattan, mit denen das U-Bahn-Zeitalter in New York Ende des 19. Jahrhunderts begonnen hatte. Ihren Höhepunkt erreichte die Schließungswelle zwischen 1940 und 1955, nachdem die beiden früheren privaten U-Bahn-Gesellschaften IRT und BMT von der Stadt New York übernommen worden waren und das bislang aus zahlreichen direkt miteinander konkurrierenden Strecken bestehende Netz ohne größere Verluste der Erschließungsqualität bereinigt wurde.[9]
- Rothenburgsorter Zweigstrecke, Hamburg (1943): Die rund 3,2 Kilometer lange, größtenteils als Hochbahn trassierte Zweigstrecke der Ringlinie vom Hauptbahnhof über Hammerbrook nach Rothenburgsort wurde 1943 durch Luftangriffe im Rahmen der Operation Gomorrha erheblich beschädigt. Da bei den Angriffen auch der hochverdichtete, gründerzeitliche Wohnstadtteil Hammerbrook weitgehend zerstört wurde und die Auslastung der Strecke seit ihrer Eröffnung ohnehin hinter den Erwartungen zurückgeblieben war, entschied sich die Stadt gegen einen Wiederaufbau.[169]
- Bahnhof Osthafen, Berlin (1945): Der Bahnhof wurde im Zweiten Weltkrieg durch einen Bombenangriff weitgehend zerstört und aufgrund der geringen Entfernung zu den benachbarten heutigen Stationen Schlesisches Tor und Warschauer Straße nicht wieder aufgebaut.
- Station Deák Ferenc tér, Budapest (1956): Im Zusammenhang mit den 1950 aufgenommenen Bauarbeiten für die Linie M2 wurde die bestehende Tunnelstrecke der M1 im Bereich der Station Deák Ferenc tér zwischen 1952 und 1956 neu trassiert und die Station um rund 40 Meter verlegt. Die ursprüngliche Station aus dem Eröffnungsjahr 1896 und das anschließende Tunnelstück wurden hierbei vom Netz getrennt, seit 1975 beherbergt die Station das U-Bahn Museum Budapest.
- Gesamtsystem Liverpool Overhead Railway (1956): Das einzige jemals vollständig stillgelegte U-Bahn-System weltweit ist die Liverpool Overhead Railway, die 1893 als erste elektrische Hochbahn der Welt eröffnet worden war. Aufgrund fehlender Mittel für eine dringend erforderliche Generalsanierung und Modernisierung wurde das System Ende 1956 nach fast 64 Jahren Betrieb geschlossen.[106]
- Strecke Hősök tere–Széchenyi fürdő, Budapest (1973): Im Zuge der Verlängerung der Linie M1 von Széchenyi fürdő nach Mexikói út wurde das größtenteils im Einschnitt trassierte und in einem engen 180°-Bogen verlaufende östliche Streckenende im Bereich des Stadtwäldchens aufgegeben und durch eine neue, begradigt verlaufende Tunnelstrecke ersetzt. Die ursprüngliche oberirdische Endstation wurde durch eine weiter nordöstlich gelegene Tunnelstation ersetzt, die Zwischenstation Állatkert am Zoo wurde aufgegeben.
- Verschiedene Streckenabschnitte in Wien (1991/1996): Die Gürtellinie der ehemaligen Wiener Stadtbahn, die heutige U6, verfügte östlich der Station Nußdorfer Straße bis 4. März 1991 mit dem sogenannten Verbindungsbogen über eine Querverbindung zur Station Friedensbrücke der ehemaligen Donaukanallinie der Stadtbahn, der heutigen U4. Der Verbindungsbogen wurde aufgelassen, um den Bau der Verkehrsstation Spittelau und der U-Bahn-Strecke nach Floridsdorf zu ermöglichen. Mit deren Inbetriebnahme am 4. Mai 1996 wurde schließlich auch der nördliche Abschnitt der Gürtellinie, das heißt die Verbindung Abzweigstelle Nußdorfer Straße – Heiligenstadt, aufgegeben.[29]
Ferner wurde das ursprüngliche Stationsbauwerk der Gürtellinie/U6 am Westbahnhof von 1898 schon Ende der 1980er Jahre durch einen rund 53 Meter weiter östlich gelegenen Neubau ersetzt. Die letzten Arbeiten wurde offiziell am 8. November 1991 abgeschlossen, nachdem die Station jedoch bereits seit dem 28. Januar 1990 teilweise genutzt worden war. Das Ursprungsbauwerk wurde später verfüllt, die unterirdischen Zufahrtsstrecken blieben jedoch erhalten, um sie gegebenenfalls künftig als Straßentunnel nachnutzen zu können.[226][227] - Station Kwangmyŏng, Pjöngjang (1995): Die Station Kwangmyŏng der Hyŏksin-Linie wurde 1995 auf unbestimmte Zeit geschlossen, nachdem der an der Station gelegene Kŭmsusan-Palast, ursprünglich der Amtssitz von Präsident Kim Il-sung, nach dessen Tod in ein Mausoleum umgewandelt wurde. Die Station wird seitdem ohne Halt durchfahren. Eine begrenzte Anbindung des Palastes an den ÖPNV erfolgt seit 1996 durch die damals neu eingerichtete Kŭmsusan-Linie der Straßenbahn Pjöngjang, die vormittags als Shuttle für Besucher zwischen der U-Bahn-Station Samhŭng und dem Palast verkehrt.
- Bahnhof Französische Straße, Berlin (2020): Im Zuge des Lückenschlusses zwischen U55 und U5 zwischen Brandenburger Tor und Alexanderplatz wurde der Bahnhof Französische Straße der U6 geschlossen und durch den neuen, rund 150 Meter weiter nördlich gelegenen Kreuzungsbahnhof Unter den Linden ersetzt.

- Stillgelegte Stationen im geteilten Berlin
Einen Sonderfall stellte das Netz der Berliner U-Bahn dar, das während der Teilung der Stadt zunächst organisatorisch und nach dem Bau der Mauer im August 1961 auch physisch in einen westlichen und einen östlichen Teil getrennt wurde, wobei der Großteil des Netzes in West-Berlin lag. Während die zunächst sektoren- und später grenzüberschreitende Strecke der heutigen U2 zwischen Gleisdreieck (West) und Potsdamer Platz (Ost) relativ einfach getrennt werden konnte, verliefen die zentralen Abschnitte der heutigen Linien U6 und U8 durch Ost-Berlin, während die nördlichen und südlichen Außenstrecken in West-Berlin lagen. Die DDR gestattete gegen Nutzungsentgelt einen Betrieb der U-Bahn auf ihrem Territorium, jedoch wurden mit Ausnahme des Bahnhofs Friedrichstraße, der hierdurch zur Grenzübergangsstelle wurde, sämtliche Stationen der beiden Linien in Ost-Berlin geschlossen und ohne Halt durchfahren. Diese Situation blieb für knapp 30 Jahre bis zum Fall der Mauer bestehen, nach dem jedoch bereits Ende 1989 erste Stationen provisorisch wiedereröffnet werden konnten.[20] Teile der U2-Trasse wurden während dieser Zeit außerdem für die M-Bahn (1989 bis 1991) sowie einen touristischen Pendelverkehr mit einem historischen Straßenbahnwagen zwischen Nollendorfplatz und Bülowstraße (1978 bis 1991) genutzt.
Für die stillgelegten Bahnhöfen der Berliner U-Bahn wurde umgangssprachlich der atmosphärische Begriff Geisterbahnhof geprägt, der später für stillgelegte, jedoch physisch weiterhin vorhandene Bahnhöfe allgemein übernommen wurde und eine zusätzliche Erweiterung auf Bahnhofsbauten erfuhr, die zwar hergestellt, jedoch (noch) nicht in Betrieb genommen wurden oder Teil eines aufgegebenen Bahnhofsprojektes sind.
Netz und Betrieb
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Netzentwicklung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
U-Bahnen werden vorrangig im städtischen Raum und teilweise im engeren Verflechtungsraum von Stadt und Umland eingesetzt, wo die hohe Bebauungs- und Bevölkerungsdichte einerseits den Einsatz eines leistungsfähigen Massenverkehrsmittels und andererseits die aufwändige unabhängige Trassierung erfordert bzw. rechtfertigt. Einzelne Netze verfügen über überlandartige Strecken, die durch weniger dicht besiedelten Gebiete führen (z. B. Nordostteil der U1 in Hamburg), oder regional ausgerichtete Strecken, darunter verschiedene der zu Beginn des 21. Jahrhunderts realisierten chinesischen Netze bzw. deren in diesem Zeitraum realisierten Erweiterungen, die Expressverbindungen zwischen Kernstadt und Region bedienen (z. B. Linien 10, 18 und 19 in Chengdu, Linie 16 in Shanghai), und verschiedene Linien der U-Bahn Seoul, wobei es sich hierbei vielfach um stark verstädterte Räume mit durchgehend hoher Bebauungsdichte handelt. Der Grand Paris Express soll ebenfalls vorrangig regionale Funktionen im engeren Pariser Umland erfüllen, wobei dieses ebenfalls zu großen Teilen urbanisiert ist.[107] Durch den wechselseitigen Betrieb zwischen U-Bahn, Vorort- und S-Bahnen, der beispielsweise in verschiedenen japanischen Netzen praktiziert wird, verfügen verschiedene Netze ebenfalls über eine bedeutende Ausdehnung des Bedienungsgebiets in die Region (siehe hier).
Ausgangspunkt der Entwicklung der Mehrzahl der U-Bahn-Netze war bzw. ist die Erschließung der Innenstadt mit ihren bedeutenden Verkehrszielen (Haupt-/Fernbahnhöfe, Geschäfts- und Verwaltungszentren, Einkaufsstraßen u. a.) und die Verknüpfung der Innenstadt mit anderen Teilen des verdichteten Siedlungsbereichs, sodass Netze in ihren frühen Entwicklungsphasen häufig aus von der Innenstadt ausgehenden Radial- bzw. Transversallinien bestehen. Vorrangig in späteren Phasen wurden bzw. werden Tangential- und Ringlinien, die häufig außerhalb der engeren Innenstadt verlaufen und Querverbindungen zwischen den anderen Linien herstellen und so Reisewege und -zeiten verkürzen und innerstädtische Stationen vom Umsteigeverkehr entlasten, und Streckenverlängerungen in periphere Teile des Stadtgebiets, beispielsweise auch zur Anbindung der häufig am Rande des städtischen Siedlungsbereichs gelegenen Flughäfen, errichtet (siehe auch hier).
U-Bahn-Netze können in die unten dargestellten Grundtypen eingeteilt werden, wobei erkennbar ist, dass die verschiedenen Typologien aufeinander aufbauen bzw. Varianten und Kombinationen voneinander darstellen und die Auflistung daher weder exakt trennscharf noch zwingend abschließend ist. Entsprechend besteht ein Großteil der vorhandenen Netze aus Mischformen oder entwickelte sich – wie oben beschrieben – von einem Typus zu einem anderen oder zu einer Mischform weiter. Beispielsweise hat die Münchner U-Bahn ein Sekantennetz, dessen Strecken sich außerhalb des Stadtzentrums verzweigen, das Netz der New Yorker U-Bahn ist vor allem in den Bezirken Manhattan und Brooklyn stark vermascht, besteht jedoch auf gesamtstädtischer Ebene betrachtet vorwiegend aus Radialstrecken, die auf das übergeordneten Stadtzentrum in Manhattan ausgerichtet sind, und in Tokio löst sich ähnlich zu New York das hochgradig vermaschte Netz der inneren Bezirke in den äußeren Bezirken und ihrem Umland in Radialstrecken auf und verfügt mit der Ōedo Line zusätzlich über eine Ringstrecke, die die inneren Bezirke umschließt.
- Netztypen
Position und Funktion im öffentlichen Verkehrsnetz
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Nahverkehr
-
Wandsbek Markt, Hamburg: U-Bahnhof im Wandsbeker Bezirkszentrum und zentraler Busknoten im Hamburger Osten
-
Wien: Straßenbahnlinie mit Zubringerfunktion zur U-Bahn, in der Zielanzeige entsprechend mit dem U-Bahn-Logo signalisiert
U-Bahnen bilden innerhalb der städtischen Verkehrsnetze in der Regel das Verkehrsmittel mit der höchsten Beförderungskapazität und werden – insbesondere in einheitlich geplanten Verkehrsnetzen wie jenen der deutschen, österreichischen und schweizerischen Verkehrsverbünde – vorrangig für übergeordnete Verbindungs- und Erschließungsaufgaben eingesetzt, während Verkehrsmittel mit geringerer Kapazität (insbesondere Straßenbahn, Oberleitungsbus und Omnibus) vorrangig Zubringer- und Feinverteilerfunktionen sowie den Quartiersverkehr übernehmen. U-Bahn-Stationen sind daher häufig wichtige Knotenpunkte im städtischen Verkehrsnetz, auch zwischen den einzelnen Oberflächenverkehrsmitteln untereinander.
- Verknüpfung von Bahnhöfen
-
Die Londoner Fernbahnhöfe gruppieren sich um das Stadtzentrum mit den Bezirken Camden und City of Westminster und der City of London und werden auf der Schiene vorrangig durch die Underground verbunden
-
Die sieben Pariser Kopfbahnhöfe waren nach Stilllegung des Chemin de Fer de Petite Ceinture für den Personenverkehr 1934 und bis zum Bau des RER ab den 1960er Jahren innerstädtisch nur durch das Metronetz miteinander verbunden
In einigen Großstädten haben U-Bahnen bis in die Gegenwart Bedeutung für die Verknüpfung von Fernbahnhöfen, die vielfach als Kopfbahnhöfe am Rande der historischen Innenstädte liegen und untereinander über keine oder nur umwegige Eisenbahnverbindungen verfügen, so etwa in London und eingeschränkt in Paris als zwei der frühesten U-Bahn-Städte. Die U-Bahn ermöglicht hierdurch bei Fahrten, die einen Umstieg zwischen zwei Bahnhöfen erfordern, eine durchgehende Reisekette auf der Schiene – wenngleich mit mindestens einem zusätzlichen Umstieg und häufig ohne die Möglichkeit der Durchtarifierung. Zudem erheben einzelne Betreiber einen Zuschlag für die Mitnahme größerer Gepäckstücke. Beispielsweise in London führen diese gebrochenen Verkehre bzw. die fehlende Durchbindung des Vorortverkehrs in die Innenstadt zudem regelmäßig zu erheblichen Überlastungen der zentralen Abschnitte der Underground, da diese sowohl die in Richtung Innenstadt weiterreisenden als auch die zwischen den einzelnen Kopfbahnhöfen reisenden Fahrgäste aufnehmen muss.[47]
In den vier deutschen U-Bahn-Städten hat die U-Bahn insgesamt eine weniger große Bedeutung für die Verknüpfung der jeweils wichtigsten Regional- und Fernbahnhöfe, da diese überwiegend direkt miteinander verbunden sind. Lediglich die Nebenbahn Nürnberg Nordost–Gräfenberg wird im Personenverkehr nur durch die Nürnberger U-Bahn-Linie U2 mit dem restlichen deutschen Eisenbahnnetz verbunden. Vor diesem Hintergrund gelten Fernverkehrs-Fahrkarten nach dem Preissystem der Deutschen Bahn und Nahverkehrsfahrkarten gemäß Deutschlandtarif, sofern sie von oder zu einer Station auf der genannten Bahnstrecke ausgestellt wurden, im Rahmen einer Sonderregelung auch im innerstädtischen Transitverkehr auf der U2 zwischen Nürnberg Hbf und Nürnberg Nordost.
Netz- und Streckenplanung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Koordinierte Netzplanung

In der Frühzeit des U-Bahn-Baus erfolgte häufig ein organisches und nur begrenzt planvolles Wachstum der Netze aus einzelnen, isoliert und teilweise von konkurrierenden Privatunternehmen geplanten Strecken, die nach und nach zu größeren und komplexeren Netzen erweitert und verbunden wurden.[47][9][8] Gleichzeitig verabschiedete Paris als eine der frühesten U-Bahn-Städte der Welt bereits 1897 eine konsistente und abgestimmte Gesamtplanung für den Aufbau seines Métro-Netzes und realisierte auf dieser Grundlage zwischen 1898 und 1910 ein 65 Kilometer langes Grundnetz aus vier Durchmesser- und einer Ringstrecke.[107]
Spätestens mit der in vielen Teilen der Welt seit Beginn des 20. Jahrhunderts gewachsenen Bedeutung der Stadtplanung und der Verkehrsplanung als eigenständigen Disziplinen und als Aufgaben der öffentlichen Verwaltung und dem vielfach erfolgten Übergang von Planung, Bau, Eigentum und Betrieb öffentlicher Verkehrsmittel in die öffentliche Hand einschließlich der Kommunalisierung bestehender Netze setzte sich vielfach der Ansatz durch, die U-Bahn-Entwicklung auf Grundlage eines abgestimmten, mittel- bis langfristig angelegten Planwerks und mit Blick auf ein in diesem Planwerk definiertes Zielnetz zu verfolgen. Dies können sowohl Fachpläne wie ein Verkehrsentwicklungsplan (z. B. München)[228] als auch integrierte Pläne sein, beispielsweise enthält der Flächennutzungsplan des Landes Berlin seit 1994 eigenständige Darstellungen zu mittel- bis langfristig zu verfolgenden Ausbauvorhaben der U-Bahn-Netzes.[229][230][231]
Vorteile einer solchen koordinierten und längerfristig angelegten Planung können u. a. in einem effizienteren Einsatz von Mitteln und einer verbesserten Bauplanung liegen, indem beispielsweise im Zuge der Herstellung eines Streckentunnels oder eines Stationsbauwerks gleichzeitig Vorleistungen für ein später zu realisierendes Teilvorhaben erbracht werden, etwa Anschlusspunkte für weitere Streckentunnel oder zusätzliche Bahnsteige in einer Station. Auf diese Weise kann der später erforderliche Eingriff in das in Betrieb befindliche Bauwerk beim Anschluss einer neuen Strecke reduziert werden und Stationsbauwerke können von Anfang an in Hinblick auf direkte und komfortable Wegebeziehungen zwischen den Bahnsteigen der einzelnen Linien optimiert werden. Beispiele hierfür sind etwa die zahlreichen für eine mögliche Linie U10 in Berlin erbrachten Vorleistungen oder die zusätzlichen Bahnsteige an den Stationen Hauptbahnhof Nord, Jungfernstieg und Sengelmannstraße in Hamburg, die in Hinblick auf eine letztlich nicht zur Umsetzung gelangte Linie U4 angelegt wurden, später jedoch in die Planungen für die neue U4 und die Linie U5 integriert wurden.
- Streckenplanung

Die konkrete Entscheidung über Verlauf und Trassierung einer U-Bahn-Strecke sowie die anzuwendenden Bauverfahren erfolgt wie bei anderen infrastrukturbedeutsamen Vorhaben grundsätzlich im Rahmen einer komplexen, mehrstufigen planerisch-fachlichen Abwägung der betroffenen öffentlichen und privaten Belange. Der Umfang der hierbei einzustellenden Belange, die Tiefe der jeweiligen Betrachtung und die Gewichtung der ermittelten Belange gegen- und untereinander können sich dabei abhängig vom jeweils lokal einschlägigen Rechtsrahmen und politischen Zielsetzungen und Prioritäten unterscheiden.
In Deutschland fließen u. a. verkehrsplanerische (z. B. Erschließungswirkung, Bedienung relevanter Verkehrsrelationen, Verknüpfung mit dem weiteren ÖPNV-Netz und anderen Verkehrsträgern), betriebliche (z. B. Beförderungsgeschwindigkeit, Reisezeiten, Beförderungskapazität), konstruktive (z. B. minimaler Kurvenradius, maximale Steigung und Querneigung), wirtschaftliche (z. B. Grunderwerbs-, Bau-, Betriebs- und Unterhaltungskosten, verfügbare Förderkulissen), topographische und geologische (z. B. Beschaffenheit/Eignung des Bodens für den Tunnelbau, Grundwasserspiegel), infrastrukturelle und technisch-praktische (z. B. bestehende und geplante Bebauung, Ver- und Entsorgungsinfrastruktur und Verkehrswege einschließlich weiterer U-Bahn- und sonstiger Verkehrstunnel), städtebauliche und baukulturelle Belange, die Belange von Schutzgütern im Sinne der Umweltverträglichkeitsprüfung wie menschliche Gesundheit, Natur und Landschaft sowie Hinweise und Einwendungen der Öffentlichkeit in den Planungsprozess ein.[232][233][234][235]
Seit der Planung der ersten U-Bahn-Systeme stellt das bestehende Straßennetz einer Stadt eine zentrale Orientierung für die Streckenplanung dar, da dieses zum einen relevanten verkehrlichen Beziehungen entspricht und zum anderen der Bau von Strecken unter einer Straße als Unterpflasterbahn oder aufgeständert als Hochbahn darüber wesentlich einfacher – insbesondere unter Berücksichtigung der zum damaligen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Bauverfahren –, sicherer und nicht zuletzt kostengünstiger war als der Bau unter bestehender Bebauung. Gleichzeitig gibt es eine große Anzahl von Strecken, die unterhalb von Gebäuden verlaufen, um beispielsweise eine direktere Wegeführungen und hierdurch kürzere Tunnellängen und Fahrzeiten zu ermöglichen, oder bewusst keinen zum Zeitpunkt ihrer Planung etablierten bzw. vorrangigen Verkehrsbeziehungen folgen, um beispielsweise zuvor unterentwickelte, jedoch attraktive Tangentialverbindungen herzustellen und hierdurch neue Verknüpfungen zu schaffen und bestehende Korridore zu entlasten.
Linienreinheit und Linienbündelung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-
U-Bahn Wien: Netz mit linienreinem Betrieb
-
U-Bahn München: Netz mit Stamm- und Zweigstrecken
-
U-Bahn Tokio: Kernnetz (fette Linien) und Anschlussstrecken (dünne Linien)
U-Bahn-Strecken werden sowohl linienrein als auch mit gebündelten Linien betrieben. Linienrein bedeutet, dass eine Strecke ausschließlich durch eine Linie befahren wird und jede Linie über eine ihr vorbehaltene Strecke verfügt. Im erweiterten Sinne gehört hierzu auch, dass eine Strecke keine Äste hat, die jeweils von einem Teil der Kurse der auf der Hauptstrecke verkehrenden Linie bedient werden. Ausschließlich linienrein betriebene Netze finden sich u. a. in Lissabon, Montreal, Prag, Sapporo und Wien.
In Netzen mit gebündelten Linien werden demgegenüber dieselben Strecken von mehreren Linien befahren und Linien wechseln zwischen verschiedenen Strecken und ihren Ästen. Häufiges Beispiel hierfür sind Strecken, die sich stadtauswärts in mehrere Äste aufteilen. Teilweise überlagern sich dabei die Takte der einzelnen Linien sinnvoll und erlauben so eine gleichmäßige Bedienung des gemeinsamen Streckenabschnitts. Netze mit gebündelten Linien finden sich u. a. in Brüssel, Kopenhagen, London, New York und Stockholm, ferner sind Linienbündelung und der Wechsel zwischen verschiedenen Strecken charakteristisch für zahlreiche Straßenbahn- und S-Bahn-Netze.
Wesentliche Vorteile des linienreinen Betriebs sind der geringere Aufwand für die technische Sicherung und eine höhere Betriebsstabilität im Gesamtnetz, da Störungen auf einer Linie, etwa aufgrund eines liegengebliebenen Zuges, nicht auf andere Linien übertragen werden. Ein Vorteil in investiver Hinsicht kann im Verzicht auf kostenaufwändige und flächenintensive Überwerfungsbauwerke erkannt werden, die beispielsweise nach deutschem Recht für die Trennung von U-Bahn-Strecken erforderlich sind, da diese – anders als Straßenbahnstrecken – höhenfrei entflochten werden müssen.[5]
Gleichwohl verfügen auch ansonsten linienrein betriebene Netze teilweise über Verbindungen zwischen den einzelnen Strecken, um beispielsweise für alle Linien einen Zugang zu einer zentralen Betriebswerkstatt oder einem zentralen Depot herzustellen oder um abweichende Linienlaufwege bei Streckensperrungen zu ermöglichen.
- Wechselseitiger Betrieb mit anderen Bahnen
Eine besondere Form des gebündelten Betriebs ist die vor allem in verschiedenen japanischen Ballungsräumen praktizierte Durchbindung zwischen U-Bahnen und Vorort- bzw. S-Bahnen, bei dem Züge zwischen den Netzen verschiedener Betreiber wechseln. Zentrale Vorteile dieses wechselseitigen Betriebs sind die Schaffung umsteigefreier Verbindungen zwischen Region und Kernstadt, die effizientere Auslastung von Infrastruktur und die Möglichkeit, Betriebsanlagen wie U-Bahn-Depots auf günstigerem Bauland außerhalb der Kernstädte errichten zu können.
Der erste Vorschlag zur Einrichtung eines wechselseitigen Betriebs in Japan wurde 1956 für die Region Tokio vorgelegt, um die damals rapide wachsenden Vorstädte umsteigefrei mit den Zentren der Hauptstadt zu verbinden und die bisherigen stadtseitigen Endpunkte der Vorortbahnen vom Umsteigeverkehr zu entlasten. Der erste wechselseitige Betrieb wurde 1960 zwischen der Asakusa Line der Tokioter Toei und der Keisei Dentetsu aufgenommen, aktuell sind zehn der 13 Linien der Tokioter U-Bahn mit Vorortbahnen verknüpft, wodurch sich die Länge des U-Bahn-Netzes von 304,1 Kilometern (Netze von Tōkyō Metro und Toei) auf 926,5 Kilometer (Stand Mai 2016) erhöht. Weitere Betriebe dieser Art gibt es in Japan auf Strecken der U-Bahnen von Fukuoka, Kōbe, Kyoto, Nagoya und Osaka.[67]
Außerhalb Japans gibt es Durchbindungen von U-Bahn-Zügen auf andere Netze u. a. in verschiedenen chinesischen Systemen und im Raum Seoul, in Europa bei der Linie 3 der Athener U-Bahn, die in das Netz der Vorortbahn Proastiakos wechselt und über dieses den Athener Flughafen erreicht.
- Situation in Deutschland
Von den vier deutschen U-Bahn-Netzen wird aktuell keines ausschließlich linienrein betrieben:
- Berlin: Die Linien U1 und U3 teilen den Großteil ihrer Strecke (Wittenbergplatz – Warschauer Straße), nachdem die U3 im Jahr 2018 von ihrem bisherigen Endpunkt Nollendorfplatz auf der Strecke der U1 bis zur Warschauer Straße verlängert wurde.
- Hamburg: Die Linie U1 verfügt im Nordosten der Stadt über zwei Streckenäste und die Linien U2 und U4 befahren zwischen Billstedt und Jungfernstieg dieselbe Strecke.
- München: Das Netz verfügt im inneren Stadtbereich über drei Stammstrecken, an die sich jeweils mehrere Zweigstrecken anschließen und die jeweils von zwei Hauptlinien (U1+U2, U3+U6 und U4+U5) befahren werden. Hinzu kommen zwei Verstärkerlinien, die zwischen den Linienfamilien wechseln.
- Nürnberg: Die Linien U2 und U3 befahren zwischen Rathenauplatz und Rothenburger Straße dieselben Gleise.
Bedienungsfrequenz und Betriebszeiten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
U-Bahn-Linien verkehren in der Regel nach einem dichten Taktfahrplan mit Zugfolge-Zeiten im einstelligen Minutenbereich. Wie bei anderen öffentlichen Verkehrsmitteln wird die Taktung häufig nach Verkehrszeit, Wochentag und Bedienungsgebiet differenziert mit der höchsten Fahrplandichte während der werktäglichen Hauptverkehrszeiten in der Innenstadt und der geringsten Dichte am frühen Morgen und am späten Abend am Sonntag am Stadtrand.
Auf technischer Ebene wird die mögliche Taktdichte hauptsächlich durch die Steuerung und den Signal-Blockabstand begrenzt, wobei auf automatisch betriebenen Linien grundsätzlich höhere Taktdichten erreicht werden können. Auf der fahrerlos betriebenen Linie 14 der Pariser Métro wird ein Takt von bis zu 85 Sekunden erreicht,[236] in Moskau und Kiew von bis zu 90 Sekunden.[237][238] In Netzen mit sehr dichtem Takt wird in Fahrplänen teilweise auf die Angabe präziser Abfahrtszeiten verzichtet, stattdessen wird ein sogenannter Intervallfahrplan verwendet, der lediglich das Abfahrtsintervall ausweist (z. B. „alle 2 bis 3 Minuten“).
Längere eingleisige Abschnitte begrenzen ebenfalls die mögliche Taktfolge.
- Nächtliche Betriebspause und Nachtverkehr
Die meisten Systeme halten eine nächtliche Betriebspause ein, die u. a. für Inspektionen der Betriebsanlagen und Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten genutzt werden, die im laufenden Betrieb nur erschwert durchgeführt werden könnten bzw. mit Einschränkungen für diesen verbunden wären.
In verschiedenen Systemen wird ein durchgehender Nachtbetrieb durchgeführt, der sich jedoch mehrheitlich auf Wochenendnächte und teilweise zusätzlich auf Nächte vor Feiertagen beschränkt und teilweise nur für Teile des jeweiligen Netzes gilt. Zu den wenigen Städten weltweit, in denen ein täglicher 24-Stunden-Betrieb angeboten wird, zählen New York und Kopenhagen. In New York erlaubt der drei- und viergleisige Ausbau zahlreicher Streckenabschnitte (siehe hier) die Durchführung der oben genannten technischen Maßnahmen auch bei laufendem Betrieb.
Im deutschsprachigen Raum halten alle U-Bahnen wochentags eine nächtliche Betriebspause ein und bieten – mit Ausnahme Nürnbergs – einen Wochenendnachtverkehr an.
Betriebsschemata
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
In den meisten Netzen bedienen alle auf einer Strecke verkehrenden Kurse alle dort vorhandenen Stationen. Verbreitet sind zudem kurzlaufende Kurse, die z. B. als Verstärkerfahrten in der Hauptverkehrszeit nur besonders stark frequentierte Streckenabschnitte bedienen, bzw. Linien, auf denen nur ein bestimmter Anteil der Kurse die gesamte Länge der Strecke befährt.
Daneben gibt es in einzelnen Netzen zusätzliche Expresslinien, die die gleiche Strecke wie reguläre Linien befahren, jedoch nur eine reduzierte Anzahl von Stationen bedienen. Die zentrale infrastrukturelle Voraussetzung für den Expressbetrieb auf einer Strecke mit dichtem Taktverkehr ist ein entsprechender mehrgleisiger Ausbau oder mindestens die Einrichtung von Ausweich- und Überholstellen, um schnellere und langsamere Züge voneinander trennen bzw. aneinander vorbeileiten zu können.
Expresslinien (express services) werden traditionell auf zahlreichen Strecken der New Yorker U-Bahn und auf der Broad Street Line in Philadelphia betrieben. Linien, die an allen Stationen halten, werden demgegenüber als local services bezeichnet. Weiterhin wird die Purple Line der Chicago Elevated während der Hauptverkehrszeit als Express über ihren Regelendpunkt Howard hinaus auf der Strecke der Red Line und der Brown Line in die Innenstadt verlängert. Strecken, die von beiden Linienarten bedient werden, sind in den genannten Städten zu großen Teilen viergleisig ausgebaut mit jeweils zwei Gleisen für local und express services. In New York finden sich zudem dreigleisige Strecken mit einem einzelnen Expressgleis, das während der morgendlichen und nachmittäglichen Hauptverkehrszeit jeweils in Hauptlastrichtung befahren wird. In New York sind die Expressgleise zwischen den local-Gleisen angeordnet, von beiden Linientypen bediente Stationen verfügen vielfach über zwei Mittelbahnsteige und erlauben einen bahnsteiggleichen Umstieg zwischen Express- und local-Zügen in dieselbe Fahrtrichtung. Die Orange Line in Boston verfügt zwischen Wellington und dem Tunnelportal südlich von Community College ebenfalls über ein drittes Gleis für den Expressbetrieb, welches jedoch bislang nicht zu diesem Zweck genutzt wurde.
Ein ähnliches Betriebsschema ist das sogenannte Skip-stop, bei dem bestimmte Haltestellen entlang einer Strecke von aufeinander folgenden Kursen alternierend bedient werden. Ein Vorteil dieser Betriebsweise ist die Erhöhung der Beförderungsgeschwindigkeit ohne die Notwendigkeit des Baus zusätzlicher Infrastruktur, ein Nachteil die Reduzierung der Bedienungsfrequenz der einzelnen Stationen. Das Schema wurde früher u. a. in Chicago und bei der Market–Frankford Line in Philadelphia angewendet.[9][8]
Fahrordnung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Aufgrund der unabhängigen Trassierung kann die Fahrordnung, das heißt die Seite, auf der der Zug auf zweigleisigen Strecken fährt, von der Fahrordnung des Eisenbahnverkehrs und der im Straßenverkehr verwendeten Straßenseite in der jeweiligen Region abweichen. So verkehrte beispielsweise die Budapester U-Bahn noch bis 1973 im Linksverkehr, obwohl im Straßenverkehr des Landes bereits seit 1941 Rechtsverkehr galt.[239] Die Metro Rom wiederum fährt bis heute im Linksverkehr und orientiert sich damit an der Praxis des italienischen Eisenbahnverkehrs und nicht am Straßenverkehr. Die Pariser Metro hingegen fährt wie der Straßenverkehr in Frankreich rechts, während im französischen Eisenbahnverkehr der Linksfahrbetrieb vorherrscht. Daran wiederum orientiert sich die Métro Lyon, die ebenfalls links fährt. Die Metro Madrid verkehrt seit ihrer Eröffnung 1919 im Linksverkehr, der bis 1924 auch im madrilenischen Straßenverkehr galt, bis dieser an den im Rest Spaniens bereits seit 1918 geltenden Rechtsverkehr angeglichen wurde.
- Deutschland, Österreich und Schweiz
Die Netze in Deutschland, Österreich und der Schweiz werden jeweils im Rechtsverkehr betrieben, was der jeweiligen Regelung für den Straßenverkehr und in Deutschland der Regelung für die Eisenbahn entspricht, während beim Schienenverkehr in Österreich eine gemischte Fahrordnung und in der Schweiz grundsätzlich Linksbetrieb gilt.
Linienbezeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Liniensymbole verschiedener U-Bahn-Systeme
-
Metro Washington,
Red Line


U-Bahn-Systeme mit mehr als einer Linie verwenden in der Regel individuelle Kennfarben – beispielsweise für die Darstellung auf Liniennetzplänen – und Bezeichnungen zur Unterscheidung der einzelnen Laufwege. Bei der Mehrheit der Systeme werden als Bezeichnungen fortlaufende Nummern verwendet, teilweise mit einem Präfix wie „M“ oder „U“, das mit dem Namen des Systems korrespondiert. In geringerem Umfang werden Buchstaben (z. B. Almaty, Buenos Aires, Los Angeles, Lyon, Prag, Rom, Rotterdam, teilweise auch Madrid und New York), die Linienkennfarbe selbst (z. B. Boston, Chicago, Montreal, Washington, D.C.) oder individuelle Namen, die sich beispielsweise auf das Bedienungsgebiet (z. B. Moskau, Tokio, Toronto, teilweise London) oder Himmelsrichtungen (z. B. Fortaleza, Recife, historisch Budapest)[240] beziehen oder weitgehend frei gewählt sind (z. B. Lissabon, Pjöngjang (s. u.)), verwendet.
In Systemen, die fortlaufende Nummern oder Buchstaben verwenden, erfolgt die Vergabe nicht zwingend aufsteigend nach dem Zeitpunkt des Baubeginns oder der Inbetriebnahme, sondern beispielsweise auch nach einem Muster, das bereits während der Planung bestimmt wird und nicht zwingend der Reihenfolge der Realisierung entspricht; die erste Linie Münchens war die U6 und die Nummerierung in Wien weist seit 1989 eine Lücke zwischen U4 und U6 auf, die erst mit der für 2026 vorgesehenen Inbetriebnahme der U5 geschlossen wird.[241][242]
Einzelne Netze kombinieren die o. g. Systeme, z. B. tragen die Linien der U-Bahnen in New York, Tokio, Toronto jeweils eine Nummer bzw. in New York eine Nummer oder einen Buchstaben sowie einen vom Bedienungsgebiet abgeleiteten Namen, in Tokio wird als weiteres Kurzzeichen ein lateinischer Buchstabe verwendet, der bei den meisten Linien der Initiale des Liniennamens entspricht. Im komplexen New Yorker Netz gehen aus dem Namen sowie der Kennfarbe einer Linie zudem die von ihr befahrene Stammstrecke und das Betriebsschema als local oder express (siehe hier) hervor. Im in der Galerie gezeigten Beispiel A Eighth Avenue Express ist so erkennbar, dass die Linie zusammen mit den ebenfalls durch die Kennfarbe Blau gekennzeichneten Linien C Eight Avenue Local und E Eighth Avenue Local die Stammstrecke IND Eighth Avenue Line befährt und als Express verkehrt.
In einzelnen Netzen werden bestimmte Streckenäste als Neben- oder Ergänzungslinien anderer Linien behandelt und tragen eigene Bezeichnungen. In Moskau beispielsweise setzt sich die Große Ringlinie (ru. Большая кольцевая линия, Bolschaja Kolzewaja Linija) aus der Linie 11, die den gesamten Ring befährt, und der Linie 11A, die an der Station Choroschewskaja (ru. Хорошёвская) abzweigt und zum Büroquartier Moskau City verkehrt, zusammen. In Paris und historisch auch in Lille werden bzw. wurden Linien als bis-Linien nummeriert; in Paris die Linien 3bis und 7bis und in Lille die Linie 1bis, die später in der Linie 2 aufging. Das lateinische Wiederholungszahlwort bis bedeutet zweimal, 3bis beispielsweise entspricht damit dem deutschen 3a und ordnet die Linie der regulären Linie 3 zu. In New York werden die Expressvarianten der Linien 6, 7 und F abweichend vom ansonsten kreisförmigen Liniensymbol durch ein rautenförmiges Symbol gekennzeichnet, weshalb diese als diamond services (dt. Rautenlinien) bezeichnet werden. In Fließtexten, in denen das Symbol nicht verwendet wird, werden diese Linien mit <6>, <7> und <F> dargestellt.
In Systemen, die nur aus einer einzigen Linie bestehen, wird vielfach auf eine spezielle Linienbezeichnung verzichtet (z. B. Baltimore, Genua, Glasgow, Honolulu, San Juan), die Linie wird dann sinngemäß lediglich als die U-Bahn bezeichnet. Andere Systeme mit nur einer Linie verwenden Bezeichnungen nach den oben genannten Mustern, insbesondere, wenn weitere Linien geplant oder bereits im Bau sind (z. B. Almaty, Turin). In Budapest wurde für die erste Linie in Abgrenzung zu den Oberflächenverkehrsmitteln die Abkürzung FAV für Földalatti Vasút (dt. Untergrundbahn) verwendet. Die Bezeichnung wurde auch nach Inbetriebnahme der Kelet-Nyugati Vonal (dt. Ost-West-Linie, heute M2) 1970 und der Észak-Déli Vonal (dt. Nord-Süd-Linie, heute M3) 1976 beibehalten, erst 1978 erhielten die drei Linien ihre aktuellen Bezeichnungen.
Außergewöhnlich ist die Herleitung der Namen der Linien der Metro Pjöngjang, die sich – ebenso wie die Namen der Stationen (siehe hier) – auf die sozialistische Revolution, den Koreakrieg einschließlich seines aus nordkoreanischer Sichtweise als eigener Sieg verstandenen Endes[206] und den Wiederaufbau des Landes nach Ende des Kriegs beziehen; die Chŏllima-Linie verweist zunächst auf ein gleichnamiges geflügeltes Pferd aus der koreanischen Mythologie, das im spezifischen nordkoreanischen Kontext jedoch auch für eine 1958 initiierte, mit dem chinesischen Großen Sprung nach vorn vergleichbare Bewegung zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes steht.[243] Die Hyŏksin-Linie (dt. Erneuerung) verweist in diesem Sinne ebenfalls auf eine angestrebte und anzustrebende positive Entwicklung.
In einigen Netzen, in denen Fahrzeuge fest bestimmten Linien zugeordnet sind, werden die Linienkennfarben bei der Gestaltung der Wagen aufgegriffen (z. B. Delhi, Mailand und Tokio). Ebenso werden die Kennfarben in einigen Netzen bei der Stationsgestaltung aufgenommen, beispielsweise als Akzentfarben für die Stationsschilder und das Mobiliar. Mit besonderer Konsequenz wurde und wird dieses Prinzip in Wien angewendet.
- Deutschland, Österreich und Schweiz
Die fünf U-Bahn-Systeme im deutschsprachigen Raum unterscheiden ihre Linien einheitlich mit einem führenden „U“ und einer jeweils fortlaufenden Nummer. Als erster Betreiber führte die Hamburger Hochbahn das System am 22. Mai 1966 ein.[244] Die 1971 und 1972 eröffneten Netze in München und Nürnberg verwendeten es von Anfang an, in Wien wurde es mit Eröffnung der zweiten Linie im Jahr 1978 eingeführt. Die Berliner Verkehrsbetriebe führten das System 1984 in West-Berlin nach Übernahme des Betriebs der dortigen S-Bahn-Linien ein; sie hatten allerdings bereits seit März 1966 Liniennummern verwendet, die die vorherigen Buchstaben (A bis E sowie G) ersetzten. Die Ost-Berliner Verkehrsbetriebe BVB nutzten für die beiden von ihr betriebenen U-Bahn-Linien zunächst die historischen Bezeichnungen A und E weiter, gaben dies jedoch mit dem Bau der Berliner Mauer auf und unterschieden die Linien nur noch nach ihren Endpunkten (zuletzt Pankow (Vinetastraße) – Otto-Grotewohl-Straße, historisch Linie A, heute Teil der U2; Alexanderplatz – Hönow, historisch Linie E, heute Teil der U5).[20]
Weiterhin verwenden auch die Stadtbahnsysteme in Frankfurt (seit 1978) und Stuttgart (seit 1989) sowie die Teilnetze der Stadtbahn Rhein-Ruhr (seit 1988) ein führendes „U“ mit fortlaufender Nummer, in Bonn wurde dieses System von 1975 bis 1988 genutzt.
Die Métro Lausanne in der französischsprachigen Schweiz verwendet ein führendes „M“ und eine fortlaufende Nummer.
Zugbegleiter, Stationspersonal und Abfertigung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-
Fahrscheinkontrolle beim Einstieg in Oslo
-
Passenger Service Agent der DLR bei manueller Steuerung eines Zuges
-
Kombinierte Monitor- und Spiegelabfertigung in München
-
Selbstabfertigung bei einem Zug der Baureihe DT1 in Nürnberg mit Türschließknopf an der Außenseite
Zahlreiche U-Bahn-Betreiber verzichten auf die ständige Präsenz von Zugbegleitern in den Fahrzeugen sowie Aufsichtspersonal auf den Stationen, das neben der allgemeinen Aufsicht z. B. die Zugabfertigung durchführt, Durchsagen macht oder zur Unterstützung der Fahrgäste zur Verfügung steht. Vielfach werden lediglich besonders hochfrequentierte Stationen durchgehend mit Personal besetzt, um dort die Sicherheit der Betriebsabläufe zu gewährleisten und zu unterstützen, Ausnahmen sind z. B. die London Underground und die Metro Pjöngjang, bei denen jede Station durchgehend mit mehreren Mitarbeitern besetzt ist.
In zahlreichen Systemen wird zudem anlassbezogen Personal in Präsenz eingesetzt, etwa an Stationen, die dem Veranstaltungsverkehr (Sportstadien, Volksfeste, Messen usw.) dienen und punktuell sehr große Fahrgastmengen bewältigen müssen. Eine Sonderform hiervon ist das u. a. aus Japan bekannte und dort umgangssprachlich Oshiya (dt. Drücker) genannte Personal, das während der Hauptverkehrszeit Fahrgäste in die Züge drückt, um die vorgesehenen Fahrgastwechselzeiten und damit die Pünktlichkeit einzuhalten.
In fahrerlos betriebenen Systemen wie der Londoner Docklands Light Railway werden teilweise Zugbegleiter eingesetzt, deren Aufgaben sich im regulären Betrieb etwa auf die Überwachung der Türschließung, Durchsagen und die Fahrscheinkontrolle beschränken, die jedoch bei Ausfällen des automatischen Systems die Züge manuell steuern können.
Eine wesentliche Aufgabe bei der Zugabfertigung besteht in der Prüfung, dass keine Personen durch das Schließen der Türen und die Abfahrt des Zuges gefährdet werden. Aufgrund des weitgehenden Verzichts auf Stationspersonal und Zugbegleiter erfolgt die Abfertigung überwiegend durch die Fahrer selbst, wobei verschiedene Systeme verwendet werden, um dem Fahrer einen Überblick über den Bahnsteig zu geben. Hierzu gehören insbesondere ortsfeste Spiegel am vorderen Bahnsteigende (Spiegelabfertigung), Videomonitore am Bahnsteigende oder im Fahrerraum (Monitor-/Videoabfertigung) oder der direkte Blick des Fahrers auf den Bahnsteig, wozu dieser das Fahrzeug ggf. verlassen muss. Bei fahrerlosen Systemen erfolgt die Abfertigung oftmals per Videoüberwachung von der Leitstelle aus.
Sicherheit, Kriminalitäts- und Vandalismusprävention
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-
Gedränge auf dem Bahnsteig der Station Navy Yard, Washington, D. C.
-
Wagen der Metrô Rio, der während der Hauptverkehrszeiten Frauen vorbehalten ist
-
Innenraum eines Zuges der New York City Subway, 1973
-
Graffiti auf einem Zug der U-Bahn Rom, 2012
-
Folierte Fenster als Schutz gegen Scratching bei der Berliner U-Bahn
-
Mitarbeiter des Polizeidienstes der Metro Washington
- Terrorismus
Aufgrund der großen Anzahl von Nutzern und den insbesondere in den Zügen begrenzten Fluchtmöglichkeiten sowie der Bedeutung für das städtische Verkehrsnetz stellen U-Bahnen ein potenziell reichweitenstarkes und zudem einfach zugängliches Ziel für terroristische Anschläge dar. Zu den bekannt gewordenen Zwischenfällen zählen der von der sogenannten Aum-Sekte verübte Saringas-Anschlag von Tokio im März 1995, die von islamistischen Selbstmordattentätern durchgeführten Sprengstoffanschläge von London im Juli 2005, die tschetschenischen Separatisten zugeschriebenen Sprengstoffanschläge von Moskau im März 2010 und die ebenfalls von islamistischen Selbstmordattentätern durchgeführten Anschläge von Brüssel im März 2016.
- Kleinkriminalität und sexuelle Belästigung
Aufgrund des bei hohem Fahrgastaufkommen auftretenden Gedränges und der hiermit verbundenen Unübersichtlichkeit auf den Stationen und in den Zügen können U-Bahnen ein geeignetes Umfeld für Taschendiebstahl und sexuelle Belästigung in Form des unerwünschten sexuell konnotierten Berührtwerdens durch andere Fahrgäste (vgl. Frotteur, Chikan) bieten. Da das letztgenannte Phänomen insbesondere Frauen als Opfer und Männer als Täter betrifft, haben verschiedene Betreiber hierauf mit der Einrichtung reiner Frauenwagen oder Frauenabteile reagiert, durch die sich Frauen der Gefahr einer Belästigung durch Männer entziehen können. Häufig gilt diese Trennung jedoch nur für die Hauptverkehrszeiten.
- Umgang mit marginalisierten Gruppen
Da U-Bahn-Stationen witterungsgeschützt und über weite Teile des Tages offen zugänglich sind, in Systemen mit Nachtbetrieb auch durchgehend, werden sie teilweise von Angehörigen bestimmter marginalisierter Gruppen wie Obdachlosen und Drogenabhängigen zum Aufenthalt und auch zur Übernachtung genutzt. Ebenso eignen sich Stationen und Züge aufgrund der zahlreichen Ansprachemöglichkeiten zum Betteln. Unabhängig davon, ob der Aufenthalt, das Verhalten oder konkrete Handlungen der genannten Gruppen im Einzelfall tatsächlich illegal sind bzw. der Hausordnung oder den Beförderungsbedingungen des Betreibers widersprechen, empfinden Fahrgäste bereits ihre wahrnehmbare Präsenz teilweise als störend bis bedrohlich. Der Umgang hiermit variiert zwischen den einzelnen Betreibern und abhängig von der jeweils konkret vorliegenden Situation und reicht von einer gewissen Toleranz, solange beispielsweise keine Ansprache von Fahrgästen und kein offener Drogenkonsum erfolgen, bis zur grundsätzlichen Entfernung der betroffenen Gruppen aus den Anlagen durch Aufsichts- und Sicherheitspersonal sowie ggf. durch die Polizei. Auf baulicher Ebene wird dem Phänomen teilweise mit Maßnahmen aus dem Bereich der defensiven Architektur begegnet, beispielsweise durch die Verwendung von Sitzmöbeln, die durch ihre Größe oder Formgebung kein Liegen ermöglichen und daher nicht bzw. nur erschwert zum Schlafen genutzt werden können. Ebenso können Bahnsteigkarten und Bahnsteigsperren, die bei U-Bahnen außerhalb des deutschsprachigen Raums weitverbreitet sind, die Präsenz der genannten Gruppen regulieren.
- Vandalismus
Ausgehend von der New Yorker U-Bahn der 1970er Jahre und teilweise beeinflusst von Darstellungen in Filmen wie Wild Style! (1982) und Beat Street (1984), die in der amerikanischen Hip-Hop- und Breaking-Szene spielen, verbreiteten sich Graffiti und später auch Scratching in zahlreichen U-Bahn-Systeme auf der Welt. Rechtlich stellen diese eine Sachbeschädigung (vgl. Bahnfrevel) dar und stellen erhöhte Anforderungen an Pflege und Erhalt von Stationen und Fahrzeugen. Zudem kann ein erkennbar von Vandalismus belastetes Erscheinungsbild von den Fahrgästen als Ausdruck von Vernachlässigung und/oder fehlender Aufmerksamkeit auf Seiten des Betreibers interpretiert werden und so das Sicherheitsempfinden und damit die Attraktivität eines Systems insgesamt beeinträchtigen (vgl. Broken-Windows-Theorie). Als Maßnahmen gegen Scratching und Graffiti an und in Zügen werden Fenster teilweise mit kratzfesten und austauschbaren Spezialfolien als Opferschicht ausgestattet und Sitzbezüge werden mit speziellen, kleinteilig-chaotischen Mustern gestaltet, auf denen z. B. Tags weniger auffallen und die daher weniger attraktiv für deren Anbringung sind.
- Sicherheitsmaßnahmen
Aufgrund der genannten Aspekte ist in zahlreichen Systemen mittlerweile die Videoüberwachung von Stationen und Fahrzeugen verbreitet, um potenzielle Täter abzuschrecken, unzulässige Handlungen möglichst frühzeitig zu erkennen und im Falle eines Delikts die Strafverfolgung zu unterstützen. Weiterhin rufen zahlreiche Betreiber ihre Fahrgäste durch Maßnahmen wie Durchsagen und Plakatkampagnen zur Meldung auffälliger bzw. verdächtiger Verhaltensweisen anderer Personen und zur Meldung unbeaufsichtigten Gepäcks oder verdächtiger Objekte auf. Teilweise stehen auf Stationen auch Notruftelefone zur Verfügung.
Weiterhin unterhalten zahlreiche Betreiber eigene bzw. organisatorisch eng an sie angebundene Sicherheitsdienste (z. B. Hochbahn-Wache in Hamburg, U-Bahnwache in München) oder – abhängig von der jeweiligen lokalen Rechts- und Verwaltungstradition – eigene Polizeidienste (z. B. die MBTA Transit Police der Bostoner Verkehrsbetriebe oder das Metro Transit Police Department der Washingtoner Verkehrsbetriebe) oder werden durch beauftragte externe Sicherheitsdienste oder spezielle Abteilungen der lokalen und nationalen Polizeibehörden (z. B. das Transit Bureau des NYPD in New York, die Section métro der SPVM in Montreal oder die u. a. für die London Underground zuständige British Transport Police) unterstützt.
- Sicherheitsmaßnahmen in Peking
Besonders weitreichende Sicherheitsvorkehrungen kommen in Peking zur Anwendung, wo in allen Stationen vor dem Zutritt Taschen, Gepäckstücke und andere Objekte, mit denen gefährliche Gegenstände wie Schuss- und Stichwaffen verborgen werden können, mit einem Gepäckscanner überprüft werden. An einer Reihe von Stationen werden zusätzlich Körperscanner zur Überprüfung der Fahrgäste eingesetzt. Zudem können für verdächtig befundene Getränkeflaschen separat überprüft werden, entweder maschinell oder indem der Besitzer unter Aufsicht des Sicherheitspersonal etwas vom Inhalt verzehren muss, um dessen Unbedenklichkeit zu demonstrieren. Die Maßnahmen wurden im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele 2008, die in Peking ausgerichtet wurden, eingeführt und danach beibehalten. Der Einsatz von Körperscannern war dabei zunächst auf die Stationen der Linie 1 im Umfeld des Tian’anmen-Platzes (Xidan, Tian'anmenxi und Tian'anmendong), für den aufgrund seiner politischen, historischen und symbolischen Bedeutung grundsätzlich erhöhte Sicherheitsvorkehrungen gelten, beschränkt und wurde dann ab dem Frühjahr 2014 zunächst versuchsweise auf andere Stationen ausgeweitet.[245] 2016 wurden Körperscanner an 51 Stationen des Netzes eingesetzt.[246]
Ersatzverkehr
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-
Zusatzlinie M2A in Budapest, betrieben mit Oberleitungsbussen im Hilfsantriebsmodus, während der Schließung der Station Kossuth Lajos tér der Linie M2, 2018
Wie andere Schienenverkehrsmittel werden auch U-Bahn-Linien bei größeren Störungen oder Bauarbeiten häufig abschnittsweise oder vollständig im Ersatzverkehr betrieben. Hierbei werden je nach Betreiber bzw. lokalem Nahverkehrsnetz Omnibusse und/oder Taxen im Schienenersatzverkehr oder aber Straßenbahn-Sonderlinien eingesetzt. Der Ersatzverkehr kann dabei auch nur für einzelne U-Bahn-Stationen erfolgen, während diese saniert oder umgebaut werden. In diesem Fall pendelt der Ersatzverkehr nur zwischen der geschlossenen und einer regulär bedienten Nachbarstation.
In entsprechend verzweigten Systemen mit Linienüberlagerung werden U-Bahn-Linien auch zeitweise geändert und bedienen dann Relationen im Baustellenverkehr, welche normalerweise nicht angeboten werden. Ein Beispiel hierfür ist die immer wieder temporär auftauchende Berliner U12.
Straßenbahnvorlaufbetrieb
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mitunter werden Teilabschnitte bereits einige Jahre vor ihrer Integration in das U-Bahn-Netz im sogenannten Straßenbahnvorlaufbetrieb befahren. So wurde beispielsweise der Teilabschnitt Karlsplatz–Schottenring der 1980 eröffneten Wiener Linie U2 bereits ab 1966 durch die U-Straßenbahn bedient. Gleiches gilt für die Strecken nach Siebenhirten (1979 eröffnet als Straßenbahnlinie 64, seit 1995 U6) und nach Oberlaa (1974 eröffnet als Straßenbahnlinie 67, seit 2017 U1). In Nürnberg wiederum gingen die beiden Hochbahn-Stationen Muggenhof und Stadtgrenze schon 1970 als Teil des Straßenbahnnetzes in Betrieb, während die U-Bahn dort erst seit 1982 verkehrt. Aus diesem Grund besitzen sie als einzige Nürnberger U-Bahn-Stationen Außenbahnsteige. In München wiederum wurde die 1962 eröffnete Schnellstraßenbahn-Strecke Frankfurter Ring – Edisonstraße – Harnierplatz – Freimanner Platz in das 1971 eröffnete U-Bahn-Netz integriert. Hierbei entfielen Frankfurter Ring und Freimanner Platz gänzlich, die beiden mittleren Haltestellen wurden zum neuen U-Bahnhof Freimann zusammengefasst.
Architektur und Kunst
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-
Zugangsbauwerk zum U-Bahnhof Ploschtschad Wosstanija, Sankt Petersburg
-
In ein Wohnhaus integrierter Eingang zur Station Mariatorget, Stockholm
Wie Bahnhofsgebäude der Eisenbahn bilden die Zugangsbauwerke zu U-Bahn-Stationen die Schnittstelle zwischen öffentlichem Raum und Verkehrsmittel und sind häufig das erste Element eines U-Bahn-Systems, mit dem Fahrgäste in Kontakt kommen. Ihre städtebauliche und hochbauliche Gestaltung spielt daher eine wesentliche Rolle für die Präsenz und Außenwirkung des Verkehrsmittels. Entsprechend der unterschiedlichen Trassenführungen bilden sich Stationen grundsätzlich unterschiedlich prominent im Stadtraum ab. Während Stationen an oberirdischen und insbesondere in Hochlage geführten Strecken notwendigerweise größere Präsenz haben, reichen die Zugänge zu Tunnelstationen von einfachen Treppenabgängen über kleinere, pavillonartige Gebäude bis zu aufwändigen und selbstbewusst inszenierten Verkehrsbauwerken oder können auch in andere Gebäude integriert werden.
Die konkrete architektonische, künstlerische und dekorative Ausgestaltung spiegelt wie andere Bauaufgaben die stilistischen Moden und Geschmackstendenzen, den Stand von Bautechnik und Baukonstruktion, die spezifischen praktischen, technischen und sicherheitsbezogenen Erfordernisse der Nutzung und nicht zuletzt die finanziellen Möglichkeiten und Prioritäten und das Selbstverständnis des Vorhabenträgers einschließlich seines ggf. vorhandenen politischen und/oder ideologischen Sendungsbewusstseins zur jeweiligen Entstehungszeit und am jeweiligen Entstehungsort wider. Im Falle von U-Bahn-Stationen stellen insbesondere Robustheit und Pflegeleichtigkeit häufig zentrale Anforderungen an den Entwurf dar, um Betriebs-, Instandhaltungs- und Erneuerungskosten trotz der intensiven Frequentierung der Anlagen gering zu halten.
Das vielfältige Spektrum der Entwürfe reicht entsprechend von schlichten, betont sachlichen Entwürfen, die ausschließlich auf standardisierte Baumaterialien und Elemente zurückgreifen, bis zu reichhaltig und komplex ausgestalteten Stationen mit individuell angefertigten Bauteilen und aufwändigen Einzellösungen.
Einzelne Netze besitzen besondere Bekanntheit für die Gestaltung ihrer Stationen bzw. behandeln einzelne Betreiber die Ausgestaltung von Stationen mit besonderer Aufmerksamkeit. Weiterhin können weltweit bestimmte wiederkehrende Ansatzpunkte für Gestaltungen identifiziert werden, wobei diese häufig kombiniert werden bzw. Entwürfe mehrere der nachfolgend genannten Merkmale erfüllen können, die stellvertretend für die erhebliche Vielfalt von Stationsgestaltungen stehen.
Repräsentation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-
Bülowstraße, Berlin (1902):
Jugendstil-Hochbahnhof, vereinfachter Wiederaufbau nach Kriegsschaden
Entwurf: Bruno Möhring -
L'Enfant Plaza, Washington, D.C. (1977):
Brutalistisches Kassettengewölbe mit komplexem Licht- und Schattenspiel
Entwurf: Harry Weese -
Canary Wharf, London (1999)
Visuelle Erweiterung des Stationsraums in den metropolitanen Stadtraum
Entwurf: Foster + Partners
Ähnlich wie Bahnhöfe der Eisenbahn wurden und werden U-Bahn-Stationen teilweise mit dezidiert repräsentativem Anspruch entworfen, wobei zwischen den stadtbildwirksamen Aspekten Städtebau und Hochbau und der vorrangig für Fahrgäste sichtbaren Innenraumgestaltung zu unterscheiden ist.
Der Wunsch nach Repräsentation kann sich beispielsweise aus der politischen, gesellschaftlichen, kulturellen oder historischen Bedeutung des Stationsstandortes (Rathaus, Parlament, zentrale Sakralbauten, zentrale Innenstadtlagen u. a.) und/oder der besonders wertvollen baulichen Prägung des Stationsumfeldes, einer besonderen Öffentlichkeitsreichweite bzw. Visitenkartenfunktion für die Stadt (Messe- und Kongresszentren, zentrale Sehenswürdigkeiten, Hauptbahnhöfe, Flughäfen u. a.), einer besonderen städtebaulichen Exponiertheit und Stadtbildwirksamkeit oder aus dem Selbstverständnis des Betreibers ergeben. Die genannten Aspekte sind allerdings keineswegs zwingend und so finden sich auch in den genannten Situationen vielfach rein funktionsorientierte Entwürfe ohne überdurchschnittlichen gestalterischen Anspruch.
Die zur Erzeugung des repräsentativen Charakters gewählten gestalterischen Mittel spiegeln das zeitgenössische und lokale Verständnis von Repräsentation sowie die jeweils populären Architekturstile wider und zeigen eine entsprechende Bandbreite und Vielgestaltigkeit. Sie sind daher in der beabsichtigten Wirkung nicht zwingend universell verständlich bzw. können abhängig von Prägung und Vorwissen und nicht zuletzt vom persönlichen ästhetischen Empfinden des Betrachters unterschiedlich bewertet werden. Während sich beispielsweise die Repräsentation in einem Entwurf des Historismus oder des Jugendstils in der Reichhaltigkeit des Dekorprogramms und ggf. der Erlesenheit der Baumaterialien ausdrückte, waren spätere Entwürfe u. a. von der häufig sachlicheren Haltung der unterschiedlichen Strömungen der Moderne, der technoiden Komplexität von High-Tech-Architektur, der Verspieltheit und Detailliertheit der Postmoderne, der asketischen Klarheit des Minimalismus oder den experimentellen und extravaganten Formen des Dekonstruktivismus und Neo-Futurismus gekennzeichnet und entwickelten innerhalb dieser Stile eigene repräsentativ verstandene bzw. gemeinte Merkmale.
Ein häufiger eingesetztes Mittel ist eine besonders großzügige, teilweise über die unmittelbaren praktischen und technischen Erfordernisse hinausgehende Dimensionierung, sowohl durch Überhöhung und Inszenierung der Vertikalen, die in zahlreichen Kulturen traditionell als Ausdruck weltlicher Herrschaft und religiöser und spiritueller Erhabenheit (Paläste, Kathedralen, Moscheen u. a.) eingesetzt bzw. interpretiert wird und auch im Kontext anderer Bauaufgaben eine ähnliche Wirkung erzeugt, als auch der Horizontalen, um einen Eindruck besonderer Großzügigkeit zu schaffen.[247]
- Paläste der Arbeiterklasse
-
Elektrosawodskaja, Moskau (1944)
-
Komsomolskaja, Moskau (1952)
-
Nowoslobodskaja, Moskau (1952)
-
Arbatskaja, Moskau (1953)
-
Awtowo, Sankt Petersburg (1955)
-
Kosmonavtlar, Taschkent (1984)
Zu den für ihre Gestaltung besonders bekannten Stationen zählen die in opulentem Sozialistischem Klassizismus ausgestalteten frühen Haltestellen der Moskauer Metro, die mit kostbaren Materialien wie Marmor und einem reichhaltigen Dekorprogramm mit Plastiken, Stuck- und Reliefarbeiten, Malereien, Mosaiken, Glasmalereiarbeiten und Einbauten wie Wand- und Kronleuchtern ausgestattet sind. Ein großer Teil der dekorativen und baukünstlerischen Elemente greift dabei Symbole des Sozialismus und Kommunismus bzw. der Arbeiterbewegung (z. B. Hammer und Sichel, rote Sterne, rote Fahnen, Ährenbündel und landwirtschaftliches Gerät als Verweis auf die Bauernklasse sowie wirtschaftliches und gesellschaftliches Gedeihen und Zahnräder, Werkzeuge und Maschinen als Verweis auf die Arbeiterklasse sowie technischen Fortschritt) auf und zeigt Darstellungen von Bauern und Werktätigen bei ihren jeweiligen Tätigkeiten.
Die Prachtentfaltung diente hier der Veranschaulichung und Versicherung des unter dem und durch den Sozialismus erreichten Wohlstandes sowohl gegenüber der eigenen Bevölkerung als auch gegenüber Besuchern. Zudem entsprachen die reichhaltige Dekorierung und die Wiederaufnahme historisierender Motive einer allgemeinen Entwicklungstendenz der Architektur der 1930er Jahre, die sich parallel und teilweise als Gegenbewegung zur Moderne u. a. auch im Deutschen Reich und in den Vereinigten Staaten vollzog.[248]
Nach Moskauer Vorbild wurden Haltestellen der U-Bahnen anderer Städte der Sowjetunion und anderer sozialistisch geführter Länder ebenfalls aufwändig ausgestaltet. Insbesondere die anderen frühen sowjetischen Metro-Städte Kiew und St. Petersburg orientierten sich eng an den reichhaltigen Entwürfen Moskaus. Gleichzeitig lösten sich die Entwürfe der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gebauten Stationen sowohl in Moskau als auch in anderen Städten vielfach vom ausladenden historisierenden Repertoire, wurden deutlich schlichter und reflektierten zu unterschiedlichen Graden die allgemeine Fortentwicklung der Architektur und suchten u. a. in modernen und postmodernen Formen nach Originalität und Ausdrücken von Repräsentativität abseits tradierter Symbole und Gesten, adaptierten aber auch lokale Bautraditionen und folkloristische Motive.
Beispielsweise thematisiert die Haltestelle Kosmonavtlar (dt.: Kosmonauten) in Taschkent durch tiefe Blautöne und schimmernde Oberflächen, die an das Nachtfirmament erinnern, und großformatige Medaillons mit Darstellungen von u. a. Juri Gagarin und Walentina Tereschkowa den Weltraum und die Raumfahrt und verweist so auf die Rolle der Sowjetunion im sogenannten Wettlauf ins All, während Pfeiler und Deckenform der Stationen Alisher Navoiy, Mustaqillik Maydoni und Turkiston an traditionelle Formen der islamischen Architektur des historisch muslimisch geprägten Usbekistans erinnern.
Weiterhin ist festzuhalten, dass zu allen Zeiten und in allen Netzen der Sowjetunion und anderer sozialistischer Staaten auch eine Vielzahl von Stationen vorrangig funktionsbetont entworfen wurden und sich die besonders aufwändigen Entwürfe vorrangig auf innerstädtische oder aus anderen Gründen herausgehobene Standorte beschränkten.
Standardisierte Entwürfe/Architektur als Erkennungszeichen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-
Einer der Standardtypen der Zugangspavillons der Wiener Stadtbahn, heute Teil der Linien U4 und U6
Entwurf: Otto Wagner -
Typischer Abgang zu einer Station der New York City Subway mit grünem Geländer und Kugelleuchten
-
Typischer Abgang einer innerstädtischen Station der Linie M2 der Metro Warschau mit gefaltetem, M-förmigem Dach
-
Oxford Circus, London;
typischer Entwurf von Leslie Green, hier mit ergänzender Büronutzung in den weiteren Obergeschossen -
Sudbury Town, London;
typischer Entwurf von Charles Holden, errichtet 1931 als Klinkerbau mit starken Bezügen zur Neuen Sachlichkeit
Empfangsgebäude und Zugangsbauwerke von U-Bahn-Stationen sind in der Regel mit dem Logo des jeweiligen Systems gekennzeichnet (siehe auch hier) und so als Teil des U-Bahn-Systems erkennbar. In einigen Netzen dienen jedoch auch die Bauwerke selbst durch ihr charakteristisches und wiedererkennbares Aussehen und ihre Verwendung an mehreren Standorten als Symbol für ein System bzw. können auch ohne Markierung durch ein Logo o. ä. als U-Bahn-Bauwerk identifiziert werden und sich darüber durch ihre starke Präsenz auch zu einem Wahrzeichen für die jeweilige Stadt insgesamt entwickeln. Es kann sich hierbei sowohl um einen konkreten Bautyp handeln, der an mehreren Stationen identisch realisiert wird, als auch um bestimmte einheitliche gestalterische Prinzipien und Elemente, die auf unterschiedliche Entwürfe und Entwurfssituationen angewendet werden und hierdurch einen gestalterischen Zusammenhang zwischen den einzelnen Bauwerken schaffen.
Beispiele für einheitliche Bautypen sind die von Hector Guimard in fließenden Art-Nouveau-Formen entworfenen Zugänge der Métro Paris, die ursprünglich nur an den Stationen der Interborough Rapid Transit Company verwendeten und später in weitere Teile des Netzes übertragenen grünen Geländer und Kugelleuchten der New York City Subway, die postmodernen Überdachungen der Zugänge der Metro Bilbao, die in Anlehnung an das verantwortliche Architekturbüro Foster + Partners lokal umgangssprachlich als Fosteritos (dt. sinngemäß „Kleiner Foster“, „Fosterchen“) bezeichnet werden,[65] und die zu einer M-Form gefalteten Glasdächer der Zugänge der innerstädtischen Stationen der Linie M2 der Metro Warschau, die durch Aufnahme des Hauptfarbtons der Innenraumgestaltung der jeweiligen Station individualisiert werden.
Verschiedene Architekten der London Underground entwickelten einheitliche Gestaltungskonzepte, die sie in einer großen Zahl von Entwürfen umsetzten und die die äußere Gestalt des Systems bis in die Gegenwart prägen. Hierzu gehören beispielsweise Leslie Green, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts zahlreiche Entwürfe für Stationen der heutigen Bakerloo, Northern und Piccadilly Line erarbeitete, und Charles Holden, der in den 1920er und 1930er Jahren u. a. zahlreiche Stationen der Piccadilly Line gestaltete. Greens relativ dekorativ geprägtes Konzept war von der Arts-and-Crafts-Bewegung beeinflusst und sah einen zweigeschossigen Baukörper mit durch Pilaster und Gesimsbänder plastisch gegliederter Fassade aus ochsenblutroten, glasierten Terrakottafliesen vor, das Obergeschoss wird durch große, gesprosste Bogenfenster und Details wie Ochsenaugen gegliedert, den oberen Gebäudeabschluss bildet ein Geison mit Zahnschnittfries. Holdens rund 20 Jahre später entstandene Entwürfe spiegeln demgegenüber die modernistischen Strömungen der Zeit wider und weisen in ihrer formalen Klarheit und Reduziertheit und den weitestgehenden Verzicht auf Dekoration abseits des Underground-Logos vor allem deutliche Einflüsse der kontinentaleuropäischen Neuen Sachlichkeit und ihrer verwandten Strömungen auf, die Holden im Jahr 1930 auf einer Studienreise durch Deutschland, die Niederlande, Dänemark und Schweden näher kennengelernt hatte;[249] die Entwürfe zeigen schlichte, vorwiegend aus kubischen Volumen entwickelte Baukörper mit flächiger, meist rötlicher Backsteinfassade, die lediglich durch großformatige, vertikale Fensterbänder gegliedert werden. Den oberen Abschluss bildete ein in Beton ausgeführtes, auskragendes Flachdach mit darunter liegendem Gesimsband.
Referenz an den Stationsstandort
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Stationsgebäude
-
Tian-anmen East, Eingang B, Peking:
Anlehnung an traditionelle chinesische Architektur vor der Verbotenen Stadt -
Asakusa, Eingang zur Ginza Line, Tokio:
Anlehnung an japanische Tempel- und Schreinarchitektur als Verweis auf den nahe gelegenen Sensō-ji -
Times Square-42nd Street, New York;
Anklänge an Googie und Postmoderne fügen die Station in die schillernde Kulisse des Times Square ein
Ein grundsätzlicher Gestaltungsansatz ist die Anpassung an den städtebaulichen und hochbaulichen Gebietskontext durch Aufnahme kennzeichnender Merkmale aus dem Stationsumfeld. Hierbei kann unterschieden werden zwischen einem mimetischen Ansatz, bei dem durch Übernahme konkreter Architekturmerkmale, Gestaltungselemente und Material- und Farbthemen eine möglichst präzise formale Einfügung verfolgt wird, und der freieren Adaption des Genius Loci, die eher auf eine allgemeine ästhetische und thematische Anpassung an die Umgebung abzielt. Gleichwohl kann die Grenze zwischen beiden Ansätzen fließend sein.
- Innenraum
Die Innenraumgestaltung zahlreicher Stationen nimmt durch Elemente wie Materialität, Farb- und Lichtgestaltung und die Auswahl stilistischer, dekorativer und graphischer Motive ebenfalls Bezug auf das jeweilige Stationsumfeld, etwa auf Baudenkmäler, bedeutende kulturelle oder öffentliche Einrichtungen oder sonstige identitätsstiftende Anlagen. Die am Königsplatz gelegene gleichnamige Station der Münchner U-Bahn beispielsweise verweist durch auf dem Bahnsteig ausgestellte Nachbildungen von Skulpturen und auf den Bahnsteighinterwänden aufgebrachte Abbildungen graphischer künstlerischer Werke auf die Ausstellungshäuser des benachbarten Kunstareals. Die drei in der HafenCity gelegenen Stationen der Hamburger U-Bahn wiederum greifen Motive und Eindrücke aus dem benachbarten Hafen auf, an der Station HafenCity Universität etwa durch großformatige, dunkelbraune Paneele aus geätztem Stahl, die zusammen mit den über dem Bahnsteig hängenden Leuchtkörpern, deren Abmessungen jeweils denen eines Standarcontainers entsprechen, differenzierte Farb- und Lichtstimmungen erzeugen, die die unterschiedlichen Stimmungen des Hafens zu verschiedenen Tageszeiten und bei unterschiedlichen Witterungen wiedergeben sollen.[250]
In einigen Städten greift die Gestaltung von Stationen, die im dortigen Lesben- und Schwulenviertel liegen bzw. wichtige Zugänge hierzu sind, die Regenbogenfahne als Symbol der Lesben- und Schwulenbewegung auf. Entsprechende Stationen gibt es in Berlin (Nollendorfplatz im sogenannten Regenbogenkiez rund um die Motzstraße), Buenos Aires (Santa Fe–Carlos Jáuregui im Stadtteil Recoleta), Madrid (Chueca im gleichnamigen Viertel), Mailand (Porta Venezia im gleichnamigen Stadtteil) und Montreal (Beaudry im Village gai rund um die Rue Sainte-Catherine). Daneben gibt es auch Stationen, die Regenbogen als neutrales Gestaltungsmotiv ohne besonderen lokalen Bezug zur Lesben- und Schwulenszene nutzen wie in Brüssel (Belgica), Hongkong (Choi Hung), München (Candidplatz) und Stockholm (Stadion).
Eigenständigkeit/Zeichenhaftigkeit
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-
Fehrbelliner Platz, Berlin (1971)
Pop-Art-Pavillon als Entgegnung auf nationalsozialistische Dominanzgeste
Entwurf: Rainer G. Rümmler -
Vermont/Santa Monica, Los Angeles (1999)
Entwurf: Ellerbe Becket, Inc. -
World Trade Center, New York (2016)
Skulpturale Großform, die sich in Städtebau und Architektur vom orthogonalen Ordnungsraster der Umgebung löst
Entwurf: Santiago Calatrava -
York University, Toronto (2017):
Landschaftlich eingebundene, fließende Großform
Entwurf: Foster + Partners -
Urheilupuisto/Idrottsparken, Helsinki (2017)
Distinktion durch Kippung des Volumens und eigenständige Materialität
Entwurf: Arkkitehtitoimisto HKP Oy
Im Gegensatz zur zurückhaltenden Einfügung und thematischen Anpassung des oberirdischen Stationsgebäudes an die Gebietskulisse steht die Inszenierung als gestalterisch eigenständiges, häufig freigestelltes Bauwerk oder skulpturales Großobjekt, das selbstbewusst auf sich und das Verkehrsmittel U-Bahn aufmerksam machen.
Integration künstlerischer Arbeiten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-
Place-des-Arts, Montreal:
„Histoire de la musique à Montréal“ (1967); Hinterglasbild; erstes Kunstwerk in einer Station der Montrealer Metro
Künstler: Frédéric Back[251] -
Champ-de-Mars, Montreal:
„Les grands formes qui dansent“ (1968)
Mid-century modern-Buntglasfenster
Architekt: Adalbert Niklewicz
Künstlerin: Marcelle Ferron[251] -
Hankar, Brüssel:
„Notre Temps“ (Ausschnitt, 1976)
600 m² großes Wandgemälde
Künstler: Roger Somville[252] -
Pershing Square, Los Angeles:
„Neons for Pershing Square“ (1991)
Leuchtröhren-Installation als Hommage an das erste Neon-Schild der USA, das 1924 in der Nähe installiert worden war
Künstler: Stephen Antonakos[253] -
Sheppard-Yonge, Toronto:
„Immersion Land“ (Ausschnitt, 2002);
Wandmosaik aus 1,5 Millionen keramischen Bildpunkten mit Landschaften des südlichen Ontario
Künstler: Stacey Spiegel[110] -
28th Street, New York:
„Roaming Underfoot“ (Ausschnitt, 2018)
Glasmosaik mit Pflanzenarten aus dem benachbarten Madison Square Park
Künstlerin: Nancy Blum[254]
Insbesondere seit den 1950er Jahren gewann die Einbindung künstlerischer Arbeiten Bedeutung für die Stationsgestaltung, wobei ein breites Spektrum unterschiedlicher Gattungen bildender Künste von Graphik über Plastik bis Installationen sowie auch Videokunst genutzt wird. Abhängig von Bauherr, Lage und Bedeutung der Station und Entstehungszeit werden unterschiedlich hohe Mittel für die Gestaltung bereitgestellt und Künstler unterschiedlicher Bekanntheit beauftragt. In Abgrenzung zur ebenfalls künstlerisch gestalteten Bauplastik (z. B. Reliefs, Friese, besonders ausgearbeitete Kapitelle) und zu anderen ornamentalen Elementen (z. B. besonders gestaltete Keramikfliesen und Leuchten) sind diese Werke vorrangig als eigenständige Arbeiten inszeniert und erlebbar und treten nicht innerhalb der Gesamtgestaltung in den Hintergrund.
Die Einbindung der Werke reicht von der einfachen, vorwiegend dekorativen Ausstellung im Stationsgebäude über die abgestimmte Planung von Kunstwerk und Architektur im Sinne von Kunst am Bau bis zur engen Integration von Kunst, Architektur und weiteren gestaltwirksamen Elementen zu einem komplexen atmosphärischen, ästhetischen und narrativen Gesamtkunstwerk, wobei der Übergang zwischen diesen Ansätzen teilweise fließend ist.
Gründe für die besondere Berücksichtigung von Kunst können u. a. ein grundsätzlicher baukultureller Anspruch auf Seite des Eigentümers bzw. der Stadtverwaltung, der Wunsch nach Präsentation des künstlerischen und kreativen Profils der jeweiligen Stadt oder Region und die Förderung lokaler Kunstschaffender, der Wunsch nach Distinktion des eigenen Systems durch eine positiv auszeichnende Prägung, Ausstrahlung und Qualität, die künstlerische, ästhetische und intellektuelle Erbauung der Fahrgäste und die Vermittlung, Demokratisierung und Popularisierung von Kunst im Sinne eines öffentlichen Bildungsauftrags sein, für die sich U-Bahnen aufgrund der großen Zahl täglicher Nutzer und ihrer erheblichen Zielgruppenreichweite in besonderer Weise eignen.[255][256][64][251][252][257][258][259][260][261][262]
Grundsätzlich finden sich künstlerische Arbeiten in einer Vielzahl von Netzen, in einigen Systemen bildet ihre Integration jedoch einen zentralen Gestaltungsgrundsatz und wird konsequent im gesamten Netz oder in weiten Teilen davon umgesetzt. Zu den Betreibern, die sich bereits früh und umfassend mit Kunst in der Stationsgestaltung auseinandergesetzt haben, gehören beispielsweise Stockholm (Inbetriebnahme: 1950; künstlerische Arbeiten seit 1957), Lissabon (1959), Montreal (1966) und Brüssel (1976), ebenso Neapel und Los Angeles (jeweils 1993) als spätere Beispiele.[255][256][64][251][252][257][258] Ebenso haben die Betreiber verschiedener früher U-Bahn-Netze später umfassende Programme zur (nachträglichen) künstlerischen Ausgestaltung und teilweise für weitergehende kulturelle Angebote aufgesetzt, darunter die Metropolitan Transit Authority mit MTA Arts & Design (seit 1985) und Transport for London mit Art on the Underground (seit 2000, zunächst als Platform for Art).[259][260][261][262] In verschiedenen Fällen werden die Stationen eines Netzes aufgrund ihrer künstlerischen Gestaltung als eigenständige Anziehungspunkte vermarktet, so bewirbt die Stockholmer Nahverkehrsgesellschaft die U-Bahn der schwedischen Hauptstadt als „längste Kunstausstellung der Welt“,[263][264] eine Bezeichnung, die in Literatur, Presse und Reisejournalismus übernommen wurde.[265][266][267]
- Künstlerische Stationsgestaltung in (post-)sozialistischen Ländern
-
Komsomolskaja, Moskau (1935):
Ausschnitt eines Fliesenbildes mit Darstellung des Metro-Baus als gemeinsame Leistung der Bevölkerung auf der ältesten Strecke des Netzes -
Baumanskaja, Moskau (1944):
Wandmosaik mit Lenin-Portrait und Jahreszahlen der Russischen und der Februar- und Oktoberrevolution auf Roten Fahnen -
Nowoslobodskaja, Moskau (1952):
Symbolisch aufgeladenes Wandmosaik (Frieden, Landwirtschaft/Wohlstand/Gedeihen und Sozialismus); rotes Kleid, blaues Tuch und Säugling erinnern an klassische Mariendarstellungen -
Narwskaja, St. Petersburg (1955):
Die Bevölkerung vereint unter Lenin, Geschichte/Tradition und Zukunft/Aufbau verbunden; die Fahne im Zentrum trägt das Schlagwort Слава Труду (Slawa Trudu, dt. Ruhm (gelte) der Arbeit) -
Politechnitschnyj instytut, Kiew (1963):
Basrelief mit allegorischer Darstellung der sowjetischen Raumfahrt mit Satellit Sputnik 1 -
Tongil (dt. Vereinigung), Pjöngjang (1973):
Wandmosaik – Die Sonne der Nation strahlt über dem ergriffenen (wieder)vereinigten koreanischen Volk -
Puhŭng, Pjöngjang (1987):
Wandmosaik „Der Große Führer Kim Il-sung unter Arbeitern“
Künstlerische Arbeiten spielten insbesondere bei der Ausgestaltung der frühen Stationen verschiedener sowjetischer und anderer (ehemals) sozialistischer Städte häufig eine wesentliche Rolle. Diese konzentrierten sich insbesondere auf propagandistisch grundierte Motive der revolutionären Geschichte und des Sozialistischen Realismus und beschäftigten sich entsprechend vorrangig mit Aufbau- und Entwicklungsbemühungen und -leistungen sowie Zielen und Idealen der sozialistischen Gesellschaft und der jeweiligen Staatsführung.[248] Die Grenzen zu den oben genannten baukünstlerischen Elementen mit ihren thematisch eng verwandten Motiven und zum gestalterischen Ziel des Gesamtkunstwerks sind dabei teilweise fließend.
Die Werke reflektieren häufig nationale bzw. regionale Besonderheiten, wie sich beispielsweise in der spezifisch nordkoreanischen Färbung der Arbeiten in den Stationen der Metro Pjöngjang zeigt, die sich in den allgemeinen Duktus nordkoreanischer Propagandakunst einfügen. Grundsätzlich entsprechen die optimistisch-idealisierten Motive von wirtschaftlichem, wissenschaftlich-technischem und gesellschaftlich-kulturellem Aufbau und Fortschritt dem Grundton des Sozialistischen Realismus der Werke in Stationen anderer Netze. Formal und inhaltlich spiegeln die Arbeiten jedoch ausgeprägter als in anderen Systemen die dominante personelle Fixierung von Politik, Gesellschaft und Wirtschaft auf einen charismatischen Führer, hier den zum Zeitpunkt des Baus der U-Bahn amtierenden Staatspräsidenten und Generalsekretär der Partei der Arbeit Koreas Kim Il-sung, wider, der in der Rolle einer weise anleitenden und von der Bevölkerung hingebungsvoll verehrten väterlichen Figur den inhaltlichen und kompositorischen Mittelpunkt eines Großteils der Arbeiten bildet.[268]
Integration archäologischer Güter
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-
Syntagma, Athen:
Ausstellungsvitrinen mit archäologischen Fundstücken aus dem U-Bahn-Bau -
Yenikapı, Istanbul:
Inszenierte Fragmente eines antiken Holzbootes und von Tongefäßen -
Rokin, Amsterdam:
Akkumulationsartige Ausstellung der unter dem Rokin gefundenen archäologischen Artefakte zwischen den Fahrtreppen -
Rokin, Amsterdam:
Künstlerische Darstellungen von Artefakten sowie von im Rokin vorkommenden Tierarten auf der Hintergleiswand
Vor allem in Städten mit vorneuzeitlichen Wurzeln (z. B. Athen, Istanbul, Mexiko-Stadt, Neapel, Nürnberg, Rom und Wien) wurden und werden im Rahmen des Tunnelbaus teilweise archäologische Funde in Form größerer und kleinerer beweglicher Objekte und von ortsfesten Objekten wie historischer Bausubstanz gemacht. Diese werden häufig museal aufbereitet und als Verweis auf die berührten Zeitschichten und zu ihrer Erlebbarmachung in den späteren Stationsbauwerken ausgestellt, entweder auf speziell gewidmeten separaten Flächen oder – insbesondere bei ortsfesten Objekten – in situ, teilweise auch in den Entwurf der Station eingebunden.
In Wien wurde beispielsweise die aus dem 13. Jahrhundert stammende Virgilkapelle, die 1972 wiederentdeckt wurde, in die Station Stephansplatz integriert und ist heute von dieser aus zugänglich. An der Station Stubentor sind zudem Fragmente der ursprünglichen Wiener Stadtmauer zu finden, an der Station Municipio in Neapel ähnlich hierzu ein Teil eines Wehrturms der früheren Stadtmauer. Der Bau der Station Rotes Rathaus in Berlin verzögerte sich aufgrund archäologischer Funde im Zusammenhang mit dem mittelalterlichen Berliner Rathaus.
Auch in Fällen, in denen bereits vor Baubeginn von der Entdeckung archäologischer Funde ausgegangen wird und die Arbeiten entsprechend fachlich begleitet werden und der Zeit- und Kostenplan des Bauvorhabens entsprechend ausgestaltet wird, können unerwartete Funde auftreten, bei denen unter archäologischen Gesichtspunkten eine Sicherung durch eine Rettungsgrabung geboten ist. Hierdurch können sich Zielkonflikte zwischen der Umsetzung innerhalb des definierten Zeit- und Kostenplans einerseits und dem fachgerechten Umgang mit dem Befund andererseits ergeben.
U-Bahnen in Kunst, Medien und Unterhaltung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Als Bestandteil der Alltagswelt zahlreicher Städte, als etabliertes und wiedererkennbares Lokalkolorit, das etwa in Filmen eine schnelle Identifikation des Handlungsschauplatzes erlaubt, und als generelles Merkmal von bzw. Symbol für Urbanität sind U-Bahnen ein regelmäßig auftauchendes Element in Kunst, Medien und Unterhaltungsprodukten.
Darüber hinaus können U-Bahnen auch selbst Motiv, Handlungsort oder Handlungsbestandteil in den oben genannten Disziplinen sein.
Bildende Künste und Philatelie
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-
Thomas Cantrell Dugdale: Underground, 1932, Walker Art Gallery, Liverpool
-
Lily Furedi: The Subway, 1934, Smithsonian American Art Museum, Washington, D.C.
U-Bahnen sind seit ihrem Bestehen Gegenstand künstlerischer Auseinandersetzung, beispielsweise aufgrund der hier möglichen Beobachtungen von Menschen unterschiedlicher sozialer Hintergründe, die auf begrenztem Raum zusammenkommen und sich für die Zeit des Wartens auf die Bahn und der gemeinsamen Zugfahrt miteinander arrangieren müssen, oder zur Dokumentation der verkehrlichen und städtebaulichen Entwicklung der jeweiligen Stadt. Zu den Malern, die sich mit der U-Bahn befassten, gehörten u. a. Daniel Celentano, Else Hertzer und Mark Rothko.[269][270][271][272]
- Zwei Genrebilder aus den 1930er Jahren befassen sich mit U-Bahn-Fahrten in London und New York und vermitteln hierbei auffallend unterschiedliche Eindrücke über die Atmosphäre der Situation und das Verhalten der Fahrgäste; sowohl das dem Realismus zuzuordnende Bild Underground des britischen Malers Thomas Cantrell Dugdale von 1932 als auch das impressionistische Werk The Subway der ungarisch-amerikanischen Künstlerin Lily Furedi aus dem Jahr 1934 zeigen einen Blick aus Fahrgastperspektive durch einen U-Bahn-Wagen und auf die vielfältigen Typen von Fahrgästen und damit gleichzeitig auf einen Ausschnitt der jeweiligen Gesellschaft der damaligen Zeit. Dugdales Bild beschreibt detailreich und in vorwiegend dunklen und gedeckten Farben einen bis zum letzten Platz besetzten Zug, in dem die zahlreichen Figuren trotz der unmittelbaren räumlichen Enge isoliert wirken und in keiner direkten Interaktion miteinander stehen, Blicke weichen einander aus oder sind ins Leere gerichtet, die Gesichtsausdrücke sind neutral bis abwesend. Auffallend ist eine weibliche Figur im Vordergrund, die als einzige annähernd vollständig abgebildet ist und fast die gesamte Vertikale des Bildes einnimmt. Ihr angespannter körperlicher und abwesender mimischer Ausdruck fassen die in diesem Bild von Disziplin, Statik, Anonymität und einem gleichzeitigen Gefühl von Bedrängnis geprägte Atmosphäre des U-Bahn-Fahrens zusammen.
Furedis Blick in die New Yorker U-Bahn zeigt ein differenzierteres Bild, in dem sich ebenfalls Figuren finden, die schlafend oder lesend auf sich selbst bezogen sind, jedoch auch solche, die aufeinander eingehen wie zwei in ein Gespräch vertiefte Frauen und ein einander zugewandtes Paar, ebenso finden sich einseitige Kontaktaufnahmen wie eine Frau, die in die Zeitung ihres Sitznachbarn blickt und ein Mann, der seine Sitznachbarin beim Auflegen von Lippenstift beobachtet. Unterstrichen durch das heitere und abwechslungsreiche Farbspiel wird die U-Bahn hier als durchaus positiv besetzter Ort des Kontakts, der Kommunikation und der Aktivität dargestellt. Furedis Bild entstand im Rahmen des Public Works of Art Project, einem Programm des New Deal zur Unterstützung bildender Künstler durch Auftragsarbeiten zur Ausstattung öffentlicher Einrichtungen.[273]
- Der Künstler Martin Kippenberger realisierte ab 1993 mit Metro-Net ein mehrteiliges Kunstwerk, das aus Attrappen von Stationszugängen und Lüftungsrohren besteht und den Eindruck eines weltumspannenden U-Bahn-Netzes schaffen sollte.
- Seit April 2020 veröffentlicht die Deutsche Post AG in der Sonderpostwertzeichen-Serie U-Bahn-Stationen in unregelmäßigen Abständen Briefmarken mit Motiven deutscher U-Bahnhöfe sowie von Tunnelstationen anderer Bahnen in Deutschland. Im Januar 2024 erschien die achte Marke der Serie mit einer Darstellung der Münchner Station Westfriedhof und einem Nennwert von 160 Eurocent.[274] Die weiteren in der Serie dargestellten U-Bahn-Stationen sind Heidelberger Platz (Berlin), Marienplatz (München) und Überseequartier (Hamburg), hinzu kommen die drei Stadtbahn-Stationen Heumarkt in Köln, Reinoldikirche in Dortmund und Westend in Frankfurt und die S-Bahn- bzw. Eisenbahn-Station Wilhelm-Leuschner-Platz in Leipzig.[275][276][277]
Literatur und ihre Adaptionen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Armin Joseph Deutsch: A Subway called Mobius (1950)
Die Science-Fiction-/Mystery-Kurzgeschichte des amerikanischen Astronomen Deutsch beschreibt das mysteriöse Verschwinden eines Zuges aus dem fiktionalisierten, deutlich größeren und komplexeren Netz der Boston Subway und die Suche eines Mathematikers nach dem Zug und einer Erklärung für den Vorfall.
Der Stoff wurde 1992 vom Deutschen Fernsehfunk unter Regie von Matti Geschonneck und unter dem Titel Moebius für das Kino adaptiert, die Handlung wurde hierbei nach Berlin verlegt. 1996 folgte ebenfalls unter dem Titel Moebius eine argentinische Kinoadaption durch Gustavo Mosquera, in der die Handlung wiederum nach Buenos Aires verlegt wurde.
- Morton Freedgood: Abfahrt Pelham 1 Uhr 23 (Originaltitel: The Taking of Pelham One Two Three) (1973)
Der Roman des amerikanischen Autors Freedgood behandelt eine Geiselnahme in einem Zug der Linie 6 der New Yorker U-Bahn.
Der Roman wurde 1974 unter dem Titel Stoppt die Todesfahrt der U-Bahn 123 und 2009 als Die Entführung der U-Bahn Pelham 123 für das Kino verfilmt, 1998 entstand unter dem Titel U-Bahn-Inferno: Terroristen im Zug zudem eine Adaption als Fernsehfilm.
- Dmitri Alexejewitsch Gluchowski et al.: Metro (Serie, seit 2007)
Die vom russischen Autor Gluchowski begonnene und später auch durch verschiedene weitere Autoren fortgeführte dystopische Romanreihe und die auf ihr basierende Video- und Computerspielreihe spielen in einer Welt, in der die Erdoberfläche infolge eines schwerwiegenden atomaren Konflikts weitgehend unbewohnbar geworden ist und die unterirdischen U-Bahnnetze zu den wenigen verbliebenen Orte gehören, die menschliches Leben ermöglichen. Die erste Roman in der Reihe spielt in der Moskauer Metro, später Teile betrachteten weitere russische und andere europäische Netze.
Bühne
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Linie 1
Die Züge und Stationen der Linie U1 der Berliner U-Bahn sind Handlungsort des Bühnenmusicals Linie 1, das 1986 am Berliner GRIPS Theater Premiere feierte. Das Stück erhielt 1988 eine Filmadaption und wurde später u. a. in Südkorea (Seoul Line 1, Hakchŏn-Theater, Seoul), Litauen (Taisyklé Nr.1, arba Sapnuoti Vilniu draudziama!, dt. Regel Nr. 1: Von Vilnius träumen verboten!; Keistuolių teatras, Vilnius), Namibia (FRIENDS 4EVA; Tourneeproduktion, Handlung spielt u. a. in Windhoek) und im Jemen (MAK NAZL, dt. Aussteigen, bitte; Handlung spielt in Aden) für die Bühne adaptiert. Schauplätze, Figuren und Handlungselemente wurden dabei an die jeweiligen lokalen Gegebenheiten angepasst, wobei mit Ausnahme von Seoul keine der genannten Handlungsorte über eine U-Bahn verfügt und entsprechend andere Verkehrsmittel gewählt wurden.[278]
- Tarifzone Liebe
Das Bühnenmusical Tarifzone Liebe (Untertitel: Die Gefühle fahren Straßenbahn) behandelt auf humoristische Weise das Verhältnis der Berliner Bevölkerung zur BVG, im Stück u. a. vertreten durch drei anthropomorph dargestellte BVG-Fahrzeuge (Tramara, U-laf und Bus-tav) und einen sprechenden Fahrkartenautomaten. Die rahmengebende Handlung erzählt vom Straßenbahnfahrzeug, das sich in einer Art märchenhaften Umkehrung einer objektophilen Beziehung in einen menschlichen Fahrgast verliebt.
Das Stück wurde im Auftrag der BVG von der Werbeagentur Jung von Matt konzipiert und produziert und soll nach Aussage der BVG dazu dienen, „noch mehr Menschen vom öffentlichen Nahverkehr [zu] überzeugen“. Drehbuch und Liedtexte entstanden unter Beteiligung von Tom van Hasselt, Regie führte Christoph Drewitz. Das Stück wurde am 4. und 5. Dezember 2023 im Berliner Admiralspalast aufgeführt, die BVG veröffentlichte zudem eine Aufzeichnung der Premiere auf ihrem Youtube-Kanal.[279][280][281]
Film
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Metropolis (1927)
Der frühe expressionistische und dystopische Science-Fiction-Film des österreichisch-deutschen Regisseurs und Drehbuchautors Fritz Lang spielt in der namensgebenden und als Archetyp der den menschlichen Maßstab überwältigenden Megacity gleichzeitig namenlosen Großstadt und setzt Hoch- und Untergrundbahnen prominent als Element der futuristisch-fantastischen Stadtszenerie ein.
- Incident… und sie kannten kein Erbarmen (Originaltitel: The Incident) (1967)
Der kammerspielartige amerikanische Kriminal-Thriller von Larry Peerce betrachtet als soziologische Studie die Ereignisse auf einer nächtlichen Fahrt der Linie 4 der New Yorker U-Bahn, in der zwei Punks eine Gruppe von Fahrgästen drangsalieren. Für das Szenario wesentlich ist das Unvermögen, sich in der U-Bahn einem gewalttätigen Zugriff zu entziehen, da der Zug während der Fahrt nicht verlassen werden kann und der Abgang aus dem Zug auf den Stationen durch Bedrohung und physische Gewalt von Seiten der Punks unterbunden wird.
- Ghostbusters II (1989)
In der amerikanischen Schience-Fiction-Fantasy-Komödie von Ivan Reitman finden die Hauptcharaktere im Untergrund der Stadt New York den stillgelegten Tunnel der fiktiven New York Pneumatic Railroad, die deutliche Ähnlichkeiten zum realen Beach Pneumatic Transit aufweist, einer experimentellen atmosphärischen Untergrundbahn, die von 1870 bis 1873 auf einer rund 90 Meter langen Strecke als Demonstrationsanlage betrieben wurde. Insbesondere stimmt das im Film als Detail eines Tunnelportals gezeigte Eröffnungsdatum 1870 mit dem des realen Systems überein.
- Money Train (1995)
Die amerikanische Action-Komödie des Regisseurs Joseph Ruben behandelt die Geschehnisse rund um zwei Beamte der New York City Transit Police, dem Polizeidienst der New Yorker Verkehrsbetriebe, und ihren versuchten Raubüberfall auf einen der namengebenden Money Trains, einem speziellen U-Bahn-Zug, mit dem Fahrgeldeinnahmen durch das Netz transportiert werden.
- Kontroll (2003)
Die episodenhafte Thriller-Komödie des ungarischen Regisseurs Nimród Antal spielt vollständig in den Zügen und Anlagen eines fiktiven U-Bahn-Systems und erzählt die humoristisch- bis morbid-skurrilen Begebenheiten rund um eine Gruppe von Fahrkartenkontrolleuren. Als Drehort dienten die Anlagen der Metró Budapest.
- Metropia (2009)
Die Handlung des dystopischen Animationsfilms des schwedischen Regisseurs Tarik Saleh spielt in einem Europa des Jahres 2024, in dem der private Kfz-Verkehr infolge der Erschöpfung der Ölreserven eingestellt wurde. Stattdessen bewegt sich die Bevölkerung vorrangig zu Fuß und mit einem den gesamten Kontinent überspannenden U-Bahn-System fort, das sich im Eigentum eines Großkonzerns befindet, der die Bevölkerung ausgehend von seiner weitgehenden Kontrolle über die Mobilität in der Art des Großen Bruders zu überwachen und kontrollieren versucht.[282]
Musikvideos
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Michael Jackson: Bad (1986)
Das unter Regie von Martin Scorsese entstandene Musikvideo wurde im Verteilergeschoss der Station Hoyt–Schermerhorn Streets der New York City Subway gedreht. Es wurden hierfür jedoch der Großteil der Beschriftungen und Beschilderungen sowie sämtliche Werbeplakate entfernt bzw. unkenntlich gemacht.
Nach Jacksons Tod im Jahr 2009 bemühte sich die damalige New Yorker Stadträtin Letitia James erfolglos um eine Würdigung des Sängers in der Station durch Umbenennung oder Anbringung einer Gedenktafel.[283]
- Bomfunk MC’s: Freestyler (1999)
Das Video zum Stück der finnischen Hip-Hop-Gruppe wurde zu großen Teilen in der Station Hakaniemi/Hagnäs und in einem Zug der Baureihe M100 der Metro Helsinki gedreht. Der Stationsname wird im Video selbst nicht gezeigt, die Anlage ist jedoch u. a. aufgrund ihres markanten Tonnengewölbes identifizierbar.
- Pet Shop Boys:
- Home and Dry (2002)
Das Video zum Song der englischen Elektropop-Band besteht größtenteils aus Aufnahmen von Mäusen, die durch einen der Gleiströge der Station Tottenham Court Road der London Underground laufen. Regie führte der deutsche Fotograf und Künstler Wolfgang Tillmans.[284] - Dreamland (2019)
Das Video besteht aus einer animierten Collage in der Art einer kontinuierlichen Kamerafahrt durch einen aus Elementen der Berliner U-Bahn zusammengesetzten Bahnhof. Zu sehen sind u. a. die markanten türkisfarbenen Wandfliesen der Station Alexanderplatz, aus Elementen der Baureihen D (Front) und G (restlicher Wagenkasten) zusammengesetzte Züge, der Berliner Liniennetzplan des VBB und diverse charakteristische Stationseinbauten der BVG. Der Songtext wird begleitend zum Gesang in Form diegetischer Elemente wie Graffiti, Werbeplakaten und Lauftexten auf elektronischen Anzeigern in die Szenerie eingebunden.
- Home and Dry (2002)
Museen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-
Schild im U-Bahn-Museum Budapest im Stile klassischer Stationsschilder der Porzellanmanufaktur Zsolnay
-
Historische Fahrzeuge der London Underground im Museumsdepot des London Transport Museum
-
Thematisch gestalteter Eingang zum Museo del Metro in Mexiko-Stadt
-
Künstlerische Darstellung des Baus der Metro Pjöngjang unter Anleitung von Kim Il-sung im Metro-Museum Pjöngjang
-
TunnelTour der BVG, 2012
-
Max-Weber-Platz, München: Nachbildung eines Pferdebahnwagens als Verweis auf die Entwicklung des städtischen Nahverkehrs
Museen mit dem Schwerpunkt U-Bahn oder größeren Dauerausstellungen hierzu gibt es u. a. in folgenden Städten, wobei der Fokus in der Regel auf dem jeweiligen lokalen System liegt:
- Berlin: Berliner U-Bahn-Museum – in der Station Olympia-Stadion
- Budapest: U-Bahn-Museum Budapest – im ehemaligen Teil der Station Déak Ferenc tér, der ursprünglich zur ersten U-Bahn Kontinentaleuropas gehörte
- Chelles: Musée des transports urbains, interurbains et ruraux – Nahverkehrsmuseum mit großer Sammlung von Fahrzeugen der Pariser Métro
- Delhi: Metro Delhi Museum – in der Station Patel Chowk
- Glasgow: Riverside Museum – allgemeines Verkehrsmuseum mit Abteilung zur Subway; übernahm Sammlung des ehemaligen Glasgow Museum of Transport
- Guangzhou: Guangzhou Metro Museum
- Kennebunkport, Maine: Seashore Trolley Museum – Nahverkehrsmuseum mit historischen Fahrzeugen verschiedener U-Bahn-Systeme, u. a. Boston
- London: London Transport Museum mit den Standorten:
- Covent Garden – Hauptstelle
- Acton – Museumsdepot in Nähe der Station Acton Town, Außenstelle
- Madrid: Andén Cero (de. Bahnsteig Null) mit den Standorten:
- Estación de Chamberí – zum Museum umgebauter ehemaliger U-Bahnhof auf der ältesten Metro-Strecke Madrids; die Strecke wird weiterhin im Regelbetrieb befahren
- Nave de motores de Pacífico – ehemaliges Kraftwerk der Metro in Nähe der Station Pacífico
- Chamartín – umfassende Ausstellung historischer Fahrzeuge der Metro
- Mexiko-Stadt: Museo del Metro – in der Station Mixcoac
- Nagoya (Nisshin): Nagoya City Tram & Subway Museum – in Nähe der Station Akaike
- New York: New York Transit Museum mit den Standorten
- Court Street – zum Museum umgebauter ehemaliger U-Bahnhof, Hauptstelle
- Grand Central Terminal – Außenstelle im bedeutenden Pendlerbahnhof
- Pjöngjang: Metro-Museum Pjöngjang
- Rotterdam: Rotterdams Openbaar Vervoer Museum – Museum zum Nahverkehr in der Region Rotterdam mit Exponaten zur Metro
- Shanghai: Shanghai Metro Museum – in Nähe der Station Ziteng Road
- Stockholm: Spårvägsmuseet – Museum zum Nahverkehr in der Provinz Stockholm mit Exponaten zur U-Bahn
- Tokio: U-Bahn-Museum Tokio – in Nähe der Station Kasai
Merchandising
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-
Merchandising-Geschäft im
London Transport Museum -
Weihnachtsbaumschmuck mit MTA-Motiven im Shop des New York Transit Museum
-
Strumpfhosen mit nicht lizenziertem Design der New York City Subway
-
Ansichtskarte des Berliner U-Bahnhofs Kottbusser Tor, Teil der Serie „Elektrische Hochbahn“, 1902–1903
-
Kolorierte Ansichtskarte des Hamburger
U-Bahnhofs Berliner Tor mit Angabe von Streckenlänge und Projektkosten, 1912
Verschiedene Betreiber bieten Merchandising-Artikel zu ihrem U-Bahn-System an bzw. lizenzieren entsprechende Produkte, verbreitete Motive bzw. Anknüpfungspunkte sind hierbei insbesondere Logo und Liniennetzplan des jeweiligen Systems. Das Angebot reicht dabei von wenig spezifischen und häufig eher niedrigpreisigen Produkten wie Kugelschreibern, Trinkbechern, Schlüsselanhängern, Kühlschrankmagneten, Leinenbeuteln u. dgl. über Spielwaren wie Holzeisenbahnen und Plüschtiere, Bekleidung und Fahrzeugmodelle unterschiedlicher Qualitäts- und Preisniveaus und Bücher, beispielsweise zur Systemgeschichte, bis zu aufwändigen und hochpreisigen Artikeln mit engem Bezug zum jeweiligen System. Beispielsweise bietet Transport for London u. a. einen umfassenden Katalog von Postern und Drucken historischer Werbeplakate der Underground, ausgemusterte Stationsbeschilderung und -ausstattung als Dekorations- und Einrichtungsartikel und Kissen und Polstermöbel mit den verschiedenen für die Sitzbezüge der Züge verwendeten Stoffen an, die Toronto Transit Commission wiederum verkauft ausgemusterte Zugzielanzeiger älterer U-Bahn-Fahrzeuge.[285][286][287][288][289] Teilweise werden auch entsprechende Produkte ohne Lizenzierung durch den Betreiber bzw. Eigentümer angeboten.
In der Frühzeit der U-Bahnen, als weltweit nur wenige Städte über ein System verfügten und der Besitz daher mit einem gewissen Prestige und Seltenheitswert verbunden war, waren U-Bahnen auch ein beliebtes Motiv für Ansichtskarten.
Rekorde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Streckenlänge
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Netze mit der größten Streckenlänge (Stand 2024); die Angaben beziehen sich auf verkehrlich zusammenhängende Gesamtnetze, die teilweise aus technisch und betrieblich unabhängigen Teilsystemen unterschiedlicher Betreiber bestehen[2]
| Rang | System | Land | Länge | Eröffnung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U-Bahn Peking | 815 km | 15. Januar 1971 | |
| 2 | Metro Shanghai | 800 km | 28. Mai 1993 | |
| 3 | Guangzhou Metro | 650 km | 28. Juni 1996 | |
| 4 | U-Bahn Chengdu | 560 km | 27. September 2010 | |
| 5 | Hangzhou Metro | 560 km | 25. November 2012 | |
| 6 | Shenzhen Metro | 550 km | 28. Februar 2004 | |
| 7 | U-Bahn Seoul | 527 km | 15. August 1974 | |
| 8 | Chongqing Rail Transit | 520 km | 18. Juni 2005 | |
| 9 | U-Bahn Nanjing | 500 km | 3. September 2005 | |
| 10 | Wuhan Metro | 480 km | 28. Juli 2004 | |
| 11 | Metro Moskau | 460 km | 15. Mai 1935 | |
| London Underground | 402 km | 10. Januar 1863 | ||
| New York City Subway | 400 km | 27. Oktober 1904 | ||
| U-Bahn Tokio | 381 km | 27. Dezember 1927 | ||
| Metro Delhi | 345 km | 24. Dezember 2002 | ||
| Metro Madrid | 294 km | 17. Oktober 1919 |
Das größte Netz im deutschsprachigen Raum hat die Berliner U-Bahn mit rund 155 Kilometern Streckenlänge. Im Berliner Netz findet sich mit der U7 zudem die längste rein im Tunnel verlaufende Linie Deutschlands mit einer Länge von 31,8 Kilometern und 40 Stationen. Die längste deutsche U-Bahn-Linie insgesamt ist die U1 der Hamburger U-Bahn mit 55,8 Kilometern und 47 Stationen.
Fahrgäste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Netze mit den meisten Fahrgästen weltweit im Jahr 2019; die Angaben beziehen sich auf verkehrlich zusammenhängende Gesamtnetze, die teilweise aus technisch und betrieblich unabhängigen Teilsystemen unterschiedlicher Betreiber bestehen[2]
| Rang | System | Land | Fahrgäste in Millionen |
Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U-Bahn Tokio | 3912 | Summierung der Passagierzahlen verschiedener Betreiber, Wert enthält Mehrfachzählungen | |
| 2 | Metro Moskau | 2561 | – | |
| 3 | Metro Shanghai | 2209 | – | |
| 4 | U-Bahn Peking | 2088 | – | |
| 5 | U-Bahn Seoul | 1913 | – | |
| 6 | U-Bahn Guangzhou | 1854 | – | |
| 7 | Metro Delhi | 1778 | Wert für das Geschäftsjahr April 2019 bis März 2020 | |
| 8 | New York City Subway | 1706 | – | |
| 9 | U-Bahn Mexiko-Stadt | 1595 | – | |
| 10 | Mass Transit Railway | 1568 | – | |
| 11 | London Underground | 1500 | – | |
| Métro Paris | 1500 | – | ||
| 13 | Metrô São Paulo | 1200 | – | |
| Shenzhen Metro | 1200 | – | ||
| 15 | Mass Rapid Transit | 1000 | – |
Besonders tief liegende Stationen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die tiefstgelegene U-Bahn-Station weltweit ist Hongyancun in Chonqing mit 106 Metern unter der Erde.[290] Die am tiefsten gelegene Station Europas ist Arsenalna in Kiew mit 105,5 Metern unter Gelände, wobei sich diese besonders große Tiefe aus der Lage unter einem Hügel ergibt. Danach folgt die im Jahr 2011 eröffnete Station Admiralteiskaja der Linie 5 der Metro Sankt Petersburg mit 102 Metern. Aufgrund der besonderen Tiefenlage werden die Rolltreppen, die Straßen- und Bahnsteigniveau miteinander verbinden, mit einer im Vergleich zu Westeuropa deutlich höheren Beförderungsgeschwindigkeit betrieben.
Die längsten Rolltreppen der Welt mit jeweils 126 Metern Länge bei 63 Metern Höhendifferenz befinden sich in der Station Park Pobedy der Moskauer Metro. Die mit 70 Metern längsten Rolltreppen der westlichen Hemisphäre befinden sich in der Station Wheaton der Metro Washington.
Trivia und Kuriosa
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Berlin – U-Bahn in zwei Staaten
Mit der Teilung Berlins im Zuge der Deutschen Teilung wurde die Berliner U-Bahn das erste und bislang einzige System der Welt, das – mindestens de facto – zwischen zwei Staaten aufgeteilt wurde und in der Folge auf dem Territorium zweier verschiedener Staaten verlief (zur Frage der völkerrechtlichen Anerkennung der DDR siehe hier, im spezielleren zur Anerkennung durch die Bundesrepublik siehe hier).
Zwischen der Gründung der Bundesrepublik (23. Mai 1949) und der Gründung der DDR (7. Oktober 1949) wurde für den in Ost-Berlin gelegenen Betriebsteil der BVG am 1. August 1949 ein separates „Direktionsbüro Ost“ eingerichtet, aus dem später der VEB Kombinat Berliner Verkehrsbetriebe (BVB) hervorgehen sollte. Der gemeinsame Betrieb des Gesamtnetzes wurde jedoch auch in der geteilten Stadt zunächst im Wesentlichen störungsfrei fortgesetzt.
Weitreichende Änderungen ergaben sich erst mit der physischen Trennung West- und Ost-Berlins im Zuge des Baus der Berliner Mauer ab dem 13. August 1961; die DDR trennte die Schienenverbindungen der grenzüberschreitende Strecken der heutigen Linien U1 und U3 zwischen Schlesisches Tor (West) und Warschauer Brücke (heute: Warschauer Straße) (Ost) und der heutigen Linie U2 zwischen Gleisdreieck (West) und Thälmannplatz (heute: Mohrenstraße) (Ost), wodurch diese jeweils in einen westlichen und einen östlichen Teil getrennt wurden bzw. Warschauer Brücke zu einer Inselstation ohne Anschluss an einen weiteren Bahnhof wurde. Komplexer gestaltete sich der Umgang mit den Strecken der heutigen Linien U6 und U8, deren zentrale Abschnitte durch Ost-Berlin verliefen, während die nördlichen und südlichen Außenstrecken in West-Berlin lagen. Die DDR gestattete gegen Nutzungsentgelt einen Betrieb der U-Bahn auf ihrem Territorium, jedoch wurden mit Ausnahme des Bahnhofs Friedrichstraße, der hierdurch zur Grenzübergangsstelle zwischen West- und Ost-Berlin bzw. der DDR wurde, sämtliche Stationen der beiden Linien in Ost-Berlin geschlossen und ohne Halt durchfahren.
Diese Situation endete mit dem Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes am 3. Oktober 1990. Die Arbeiten für die Wiederzusammenführung der getrennten Teilnetze waren jedoch bereits unmittelbar nach dem Fall der Mauer Ende 1989 aufgenommen worden.[20]
- Montreal – Dou-dou-dou und Il fait beau dans l'métro
Zeitindex 0:04: Türschließsignal
Zeitindizes 0:14 und 0:44: Anfahrgeräusch
Die Fahrmotoren der Fahrzeuge der Baureihe MR-73 der Metro Montreal erzeugen beim Anfahren eine fünfteilige, musikalisch wirkende Tonfolge, deren drei letzten, deutlich hörbaren Töne stark an den Anfang des Stücks „Fanfare for the Common Man“ des US-amerikanischen Komponisten Aaron Copland erinnern und lautmalerisch als „dou-dou-dou“ wiedergegeben werden können. Die sehr charakteristische Tonfolge entwickelte sich rasch zu einem Erkennungszeichen der Metro und Montreals insgesamt[251] und wurde aufgrund ihrer Bekanntheit und Beliebtheit im Jahr 2010 als akustisches Türschließsignal für alle U-Bahn-Fahrzeuge übernommen.[291]
Die Tonfolge wurde zudem 1976, das heißt im Jahr der Einführung der Baureihe MR-73, im Rahmen der Werbekampagne „Il fait beau dans l’métro“ (dt. „In der Metro ist das Wetter schön“) der Montrealer Verkehrsbetriebe prominent verwendet. Das Hauptelement der Kampagne ist ein rund einminütiger musicalartiger Fernsehspot, in dem Fahrgäste durch die Station Atwater, einen Zug der Baureihe MR-73 sowie einen Stadtbus tanzen und ihre Begeisterung für die Metro, die die schönste der Welt sei, und den Montrealer Nahverkehr insgesamt erklären.[292] Die Kampagne und speziell der Spot fanden Eingang in die Québecer Popkultur der damaligen Zeit und wurden noch Jahrzehnte später zitiert und auch persifliert, da dem Spot in der späteren Rezeption neben der mittlerweile erreichten nostalgischen Qualität auch ein Wert aus Perspektive von Kitsch bzw. Camp zugeschrieben wurde.
- Pjöngjang – Eigener Radiosender
Die Betreibergesellschaft der Metro Pjöngjang unterhält, ebenso wie der Betreiber des Pjöngjanger Oberleitungsbusses und die nordkoreanische Eisenbahn, einen eigenen Radiosender zur Information und Unterhaltung der Fahrgäste.[293]
Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- W. J. Hinkel, K. Treiber, G. Valenta und H. Liebsch: gestern-heute-morgen – U-Bahnen von 1863 bis 2010. Schmid-Verlag, Wien 2004, ISBN 3-900607-44-3.
- Straßenbahn Magazin: U-Bahnen. Geramond-Verlag, München 2004, 1, ISBN 3-89724-201-X.
- Mark Ovenden: Metro Maps of the world. Capital Transport, London 2005, ISBN 1-85414-272-0 (englisch).
- Paul Garbutt: World metro systems. Capital Transport, London 1997, ISBN 1-85414-191-0 (englisch).
- Sergej Tchoban und Sergej Kuznetsov (Hrsg.): speech: 13: metro/subway. JOVIS Verlag, Berlin 2015, ISBN 978-3-86859-840-7.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Urbanrail.net – U-Bahnen weltweit (englisch)
- Metro Bits – U-Bahnen der Welt unter verschiedenen Aspekten (englisch)
- Architektur verschiedener U-Bahn-Stationen
- Urbanrail.net – U-Bahnen in Deutschland
- Zu Zeiten der Sowjetunion gebaute U-Bahnen
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ U-Bahn. Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, abgerufen am 27. Mai 2024.
- ↑ a b c d e f g h Statistics Brief: World Metro Figures 2021. (PDF) Internationaler Verband für öffentliches Verkehrswesen, Mai 2022, abgerufen am 9. November 2023 (englisch).
- ↑ Report: Commuter Railway Landscape. (PDF) Internationaler Verband für öffentliches Verkehrswesen, September 2018, abgerufen am 9. November 2023 (englisch, Auszug).
- ↑ Statistics Brief: The Global Tram and Light Rail Landscape. (PDF) Internationaler Verband für öffentliches Verkehrswesen, Oktober 2019, abgerufen am 9. November 2023 (englisch).
- ↑ a b c Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (Hrsg.): Der Straßenbahner – Handbuch für U-Bahner, Stadt- und Straßenbahner, Selbstverlag, Köln 2001
- ↑ Compendium of Definitions and Acronyms for Rail Systems. (PDF) American Public Transportation Association, 20. Juni 2019, abgerufen am 15. Januar 2024.
- ↑ CUTA Renews MoU with APTA. Canadian Public Transit Association, 12. Januar 2024, abgerufen am 1. Februar 2024.
- ↑ a b c d e f g h i Robert Schwandl: Subways & Light Rail in den U.S.A., Band 3: Mittlerer Westen & Süden. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2014.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m Robert Schwandl: Subways & Light Rail in den U.S.A., Band 1: Ostküste. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2010.
- ↑ a b c d Robert Schwandl: Subways & Light Rail in den U.S.A., Band 2: Westen. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2012.
- ↑ a b c d e Robert Schwandl: Urban Rail in Canada. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2024.
- ↑ Planfeststellungsbeschluss, Ablauf und Zuständigkeiten. Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt des Landes Berlin., abgerufen am 17. November 2023.
- ↑ Zulassungsverfahren. Planfeststellungsbehörde. Behörde für Wirtschaft und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg., abgerufen am 17. November 2023.
- ↑ Amt für Planfeststellung. Amt für Planfeststellung beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein, abgerufen am 17. November 2023.
- ↑ Straßen- und U-Bahnen; Beantragung der Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens. Regierung von Mittelfranken., abgerufen am 17. November 2023.
- ↑ Planverfahren, Planfeststellungen, Genehmigungsverfahren. Regierung von Oberbayern., abgerufen am 17. November 2023.
- ↑ Bau- und Betriebsordnung für Untergrundbahnen vom 1. Juni 1979. (PDF) Spezialarchiv Bauen in der DDR und Informationszentrum Plattenbau beim Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, abgerufen am 15. November 2023.
- ↑ U-Bahn-, Straßenbahn- und Eisenbahnangelegenheiten. Magistratsabteilung 64 Bau-, Energie-, Eisenbahn- und Luftfahrtrecht der Stadt Wien., abgerufen am 11. November 2023.
- ↑ Projets lausannois : autorisations de l’OFT pour le métro et le tram. Bundesamt für Verkehr BAV der Schweizerischen Eidgenossenschaft., abgerufen am 17. November 2023 (französisch).
- ↑ a b c d e f g Uwe Poppel: Berliner U-Bahn: Zeitgeschichte in Liniennetzplänen – von 1902 bis heute. Gesellschaft für Verkehrspolitik und Eisenbahnwesen e.V. (GVE-Verlag), Berlin 2017.
- ↑ a b c d e f g Robert Schwandl: Schnellbahnen in Deutschland. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2007.
- ↑ a b c Protokoll der öffentlichen Sitzung des Verkehrsausschusses der Bürgerschaft vom 23. Mai 2023. (PDF) Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, 15. Juli 2022, abgerufen am 27. Mai 2023.
- ↑ Stadtwerke Norderstedt: Unser Geschäftsbericht 2020. (PDF) Stadtwerke Norderstedt, 2021, abgerufen am 3. November 2023.
- ↑ Landkreis München neuer Inhaber der U6 nach Garching. Landratsamt München, 23. Oktober 2023, abgerufen am 1. November 2023.
- ↑ Ab Januar fährt auch die U2 automatisch: Neues Betriebskonzept für die Linien U2 und U3, mit einem 100-Sekunden-Takt als Highlight. (PDF) VAG, 29. November 2009, abgerufen am 28. Juni 2018.
- ↑ Ivo Köhler: Handbuch Straßenbahn. Fahrzeuge, Anlagen, Betrieb, Seite 17f. GeraMond, München 2006.
- ↑ Martin Pabst: Straßenbahn-Fahrzeuge. Band 1: Klassische Straßenbahnwagen, Seite 7ff. GeraMond, München 2000.
- ↑ a b Martin Pabst: Straßenbahn-Fahrzeuge. Band 2: Niederflur- und Stadtbahnwagen, Seite 7ff. GeraMond, München 2000.
- ↑ a b c d e Robert Schwandl: U-Bahn, S-Bahn & Tram in Wien. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2018.
- ↑ Öffi-Ausbau U2xU5. Wiener Linien GmbH und Co KG, abgerufen am 4. November 2023.
- ↑ Eine „Mini-Metro“ in Graz?
- ↑ Die Metro – Unsere Stadtschnellbahn in Graz. Präsentation der MUM – Moderne Urbane Mobilität 2030+ vom 16.10.2021. (PDF) Moderne Urbane Mobilität 2030+, 16. Oktober 2021, abgerufen am 4. November 2023.
- ↑ Graz könnte 2030 eine U-Bahn bekommen. Der Standard, 18. Februar 2021, abgerufen am 24. Februar 2021.
- ↑ Das Tram von Oerlikon nach Schwamendingen. Tram-Museum Zürich, 30. August 2006, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 19. Dezember 2010; abgerufen am 4. November 2023.
- ↑ a b Grafik „Anschlüsse an die U-Bahn“, 1929. berliner-linienchronik.de, abgerufen am 7. November 2023.
- ↑ Stadtbahnen. In: Victor von Röll (Hrsg.): Enzyklopädie des Eisenbahnwesens. 2. Auflage. Band 9: Seehafentarife–Übergangsbogen. Urban & Schwarzenberg, Berlin / Wien 1921, S. 132 ff.
- ↑ Schnellbahnen. In: Victor von Röll (Hrsg.): Enzyklopädie des Eisenbahnwesens. 2. Auflage. Band 8: Personentunnel–Schynige Platte-Bahn. Urban & Schwarzenberg, Berlin / Wien 1917, S. 415 ff.
- ↑ Stadtschnellbahnen. In: Victor von Röll (Hrsg.): Enzyklopädie des Eisenbahnwesens. 2. Auflage. Band 9: Seehafentarife–Übergangsbogen. Urban & Schwarzenberg, Berlin / Wien 1921, S. 133 ff.
- ↑ Die dritte Glasgower Untergrundbahn (District Subway). In: Zeitschrift für Kleinbahnen, herausgegeben vom Ministerium für öffentliche Arbeiten, IV. Jahrgang, Berlin, März 1897, S. 205
- ↑ Florian Marten: Die Stadtbahn machte Hamburg groß, taz am Wochenende vom 29. April 1995, online auf taz.de, abgerufen am 21. November 2023
- ↑ E. M. Kilgus: Fortschritte in der Profilgestaltung der Untergrundbahnen und statische Untersuchung der rechteckigen Profilformen. In: Zeitschrift für Bauwesen, herausgegeben im Preussischen Finanzministerium, Verlag von Wilhelm Ernst u. Sohn, 71. Jahrgang, Berlin 1921, S. 76
- ↑ Londoner Schnellbahnen. In: Victor von Röll (Hrsg.): Enzyklopädie des Eisenbahnwesens. 2. Auflage. Band 7: Kronenbreite–Personentarife. Urban & Schwarzenberg, Berlin / Wien 1915, S. 224 ff.
- ↑ Schnellbahn-/Regionalverkehr im HVV, Stand 10. Dezember 2023. (PDF) Hamburger Verkehrsverbund, abgerufen am 31. Dezember 2023.
- ↑ Alle Infos zu Hamburgs Schnellbahnprojekten. Behörde für Verkehr und Mobilitätswende der Freien und Hansestadt Hamburg, abgerufen am 31. Dezember 2023.
- ↑ Pläne des MVV-Schnellbahnnetzes von 1972 bis heute. u-bahn-muenchen.de, abgerufen am 31. Dezember 2023.
- ↑ a b c d Martin Pabst: S-Bahn und U-Bahn-Fahrzeuge in Deutschland. GeraMond, München 2006.
- ↑ a b c d e f g h i j Robert Schwandl: Tram Atlas Großbritannien & Irland. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2015.
- ↑ Robert Schwandl: Urban Rail Down Under. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2011.
- ↑ M5: la nuova metropolitana di Milano. Azienda Trasporti Milanesi S.p.A., abgerufen am 23. Juli 2024 (italienisch).
- ↑ Métro léger. Réseau express métropolitain, abgerufen am 23. Juli 2024 (französisch).
- ↑ "BVG 2005 plus". Berliner Fahrgastverband IGEB fordert Nachbesserungen in dem am 12.12.2004 eingeführten neuen BVG-Liniennetzkonzept und legt einen 15-Punkte-Plan für Sofortmaßnahmen vor, damit Berlin einen attraktiven ÖPNV behält. Einführung des BVG-Liniennetzkonzeptes am 12. Dezember 2004. Pressemitteilung vom 15. Februar 2005. Interessengemeinschaft Eisenbahn, Nahverkehr und Fahrgastbelange Berlin e.V., 15. Februar 2005, abgerufen am 21. Juli 2024.
- ↑ 20 Jahre MetroBus – Weshalb man es heute erfinden müsste, wenn es das nicht schon gäbe. Dialog-Blog der Hamburger Hochbahn AG, 9. Juni 2021, abgerufen am 21. Juli 2024.
- ↑ Zeitreise. Die Geschichte der MVG. 2000 – 2009. Münchner Verkehrsgesellschaft mbH, abgerufen am 24. Juni 2024.
- ↑ Fahrplananpassungen zum 7. Januar 2016 ( vom 3. Januar 2016 im Internet Archive), Pressemitteilung der Braunschweiger Verkehrs-GmbH.
- ↑ Metro Logos. metrobits.org, abgerufen am 4. November 2023.
- ↑ Zur Eröffnung der direkten Schnellbahnverbindung vom Osten nach dem Westen über das Gleisdreieck, den Nollendorfplatz und den Wittenbergplatz am 24. Oktober 1926, Seite 11. Digitalisierung des Werks im Angebot der Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Hochbahngesellschaft Berlin, abgerufen am 1. November 2023.
- ↑ Grafik „Region Berlin Schnellbahnnetz, Stand Juni 1991“. (PDF) berliner-linienchronik.de, abgerufen am 7. November 2023.
- ↑ a b Robert Schwandl: Tram Atlas Benelux. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2020.
- ↑ a b c d Robert Schwandl: Tram Atlas Nordeuropa. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2021.
- ↑ a b c d e f Andrew Phipps, Robert Schwandl: Tram Atlas Südosteuropa. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2023.
- ↑ a b c d Robert Schwandl: Tram Atlas Mitteleuropa, S. 132ff. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2017.
- ↑ a b c Robert Schwandl: U-Bahnen in Deutschland. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2019
- ↑ a b c d e Robert Schwandl: Metros in Frankreich. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2006.
- ↑ a b c d e f Christoph Groneck: Metros in Portugal. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2008.
- ↑ a b c d e f g h i j k Robert Schwandl: Metro + Tram Atlas Spanien. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2015.
- ↑ a b c d Claudio Brignole, Robert Schwandl: Metros in Italien. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2010.
- ↑ a b c d e f g Robert Schwandl: Metros & Trams in Japan, Band 1: Tokyo Region, Seite 8f. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2016.
- ↑ a b c d e Andrew Phipps, Robert Schwandl: Metros & Trams in Japan, Band 2: Nord- & Zentraljapan. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2017.
- ↑ a b c Andrew Phipps, Robert Schwandl: Metros & Trams in Japan, Band 3: West- & Südjapan, Seite 14ff. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2018.
- ↑ Hotărâre nr. 482 din 17 iunie 1999 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A (dt. Entscheidung Nr. 482 vom 17. Juni 1999 über die Gründung des Transportunternehmens der Metro Bukarest „Metrorex“ AG). Rumänische Regierung, 17. Juni 1999, abgerufen am 12. Mai 2024 (rumänisch).
- ↑ Introduction. Delhi Metro Rail Corporation Ltd., abgerufen am 9. Juni 2024 (englisch).
- ↑ L’essentiel sur notre Groupe. Régie Autonome des Transports Parisiens, abgerufen am 13. Juni 2024 (französisch).
- ↑ Seoul Line 9 is now open. Railway Gazette International, 24. Juli 2009, abgerufen am 13. Juni 2024.
- ↑ Joel Joseph: DMRC takeover of Rapid Metro operations official. In: The Times of India – Onlineausgabe vom 23. Oktober 2019. 23. Oktober 2019, abgerufen am 13. Juni 2024.
- ↑ Connecting Stockholm AB vinner tunnelbaneupphandling. Storstockholms Lokaltrafik AB, 23. Januar 2024, abgerufen am 15. Juni 2024.
- ↑ Anstalten öffentlichen Rechts. Senatsverwaltung für Wirtschaft, Verkehr und Betriebe des Landes Berlin, abgerufen am 15. Juni 2024.
- ↑ Geschäftsbericht 2022. (PDF) HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, abgerufen am 15. Juni 2024.
- ↑ Geschäftsbericht 2023. (PDF) SWM Stadtwerke München GmbH, abgerufen am 15. Juni 2024.
- ↑ Geschäftsbericht 2022. (PDF) StWN Städtische Werke Nürnberg GmbH, abgerufen am 15. Juni 2024.
- ↑ Finanzbericht 2023. Wiener Stadtwerke GmbH, abgerufen am 15. Juni 2024.
- ↑ BART – Tarife und Fahrpläne. Stand: Februar 2017. (PDF) Bay Area Rapid Transit District, abgerufen am 26. Juni 2024.
- ↑ FARE CHART. Metro Railway Kolkata, 10. Juli 2024, abgerufen am 18. Juli 2024.
- ↑ a b BVG-Tickets im Überblick. Berliner Verkehrsbetriebe AöR, abgerufen am 24. Juni 2024.
- ↑ a b Sammlung der Bekanntmachungen von Neuerungen bzw. Änderungen zu den Tarifen des Hamburger Verkehrsverbundes (hvv). Stand Juni 2024. (PDF) Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH, abgerufen am 24. Juni 2024.
- ↑ Unlimited Evening. Société de transport de Montréal, abgerufen am 18. Juli 2024.
- ↑ Airport. Metro Madrid S.A., abgerufen am 23. Juni 2024 (englisch).
- ↑ From the airport by metro. Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, abgerufen am 23. Juni 2024 (englisch).
- ↑ OVpay. The new way of checking in and out. Trans Link Systems B.V., abgerufen am 23. Juni 2024 (englisch).
- ↑ Contactless payments. Transport for NSW, abgerufen am 26. Juni 2024 (englisch).
- ↑ Pay as you go caps. Transport for London, abgerufen am 30. Juni 2024 (englisch).
- ↑ Fare Capping on Metro. Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority, abgerufen am 30. Juni 2024 (englisch).
- ↑ livejournal.com, abgerufen am 24. Juni 2024
- ↑ Alexej Michejew: Eins, Zwei, Drei, Vier, Fünf – mehr als nur Zahlen, online auf de.rbth.com, abgerufen am 24. Juni 2024
- ↑ Iwan Denisenko: Wie haben sich die Fahrscheine für die Moskauer Metro im Laufe der Jahre verändert?, online auf de.rbth.com, abgerufen am 24. Juni 2024
- ↑ MVV-Tickets: Ein Überblick. 2024. (PDF) Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH, abgerufen am 24. Juni 2024.
- ↑ Ticket-Preise. Gültig ab 1.1.2024. (PDF) Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH, abgerufen am 24. Juni 2024.
- ↑ Ein paar Stationen fahren lohnt sich nicht? – Von wegen. Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH, abgerufen am 24. Juni 2024.
- ↑ Tickets. Wiener Linien GmbH und Co KG, abgerufen am 24. Juni 2024.
- ↑ What is a ‘Short Journey’ Mobilis ticket? Communauté tarifaire Vaudoise, abgerufen am 26. Juni 2024 (englisch).
- ↑ Prices. Communauté tarifaire Vaudoise, abgerufen am 24. Juni 2024 (englisch).
- ↑ https://dingler.bbaw.de/articles/ar316134.html
- ↑ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0196890415007657
- ↑ https://worldwiderails.com/how-efficient-are-steam-locomotives/?expand_article=1
- ↑ https://www.vaguelyinteresting.co.uk/vip-06-an-experience-of-hades/
- ↑ The surprising story of steam trains on the Central line. ianvisits.co.uk, 7. November 2023, abgerufen am 14. Juni 2024.
- ↑ a b c d e f Robert Schwandl: Metros in Britain. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2006.
- ↑ a b c d e f g Christoph Groneck: U-Bahn, S-Bahn & Tram in Paris. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2020.
- ↑ Hamburger Hochbahn AG (Hrsg.): Von null auf hundert in nur sechs Jahren. 1906 bis 1912: Wir bauen Hamburgs erste U-Bahn. Völker-Verlag, Hamburg 2007.
- ↑ Francisco Olaya Morales, Oscar Llorens, Chema Matía: Metro 100. 1919–2019. 2. Auflage. Metro Madrid S.A. (Hrsg.), Madrid 2019, ISBN 978-84-947921-1-3.
- ↑ a b David Bennett: Metro. Die Geschichte der Untergrundbahn. transpress, Stuttgart 2005.
- ↑ Greg Beyer: The History and Beauty of the Moscow Metro. CNN, 25. Oktober 2023, abgerufen am 16. August 2024 (englisch).
- ↑ Uwe Klußmann: Survival-Training im Untergrund. Spiegel Online, 24. Oktober 2006, abgerufen am 16. August 2024.
- ↑ Tamara Hardingham-Gill: ‘Palaces of the people’: Inside the lavish metro stations of the Soviet era. CNN, 11. November 2019, abgerufen am 16. August 2024 (englisch).
- ↑ https://pedestrianobservations.com/2019/01/25/the-soviet-bloc-way-of-building-rapid-transit/
- ↑ https://m.dw.com/en/next-stop-art-history-on-the-moscow-metro/a-19101261
- ↑ a b Robert Schwandl: U-Bahnen in Skandinavien. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2004.
- ↑ a b c d e Mark Ovenden: Transit Maps of the World. Penguin Books, New York City 2015.
- ↑ Christoph Groneck, Robert Schwandl: Tram Atlas Frankreich. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2022.
- ↑ a b Florian Schütz: München U-Bahn Album, S. 8ff. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2008.
- ↑ a b c Philipp Krammer, Robert Schwandl: Stuttgart Stadtbahn Album, S. 10ff. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2008.
- ↑ a b c Christoph Groneck: Köln/Bonn Stadtbahn Album, S. 8 ff. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2005.
- ↑ a b Michael Schedel: Nürnberg U-Bahn Album, S. 6ff. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2007.
- ↑ a b c d Christoph Groneck, Paul Lohkemper, Robert Schwandl: Rhein-Ruhr Stadtbahn Album 1. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2005.
- ↑ a b c Christoph Groneck, Paul Lohkemper, Robert Schwandl: Rhein-Ruhr Stadtbahn Album 2. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2006.
- ↑ a b Robert Schwandl: Frankfurt Stadtbahn Album. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2008.
- ↑ a b Robert Schwandl: Hannover Stadtbahn Album. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2005.
- ↑ Robert Schwandl: Berlin U-Bahn Album. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2023.
- ↑ a b Robert Schwandl: U-Bahn, S-Bahn & Tram in Berlin. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2022.
- ↑ Straßenbahnatlas Rumänien 2004, Seite 50
- ↑ a b Deutsche Bahn: Auftrag für erste Metro in Belgrad. lok-report.de, 8. Mai 2023, abgerufen am 8. Mai 2023.
- ↑ Serbien: China, Deutschland und Frankreich bauen die Metro Beograd auf. lok-report.de, 8. Mai 2023, abgerufen am 10. Dezember 2023.
- ↑ Population at the beginning of year and population change and key vital statistics in regions, cities, towns and municipalities – Indicator, Territorial unit and Time period. Centrālā statistikas pārvalde (Statistisches Amt der Republik Lettland), abgerufen am 11. Mai 2023 (englisch).
- ↑ a b Metro systems: efficient, effective rapid. Alstom SA, abgerufen am 16. Dezember 2023 (englisch).
- ↑ MetroLink. Transport Infrastructure Ireland, abgerufen am 22. Februar 2024 (englisch).
- ↑ PM takes inaugural ride on Thessaloniki metro during trial run | eKathimerini.com. 18. Mai 2023, abgerufen am 22. Februar 2024 (englisch).
- ↑ Andrew Garn mit Paola Antonelli, Udo Kultermann und Stephen Van Dyk: Weltausstellungen 1933–2005. Architektur Design Graphik. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2008.
- ↑ Arne Cypionka, Der Spiegel: Erste elektrische U-Bahn 1896: Als Budapest in den Untergrund ging. Abgerufen am 20. Dezember 2023.
- ↑ Archives: L’inauguration du métro de Montréal. CBC/Radio-Canada, 13. Oktober 2022, abgerufen am 22. Dezember 2023 (französisch).
- ↑ Archives: Au printemps 1967, on inaugurait la nouvelle ligne jaune du métro de Montréal. CBC/Radio-Canada, 30. März 2022, abgerufen am 22. Dezember 2023 (französisch).
- ↑ Toshio Nakamura: Transport modes of people and goods at Expo 2005 Aichi, Japan and their features. (PDF) In: Sustainable Innovation and Legacies in Expos of the 21st Century. A World in Common. Bulletin des Bureau International des Expositions 2017. Bureau International des Expositions, 2017, abgerufen am 1. April 2024.
- ↑ Sapporo 1972: 50 years of Olympic legacy. Internationales Olympisches Komitee, 25. Januar 2022, abgerufen am 13. März 2024.
- ↑ U-Bahnlinie U3 von Moosach nach Fürstenried West auf u-bahn-muenchen.de, abgerufen am 27. Mai 2024
- ↑ Oliver Meiler: Die U-Bahn. In: Der Stil der Spiele. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 20./21. Juli 2024, S. 54
- ↑ Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen der Freien und Hansestadt Hamburg (Hrsg.): Olympische und Paralympische Spiele 2024 in Hamburg OlympiaCity und Sportstätten. Selbstverlag, Hamburg 2015.
- ↑ Christian Hinkelmann: Nach Olympia-Aus: U4 wird nicht Richtung Süden verlängert. 30. November 2015, abgerufen am 1. Juni 2017.
- ↑ Der neue Stadtteil Grasbrook. (PDF) Präsentation der Senatskanzlei der Freien und Hansestadt Hamburg vom 12. September 2017. Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen der Freien und Hansestadt Hamburg, 12. September 2017, abgerufen am 27. Februar 2024.
- ↑ David Burroughs: Nizhniy Novgorod opens metro extension in time for World Cup. lok-report.de, 18. Juni 2018, abgerufen am 27. Februar 2024.
- ↑ Nizhny Novgorod World Cup metro extension inaugurated. lok-report.de, 13. Juni 2018, abgerufen am 27. Februar 2024.
- ↑ a b Robert Schwandl: Hamburg U-Bahn & S-Bahn Album. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2004.
- ↑ https://www.railjournal.com/passenger/metros/mumbai-opens-first-metro-line/
- ↑ https://www.constructionworld.in/transport-infrastructure/metro-rail-and-railways-infrastructure/-mumbai-metro--mmrda-completes-overhead-electrification-work/27392
- ↑ https://themetrorailguy.com/2023/12/29/4-bidders-for-mumbai-metro-line-7a-9s-electrification-contract-ca-176/
- ↑ Führerlos durch Vancouver in: Straßenbahn Magazin 5/98, S. 58 ff.
- ↑ A global bid for automation: UITP Observatory of Automated Metros confirms sustained growth rates for the coming years. (PDF) International Association of Public Transport, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 1. Mai 2016; abgerufen am 24. April 2023 (englisch).
- ↑ a b François Guénard, Vladimir Cabanis, Simon Riou: Driverless metro market set to surge. In: Railway Gazette International. Band 180, Nr. 2, Februar 2024, ISSN 0373-5346, S. 18–21.
- ↑ a b c World Report on Metro Automation 2018. (PDF) Internationaler Verband für öffentliches Verkehrswesen, April 2019, abgerufen am 9. November 2023 (englisch).
- ↑ a b U2 Update: Wir machen die U2 fit für die automatische U-Bahn-Zukunft. Wiener Linien GmbH & Co KG, abgerufen am 9. Dezember 2023.
- ↑ a b Oliver Schirg: Rauchen verboten! 50 Jahre rauchfreie U-Bahn in Hamburg. In: Hamburger Abendblatt – Onlineausgabe vom 1. Februar 2014. 1. Februar 2014, abgerufen am 9. Januar 2024.
- ↑ Andreas Conrad: Rauchen in der U-Bahn? Ja, aber nur mit Theaterqualm... In: Tagesspiegel – Onlineausgabe vom 11. Mai 2017. 11. Mai 2017, abgerufen am 9. Januar 2024.
- ↑ Leading manufacturers of metro rolling stock worldwide in 2022, based on market share. Statista Research Department, 31. August 2023, abgerufen am 15. Dezember 2023.
- ↑ Dominik Feldes: Der Schienenfahrzeughersteller Alstom hat sich mit Bombardier grosse Probleme eingehandelt. In: Neuer Zürcher Zeitung – Onlineausgabe vom 8. Oktober 2021. 8. Oktober 2021, abgerufen am 15. Dezember 2023.
- ↑ INNEO, Sicherheit und Komfort für die Städte der Zukunft. Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A., abgerufen am 18. Dezember 2023.
- ↑ Inspiro – die Metro von Siemens Mobility. Siemens Mobility, abgerufen am 18. Dezember 2023.
- ↑ METRO. Stadler Rail AG, abgerufen am 18. Dezember 2023.
- ↑ Die Zukunft steht in den Startlöchern. Berliner Verkehrsbetriebe AöR, abgerufen am 6. August 2024.
- ↑ Netzerweiterung U5 Ost Machbarkeitsuntersuchung. (PDF) Hamburger Hochbahn AG über Transparenzportal der Freien und Hansestadt Hamburg, abgerufen am 31. Dezember 2023.
- ↑ Siemens Mobility rüstet Berliner U-Bahn erstmals mit CBTC-Technologie für teilautomatisierten Betrieb aus. Siemens Mobility, 5. Juli 2024, abgerufen am 11. August 2024.
- ↑ Berlin/BVG: Kleinprofil-U-Bahnzug JK eiangetroffen. DVV Media Group GmbH/Eurailpress, 11. Januar 2024, abgerufen am 6. August 2024.
- ↑ a b Robert Schwandl: U-Bahn, S-Bahn & Tram in Hamburg. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2020
- ↑ Alle 100 Sekunden eine U-Bahn für Hamburg. Hamburger Hochbahn AG, abgerufen am 11. August 2024.
- ↑ Hallo Zukunft! Die neue U-Bahn-Generation DT6. (pdf) Präsentation der Hamburger Hochbahn AG anlässlich der Bekanntgabe des Abschlusses des Rahmenvertrags mit Alstom. Hamburger Hochbahn AG, 10. Juli 2024, abgerufen am 11. Juli 2024.
- ↑ Robert Schwandl, Wolfgang Wellige: U-Bahn, S-Bahn & Tram in München. Robert Schwandl Verlag, Berlin 2021
- ↑ Urteil 2Ob262/06b des Obersten Gerichtshofs für Österreich, online auf ris.bka.gv.at, abgerufen am 12. Februar 2024
- ↑ Kaba-Gruppe erhält Grossauftrag für Metro von Hongkong auf swissinfo.ch, abgerufen am 12. Februar 2024
- ↑ Bahnsteigtüren in der Wiener U-Bahn – die Antworten auf die zehn häufigsten Fragen. Unternehmensblog der Wiener Linien, 9. September 2022, abgerufen am 15. Dezember 2023.
- ↑ U5: Automatisch in die Zukunft. schneller-durch-hamburg.de, 10. Dezember 2019, abgerufen am 29. November 2023.
- ↑ „Weiter Warten auf die Linie U3“, Nürnberger Nachrichten, 26. Juli 2006, Seite 13
- ↑ Weg mit der Lücke oder wie der Gapfiller der Barrierefreiheit hilft. Dialog-Blog der Hamburger Hochbahn AG, 15. März 2017, abgerufen am 29. November 2023.
- ↑ An Bealach Deiridh a cuireadh faoi bhráid An Bhoird Phleanála. Transport Infrastructure Ireland, 9. Oktober 2020, abgerufen am 1. Februar 2024 (irisch).
- ↑ Image Gallery - Tá an leagan Gaeilge ag teacht go luath. Transport Infrastructure Ireland, 9. Oktober 2020, abgerufen am 1. Februar 2024 (irisch).
- ↑ Census 2022 Profile 8 - The Irish Language and Education. Irish Language and the Gaeltacht. Central Statistics Office der Republik Irland, abgerufen am 24. April 2024.
- ↑ 11ra -- Key figures on population by region, 1990–2023. Tilaskokeskus (Statistischer Dienst der Republik Finnland), abgerufen am 28. April 2024.
- ↑ Jack Jedwab: Capital languages : Differences in knowledge and use of English and French in Ottawa and Gatineau. Canadian Institute for Research on Linguistic Minorities, 2011, abgerufen am 14. April 2024 (englisch).
- ↑ Joseph Pringle: Ottawa asks for feedback on new O-Train station names. CTV News, 6. August 2020, abgerufen am 1. Februar 2024 (englisch).
- ↑ https://www.20minutes.fr/rennes/2081887-20170607-rennes-action-reclamer-plus-breton-metro
- ↑ Mariana Mogilevich, Ben Campkin and Rebecca Ross: The symbolic simplicity of Mexico City's metro signs. In: The Guardian – Onlineausgabe vom 9. Dezember 2014. 9. Dezember 2014, abgerufen am 16. Dezember 2023.
- ↑ https://urbanauth.de/Artikel/2023/mexiko-stadt-ikonografie-des-oeffentlichen-verkehrs/
- ↑ https://www.speedweek.com/formel1/news/101038/U-Bahn-in-Mexiko-Stadt-Zurueck-zur-Zeichensprache.html
- ↑ Station naming rights. Metropolitan Transportation Authority, 9. Oktober 2020, abgerufen am 19. Dezember 2023 (englisch).
- ↑ Staff Summary: Re-Naming of MTA Facilities at the Request of Third-Party Sponsors. (PDF) Metropolitan Transportation Authority, 22. Juli 2013, abgerufen am 19. Dezember 2023 (englisch).
- ↑ a b Corporate Partnership. Chicago Transit Authority, abgerufen am 19. Dezember 2023 (englisch).
- ↑ a b Station Naming Rights. (PDF) Chicago Transit Authority, abgerufen am 19. Dezember 2023 (englisch).
- ↑ Lee Yeon-woo: Financial firms battle for subway naming rights in Seoul. The Korea Times, 23. August 2023, abgerufen am 19. Dezember 2023 (englisch).
- ↑ Station Naming Rights. Prasarana Malaysia Berhad, abgerufen am 19. Dezember 2023 (englisch).
- ↑ a b TTC deal opens door to station naming rights. CBC/Radio-Canada, 7. Juli 2011, abgerufen am 16. Dezember 2023 (englisch).
- ↑ a b Mike Walker: TTC considers selling naming rights of stations. CTV News, 15. April 2023, abgerufen am 19. Dezember 2023 (englisch).
- ↑ SEPTA Board Approves Station Naming Rights Agreement. Southeastern Pennsylvania Transportation Authority, 24. Juni 2010, abgerufen am 16. Dezember 2023 (englisch).
- ↑ Dan Geringer: SEPTA renames station for $3.4M. In: The Philadelphia Inquirer – Onlineausgabe vom 25. Juni 2010. 25. Juni 2010, abgerufen am 16. Dezember 2023 (englisch).
- ↑ Laura J. Nelson: Transit officials backtrack on controversial policy to sell naming rights for Metro stations. In: Los Angeles Times – Onlineausgabe vom 17. Februar 2017. 27. Februar 2017, abgerufen am 19. Dezember 2023 (englisch).
- ↑ Kriston Capps: The ‘Namewashing’ of Public Transit. Bloomberg, 25. November 2019, abgerufen am 19. Dezember 2023 (englisch).
- ↑ Andrew Maykuth, Jason Laughlin: SEPTA sells naming rights of AT&T Station to NRG. In: The Philadelphia Inquirer – Onlineausgabe vom 26. Juli 2018. 26. Juli 2018, abgerufen am 16. Dezember 2023 (englisch).
- ↑ a b Thomas Urban: Spanien:Vodafone gibt Madrids Herz frei. In: Süddeutsche Zeitung – Onlineausgabe vom 26. Juli 2016. 26. Juli 2016, abgerufen am 16. Dezember 2023.
- ↑ Thomas Urban: LRT-1 Station is now Yamaha Monumento. Phar Partnerships, 14. Februar 2018, abgerufen am 16. Dezember 2023 (englisch).
- ↑ FOI request detail: Burberry Street. Request ID: FOI-2093-2324. transport for London, 10. Oktober 2023, abgerufen am 2. Mai 2024.
- ↑ Sonya Dowsett: Madrid Sol metro station to lose 'Vodafone' tag. In: Reuters. 19. Februar 2016, abgerufen am 16. Dezember 2023.
- ↑ a b Rüdiger Frank: Nordkorea, Innenansichten eines totalen Staates, S. 45ff. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2014.
- ↑ Rüdiger Frank: Unterwegs in Nordkorea. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2018.
- ↑ Shelter in wartime. London Transport Museum, abgerufen am 22. August 2024 (englisch).
- ↑ ORF at/Agenturen red: Charkiw richtet Klassenräume in U-Bahnhöfen ein. 30. August 2023, abgerufen am 31. August 2023.
- ↑ Civil defence shelters in Helsinki. Helsinki City Rescue Department, abgerufen am 26. Mai 2024 (englisch).
- ↑ Helsinki's 'underground city'. DW, 12. August 2023, abgerufen am 24. Mai 2024.
- ↑ Helsinki's 'underground city' reflects tense position as Russia's neighbor. abcnews.go.com, 12. Mai 2022, abgerufen am 24. Mai 2024.
- ↑ Finland counted its bomb shelters and found 50,500 of them. Reuters, 29. August 2023, abgerufen am 24. Mai 2024.
- ↑ Beneath Helsinki, Finns Prepare for Russian Threat. wsj.com, 14. Juli 2017, abgerufen am 24. Mai 2024.
- ↑ Adrian Lim: Biggest underground train depot set to become even bigger. In: The Straits Times, Onlineausgabe vom 30. Oktober 2015, aktualisiert am 19. Januar 2016. 19. Januar 2016, abgerufen am 23. Mai 2024.
- ↑ Circle Line 6. Closing the Loop. Land Transport Authority der Republik Singapur, abgerufen am 23. Mai 2024 (englisch).
- ↑ Pressemitteilung: Alstom to provide integrated metro system for the city of Cluj-Napoca in Romania. Alstom SA, 23. Mai 2023, abgerufen am 16. Dezember 2023 (englisch).
- ↑ Alstom in Singapore. (PDF) Alstom SA, abgerufen am 16. Dezember 2023 (englisch).
- ↑ E&M(Turnkey). Hyundai Rotem, abgerufen am 16. Dezember 2023.
- ↑ Schlüsselfertige Lösungen von Siemens Mobility. Siemens Mobility, abgerufen am 16. Dezember 2023.
- ↑ Pressemitteilung: Siemens Mobility liefert schlüsselfertiges Metro-System für das Projekt „Sydney Metro – Western Sydney Airport“. Siemens Mobility, 21. Dezember 2022, abgerufen am 16. Dezember 2023.
- ↑ Pressemitteilung: Siemens baut vollautomatischen People Mover am Flughafen Bangkok. Siemens Mobility, 14. Dezember 2017, abgerufen am 16. Dezember 2023.
- ↑ Pressemitteilung: Siemens liefert vollautomatischen People Mover für Flughafen Frankfurt. Siemens Mobility, 20. März 2018, abgerufen am 16. Dezember 2023.
- ↑ VAL – Automated People Mover. Siemens Mobility, abgerufen am 16. Dezember 2023.
- ↑ Le métro parisien sous l'occupation. Archives du chemin de fer, abgerufen am 18. August 2024 (französisch).
- ↑ Chronik 1990–2000. Auf: wiener-untergrund.at. Abgerufen am 29. Oktober 2017.
- ↑ Was geschah mit aufgelassenen Stationen? Abgerufen am 29. Oktober 2017.
- ↑ Verkehrsentwicklungsplan. Beschluss der Vollversammlung des Stadtrats vom 15. März 2006. (PDF) Referat für Stadtplanung und Bauordnung der Landeshauptstadt München., abgerufen am 12. Dezember 2023.
- ↑ FNP Berlin, Neubekanntmachung vom Januar 2015 einschließlich aller wirksamen Änderungen und Berichtungen bis Ende April 2023. (PDF) Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen des Landes Berlin, abgerufen am 12. Dezember 2023.
- ↑ Flächennutzungsplan Berlin – Themenkarte Schienengebundener Nahverkehr. (PDF) Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen des Landes Berlin, abgerufen am 12. Dezember 2023.
- ↑ Flächennutzungsplan Berlin – FNP 94. Erläuterungsbericht. (PDF) Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz des Landes Berlin, abgerufen am 12. Dezember 2023.
- ↑ Konzeptstudie zur U-Bahn-Netzerweiterung: Ergebnisbericht. (PDF) Hamburger Hochbahn AG, Dezember 2014, abgerufen am 6. Mai 2024.
- ↑ Netzerweiterung U5 Ost – Machbarkeitsuntersuchung. (PDF) Hamburger Hochbahn AG, 10. April 2016, abgerufen am 6. Mai 2024.
- ↑ Planfeststellungsbeschluss nach § 28 Abs. 1 PBefG für den Neubau der U-Bahnlinie U5-Ost City Nord bis Bramfeld. (PDF) Behörde für Wirtschaft und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg, 30. September 2021, abgerufen am 6. Mai 2024.
- ↑ U5 Ost City Nord bis Bramfeld. Planfeststellungsunterlagen, Anlage 02.01 Erläuterungsbericht U5 Ost, 3. Änderung. (PDF) Behörde für Wirtschaft und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg, 30. September 2021, abgerufen am 6. Mai 2024.
- ↑ Frankreich: Neue Züge mit höherer Kapazität für die Pariser Metro-Linie 14 auf lok-report.de, abgerufen am 29. Dezember 2023
- ↑ Ralf Mittmann: Weltrekord bei der Pünktlichkeit und Schönheiten im Moskauer Untergrund, Artikel vom 29. Mai 2018, online auf suedkurier.de, abgerufen am 29. Dezember 2023
- ↑ Kiev Metro auf eng.asmetro.ru, abgerufen am 29. Dezember 2023
- ↑ HVG Kiadó Zrt: 125 éves a budapesti "kis földalatti". 1. Mai 2021, abgerufen am 11. Januar 2024 (ungarisch).
- ↑ Archív menetrendek auf villamosok.hu, abgerufen am 5. Dezember 2023
- ↑ https://www.derstandard.at/story/2000123413246/warum-gibt-es-keine-u5
- ↑ https://www.swm.de/magazin/leben/mvg-50-jahre-ubahn
- ↑ Rüdiger Frank: Nordkorea, Innenansichten eines totalen Staates, S. 115. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2014.
- ↑ urbanrail.net, abgerufen am 6. Dezember 2022
- ↑ Security Checkpoints of the Beijing Subway System. Information Center of the Beijing Municipal Culture and Tourism Bureau, 10. März 2014, abgerufen am 8. Dezember 2023 (englisch).
- ↑ Grafik „Beijing Subway Map“. Beijing Subway Ltd., abgerufen am 8. Dezember 2023 (englisch).
- ↑ Owen Hopkins: Architektur – Das Bildwörterbuch. Die wichtigsten Begriffe, Bautypen und Bauelemente. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2012.
- ↑ a b Philipp Meuser (Hrsg.): Architekturführer Moskau, Seite 193ff. DOM publishers, Berlin 2021.
- ↑ John Day, John Reed: The Story of London's Underground. 12. Auflage. Capital Transport, London 2019.
- ↑ Christian Hinkelmann: Teil 2: U4-Station HafenCity Universität – die Lichtphilharmonie. nahverkehrhamburg.de, 6. Dezember 2012, abgerufen am 6. November 2023.
- ↑ a b c d e Benoît Clairoux: Le métro de Montréal, 35 ans déjà. Editions Hurtubise HMH Ltée, Montreal 2001.
- ↑ a b c When Art takes the Metro. (PDF) Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, Januar 2019, abgerufen am 19. Dezember 2023 (englisch).
- ↑ Amalia M. Merino: Stephen Antonakos, 1926–2013. Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority, 31. Oktober 2013, abgerufen am 18. Mai 2024 (englisch).
- ↑ 28 St (6), ROAMING UNDERFOOT, Nancy Blum. Metropolitan Transit Authority, abgerufen am 16. Mai 2024 (englisch).
- ↑ a b Om konsten. Storstockholms Lokaltrafik, abgerufen am 9. Dezember 2023 (schwedisch).
- ↑ a b Historia. Storstockholms Lokaltrafik, abgerufen am 9. Dezember 2023 (schwedisch).
- ↑ a b Le stazioni dell’Arte di Napoli. ANM Azienda Napoletana Mobilità S.p.A., abgerufen am 9. Mai 2024 (italienisch).
- ↑ a b Metro Art. Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority, abgerufen am 9. Mai 2024 (englisch).
- ↑ a b MTA Arts & Design. Metropolitan Transit Authority, abgerufen am 9. Mai 2024 (englisch).
- ↑ a b Program History. Metropolitan Transit Authority, abgerufen am 9. Mai 2024 (englisch).
- ↑ a b About Us. Transport for London, abgerufen am 9. Mai 2024 (englisch).
- ↑ a b History. Transport for London, abgerufen am 9. Mai 2024 (englisch).
- ↑ Storstockholms Lokaltrafik AB (Hrsg.): Konsten i tunnelbanan. Selbstverlag, Stockholm 2008.
- ↑ Världens längsta konstutställning. Storstockholms Lokaltrafik AB, abgerufen am 18. Mai 2024 (schwedisch).
- ↑ David Cox: A tour of the Stockholm metro – the world's longest art gallery. In: The Guardian – Onlineausgabe vom 20. Oktober 2015. 20. Oktober 2015, abgerufen am 19. Mai 2024.
- ↑ Lauren Richards: The World's Longest Art Gallery Is In An Unexpected Location. Static Media/Explore.com, 25. August 2023, abgerufen am 19. Mai 2024.
- ↑ Janelle Zara: Stockholm’s Subway Is the World’s Longest Art Gallery. Condé Nast/Architectural Digest, 5. Juli 2017, abgerufen am 19. Mai 2024.
- ↑ Philipp Meuser (Hrsg.): Architekturführer Pjöngjang, Band 2. DOM publishers, Berlin 2011.
- ↑ Three subway scenes from a 1930s painter. Ephemeral New York, 2. Februar 2015, abgerufen am 9. März 2024.
- ↑ A midcentury artist captures the anonymity of the subway in 5 paintings. Ephemeral New York, 27. März 2023, abgerufen am 9. März 2024.
- ↑ Reading the newspaper on the subway in 1914. Ephemeral New York, 20. Juni 2016, abgerufen am 9. März 2024.
- ↑ Mark Rothko’s solitary 1930s subway platforms. Ephemeral New York, 22. März 2013, abgerufen am 9. März 2024.
- ↑ Elizabeth Brown: 1934: A New Deal for Artists. Smithsonian American Art Museum, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 18. März 2015; abgerufen am 8. März 2024 (englisch).
- ↑ Sonderpostwertzeichen-Serie „U-Bahn-Stationen“. Westfriedhof München. Bundesministerium der Finanzen der Bundesrepublik Deutschland, abgerufen am 8. März 2024.
- ↑ Schmuckblatt "U-Bahn-Stationen in Deutschland". Deutsche Post AG, abgerufen am 8. März 2024.
- ↑ Marienplatz München Briefmarke zu 0,95 EUR 10er-Bogen. Deutsche Post AG, abgerufen am 8. März 2024.
- ↑ Sonderpostwertzeichen-Serie „U-Bahn-Stationen“ Überseequartier Hamburg, Westend Frankfurt. Bundesministerium der Finanzen der Bundesrepublik Deutschland, 1. März 2021, abgerufen am 8. März 2024.
- ↑ Internationale LINIE 1 Adaptionen. Blog der GRIPS Theater gGmbH, 28. November 2023, abgerufen am 1. Februar 2024.
- ↑ Von G-Dur bis U8. Berliner Verkehrsbetriebe AöR, abgerufen am 21. Juli 2024.
- ↑ Tarifzone Liebe – Die Gefühle fahren Straßenbahn. ATG Theater GmbH, abgerufen am 21. Juli 2024.
- ↑ The Musical of Public Transport: Tramway to Love – A.K.A. 'Tarifzone Liebe – Die Gefühle fahren Straßenbahn'. Jung von Matt Aktiengesellschaft, abgerufen am 21. Juli 2024 (englisch).
- ↑ Peter Gutting: METROPIA. kino-zeit.de, abgerufen am 7. Februar 2024.
- ↑ Jennifer S. Lee: A Compromise for the Michael Jackson Subway Station. In: New York Times – Onlineausgabe vom 28. August 2009. 28. August 2009, abgerufen am 31. Januar 2024 (englisch).
- ↑ History 2002. Offizielle Website der Band Pet Shop Boys, abgerufen am 2. Februar 2024.
- ↑ Internetpräsenz des London Transport Museum Shop. London Transort Museum Shop, abgerufen am 2. Mai 2024 (englisch).
- ↑ Internetpräsenz der Boutique STM. Boutique STM, abgerufen am 6. Mai 2024 (französisch).
- ↑ Internetpräsenz der Boutique RATP la ligne. Boutique RAPT la ligne, abgerufen am 6. Mai 2024 (französisch).
- ↑ Internetpräsenz des New York Transit Museum Store. New York Transit Museum Store, abgerufen am 6. Mai 2024 (englisch).
- ↑ Internetpräsenz des Toronto Transit Commission Shop. Toronto Transit Commission Shop, abgerufen am 7. Mai 2024 (englisch).
- ↑ Global Times: China’s deepest underground station expected to open by end of 2021 - Global Times. Abgerufen am 24. März 2024.
- ↑ STM introduces a new audio signal on a few métro railcars. Société de transport de Montréal, 9. August 2010, abgerufen am 25. August 2024 (englisch).
- ↑ Youtube-Video „Il fait beau dans l'métro“. Société de transport de Montréal, 20. Januar 2022, abgerufen am 25. August 2024 (französisch).
- ↑ Christoph Moeskes (Hrsg.): Nordkorea. Einblicke in ein rätselhaftes Land. Christoph Links, Berlin 2004, ISBN 3-86153-318-9, S. 201.


































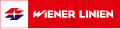















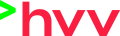

























































































































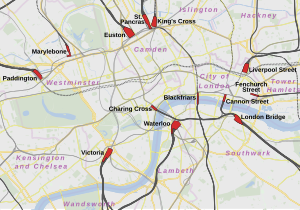








































































![Place-des-Arts, Montreal: „Histoire de la musique à Montréal“ (1967); Hinterglasbild; erstes Kunstwerk in einer Station der Montrealer Metro Künstler: Frédéric Back[251]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8e/Histoire_de_la_musique_%C3%A0_Montr%C3%A9al.jpg/200px-Histoire_de_la_musique_%C3%A0_Montr%C3%A9al.jpg)
![Champ-de-Mars, Montreal: „Les grands formes qui dansent“ (1968) Mid-century modern-Buntglasfenster Architekt: Adalbert Niklewicz Künstlerin: Marcelle Ferron[251]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Montreal_-_Metro_Champ-de-Mars%2C_panorama-20050329.jpg/200px-Montreal_-_Metro_Champ-de-Mars%2C_panorama-20050329.jpg)
![Hankar, Brüssel: „Notre Temps“ (Ausschnitt, 1976) 600 m² großes Wandgemälde Künstler: Roger Somville[252]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/2009-05-21_in_Brussels%2C_Hankar_metro_station.jpg/200px-2009-05-21_in_Brussels%2C_Hankar_metro_station.jpg)
![Pershing Square, Los Angeles: „Neons for Pershing Square“ (1991) Leuchtröhren-Installation als Hommage an das erste Neon-Schild der USA, das 1924 in der Nähe installiert worden war Künstler: Stephen Antonakos[253]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Neon_art_inside_the_Pershing_Square_Metro_subway_station_in_downtown_Los_Angeles%2C_California_LCCN2013631610.tif/lossy-page1-200px-Neon_art_inside_the_Pershing_Square_Metro_subway_station_in_downtown_Los_Angeles%2C_California_LCCN2013631610.tif.jpg)
![Sheppard-Yonge, Toronto: „Immersion Land“ (Ausschnitt, 2002); Wandmosaik aus 1,5 Millionen keramischen Bildpunkten mit Landschaften des südlichen Ontario Künstler: Stacey Spiegel[110]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/34/Sheppard-Yonge_TTC_16248047182.jpg/200px-Sheppard-Yonge_TTC_16248047182.jpg)

![28th Street, New York: „Roaming Underfoot“ (Ausschnitt, 2018) Glasmosaik mit Pflanzenarten aus dem benachbarten Madison Square Park Künstlerin: Nancy Blum[254]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/Blum_Magnolias.jpg/200px-Blum_Magnolias.jpg)